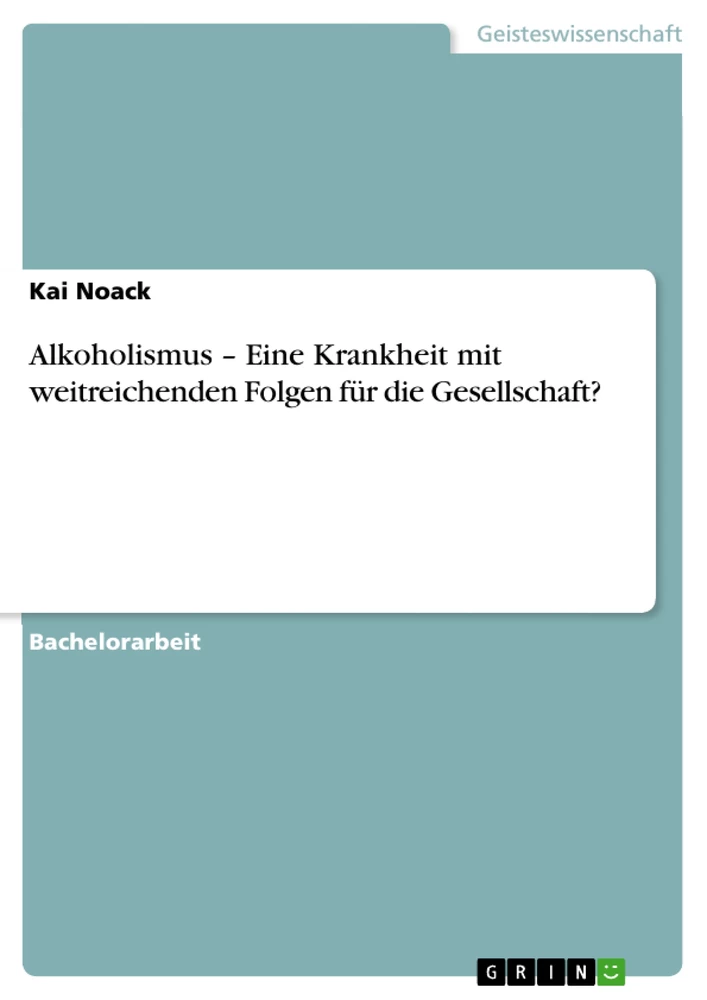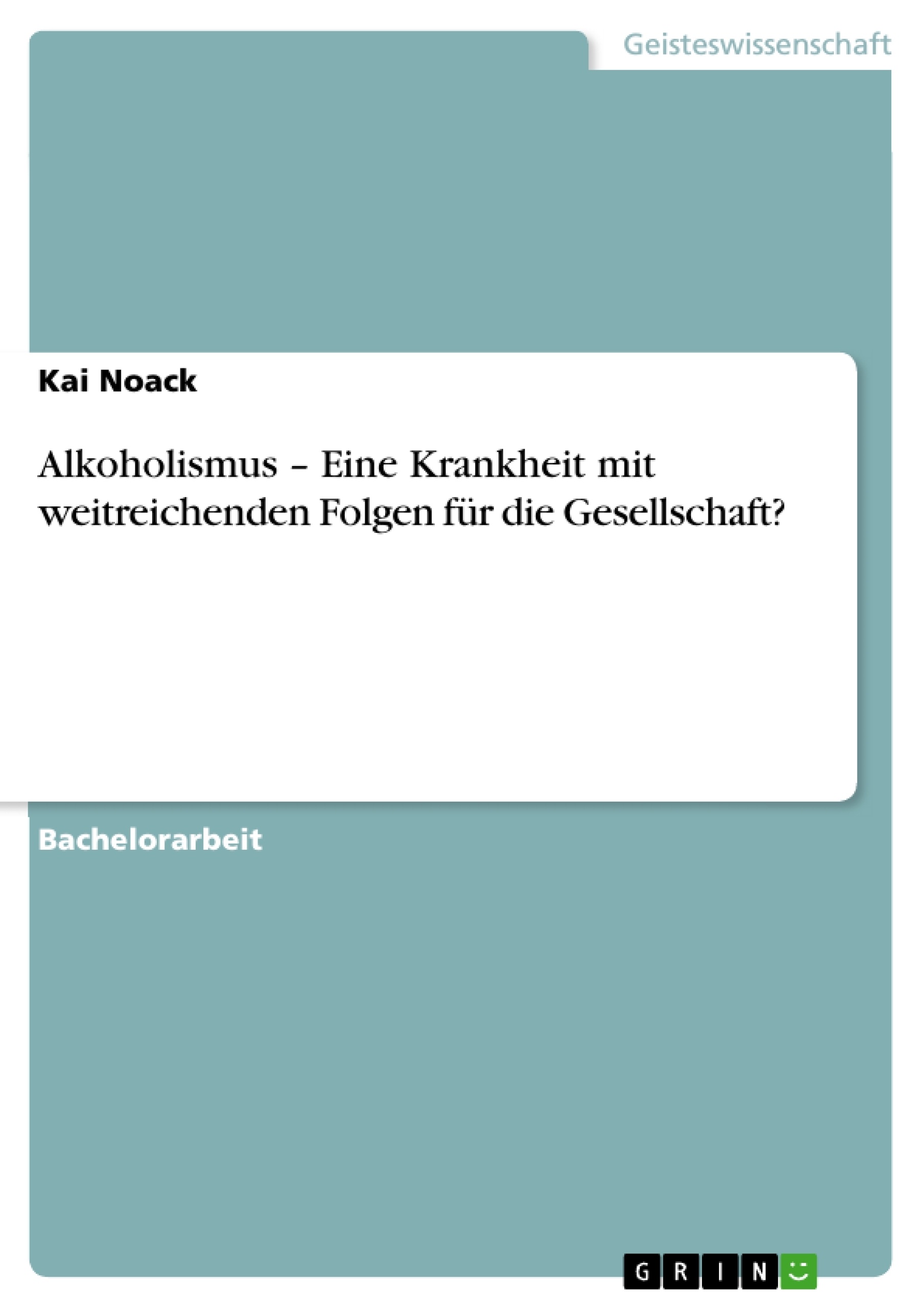Alkohol bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch den chemischen Stoff Äthylalkohol mit der Formel C2H5OH, der durch Vergärung von Zucker aus unterschiedlichen Grundstoffen gewonnen wird und berauschende Wirkung hat. Alkohol zählt zu den Suchtmitteln, deren Erwerb, Besitz und Handel legal sind. Der Genuss von alkoholischen Getränken ist fester Bestandteil des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens und scheint zu vielen Anlässen beinahe obligatorisch. Durch die berauschende Wirkung werden soziale Kontakte sowie Kommunikationen erleichtert und die Entspannung gefördert. Alkohol ist bereits seit Jahrtausenden bekannt und wurde bis in das 19.Jahrhundert als Lebenselixier und Heilmittel geschätzt. Seit dem hat sich das Produktions- und Konsumverhalten mit Einführung der industriellen Herstellung und dem Überangebot nach dem Zweiten Weltkrieg dramatisch verändert (Stat. Bundesamt 2007, S.278). Die Kehrseite des Alkoholkonsums ist ein hohes Potential an Gesundheits- und Suchtgefährdung. Das individuelle Risiko alkoholbedingt zu erkranken, steigt mit der Menge des aufgenommenen Alkohols. Aus diesem Grund werden durch verschiedene Organisationen Konsumklassen definiert. Da es keinen risikofreien Alkoholkonsum gibt, wird ein risikoarmer Konsum reinen Alkohols für Männer bis 30g und für Frauen bis 20g pro Tag angegeben. Ein riskanter Konsum besteht bei Männern mit 30g bis 60g und bei Frauen mit 20g bis 40g pro Tag. Darüber hinaus konsumierte Mengen reinen Alkohols täglich werden als gefährlicher Konsum eingestuft (DHS 2003, S.14).
Legt man die aktuellen Statistiken zugrunde ist ein konstant rückläufiger Alkoholkonsum der Bevölkerung in Deutschland zu verzeichnen, der sich aber auf weiterhin hohem Niveau befindet. In den letzten Jahren wurde jedoch ein Besorgnis erregender Trend hin zu riskanten Konsumpraktiken mit episodisch starkem Konsum bei Kindern und Jugendlichen beobachtet und unter der Bezeichnung „Binge Drinking“ öffentlich bekannt. Wenn von Alkoholmissbrauch geredet wird, so sind wir es inzwischen gewöhnt, fast ausschließlich über Jugendliche zu sprechen. Flatrate-Partys und Komatrinken, Exzesse in der Öffentlichkeit und Alkoholvergiftungen in der Notaufnahme sind mittlerweile in den Medien allgegenwärtig. Ausgangspunkt ist das tragische Beispiel des 16-jährigen Lukas aus Berlin. Er starb auf Grund einer Alkoholintoxikation mit 4,8‰ nach 45 Tequila im März 2007.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Epidemiologische Daten
- Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen
- Akute Alkoholintoxikation und Binge Drinking
- Definitionen
- Symptome
- Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit
- Definition
- Subtypen und Verlauf
- Akute Alkoholintoxikation und Binge Drinking
- Motive und Folgen des Binge Drinking
- Moderne Präventionsmaßnahmen und Interventionen
- Verhaltensprävention
- Verhältnisprävention
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Alkoholismus, insbesondere im Kontext des riskanten Alkoholkonsums bei Jugendlichen ("Binge Drinking"). Ziel ist es, epidemiologische Daten zu präsentieren und die Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen zu beleuchten. Weiterhin werden Motive und Folgen von "Binge Drinking" analysiert, sowie moderne Präventions- und Interventionsmaßnahmen diskutiert.
- Epidemiologische Daten zum Alkoholkonsum in Deutschland
- Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen, insbesondere "Binge Drinking"
- Motive und Folgen des exzessiven Alkoholkonsums bei Jugendlichen
- Präventions- und Interventionsmaßnahmen
- Gesellschaftliche Auswirkungen des Alkoholismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Alkoholismus ein und stellt die Problematik des steigenden Alkoholkonsums, insbesondere bei Jugendlichen, in den Mittelpunkt. Sie beleuchtet den gesellschaftlichen Kontext des Alkoholkonsums, verweist auf die gegensätzlichen Aspekte von Genuss und Gefährdung und führt den Fall des 16-jährigen Lukas als tragisches Beispiel für die Folgen exzessiven Alkoholkonsums an. Die Arbeit fokussiert sich auf die Frage nach den Motiven des Rauschtrinkens bei Jugendlichen, und hinterfragt den Zusammenhang zwischen jugendlichem und erwachsenem Alkoholkonsum, sowie die gesellschaftlichen Kosten von Alkoholismus.
Epidemiologische Daten: Dieses Kapitel präsentiert epidemiologische Daten zum Alkoholkonsum in Deutschland. Es zeigt den hohen Pro-Kopf-Verbrauch von Alkohol und den rückläufigen Trend, der sich jedoch auf einem weiterhin hohen Niveau befindet. Besonders besorgniserregend sind die Zahlen zum riskanten Alkoholkonsum bei Jugendlichen, die einen hohen Anteil an mindestens riskantem Alkoholkonsum und eine steigende Häufigkeit von "Binge Drinking" aufweisen. Die Daten werden aus verschiedenen Studien wie der DHS und ESPAD Studie gewonnen und belegen das Ausmaß des Problems.
Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen. Es definiert "Binge Drinking" und die akute Alkoholintoxikation und listet deren Symptome auf. Die Definitionen von Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit werden erläutert, sowie verschiedene Subtypen und Verlaufsformen der Erkrankung. Es verdeutlicht die Vielfalt und Schwere der mit Alkoholkonsum verbundenen gesundheitlichen und sozialen Probleme.
Motive und Folgen des Binge Drinking: Dieses Kapitel untersucht die Motive und Folgen von "Binge Drinking" bei Jugendlichen. Es beleuchtet mögliche Ursachen wie Gruppendruck, Mutproben und den Wunsch nach Zugehörigkeit. Darüber hinaus werden die vielfältigen negativen Folgen, sowohl für die betroffenen Jugendlichen als auch für ihr Umfeld, analysiert. Hierzu gehören gesundheitliche Schäden, soziale Probleme und die gesellschaftlichen Kosten im Zusammenhang mit Behandlung und Arbeitsausfall.
Moderne Präventionsmaßnahmen und Interventionen: Dieses Kapitel widmet sich den modernen Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Bereich des Alkoholkonsums. Es unterscheidet zwischen Verhaltensprävention und Verhältnisprävention, wobei die verschiedenen Strategien und Ansätze detailliert beschrieben werden. Es geht auf die Herausforderungen und Möglichkeiten der Präventionsarbeit ein und skizziert verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung des Problems.
Schlüsselwörter
Alkoholismus, Binge Drinking, Jugendlicher Alkoholkonsum, Epidemiologie, Prävention, Intervention, Alkoholabhängigkeit, Alkoholmissbrauch, gesellschaftliche Kosten, Risikokonsum.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Alkoholismus und Binge Drinking bei Jugendlichen
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments?
Das Dokument untersucht das Phänomen des Alkoholismus, insbesondere den riskanten Alkoholkonsum bei Jugendlichen (Binge Drinking). Es analysiert epidemiologische Daten, Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen, Motive und Folgen von Binge Drinking sowie moderne Präventions- und Interventionsmaßnahmen.
Welche epidemiologischen Daten werden präsentiert?
Das Dokument präsentiert epidemiologische Daten zum Alkoholkonsum in Deutschland, einschließlich des hohen Pro-Kopf-Verbrauchs, rückläufiger Trends (jedoch auf hohem Niveau) und besorgniserregender Zahlen zum riskanten Alkoholkonsum bei Jugendlichen, insbesondere die hohe Häufigkeit von Binge Drinking. Daten stammen aus Studien wie der DHS und ESPAD Studie.
Welche Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen werden behandelt?
Das Dokument beschreibt verschiedene Erscheinungsformen, darunter Binge Drinking, akute Alkoholintoxikation (mit Symptomen), Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit (inkl. Subtypen und Verlaufsformen). Es verdeutlicht die Vielfalt und Schwere der damit verbundenen gesundheitlichen und sozialen Probleme.
Welche Motive und Folgen von Binge Drinking werden untersucht?
Die Analyse umfasst Motive wie Gruppendruck, Mutproben und den Wunsch nach Zugehörigkeit. Die negativen Folgen für Jugendliche und ihr Umfeld werden untersucht, einschließlich gesundheitlicher Schäden, sozialer Probleme und gesellschaftlicher Kosten (Behandlung, Arbeitsausfall).
Welche Präventions- und Interventionsmaßnahmen werden diskutiert?
Das Dokument unterscheidet zwischen Verhaltensprävention und Verhältnisprävention, beschreibt verschiedene Strategien und Ansätze und geht auf Herausforderungen und Möglichkeiten der Präventionsarbeit ein.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu epidemiologischen Daten, Erscheinungsformen alkoholbezogener Störungen, Motiven und Folgen von Binge Drinking, modernen Präventions- und Interventionsmaßnahmen und eine abschließende Diskussion. Es enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Alkoholismus, Binge Drinking, Jugendlicher Alkoholkonsum, Epidemiologie, Prävention, Intervention, Alkoholabhängigkeit, Alkoholmissbrauch, gesellschaftliche Kosten, Risikokonsum.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Das Dokument ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit Alkoholismus und Binge Drinking bei Jugendlichen. Es ist für Personen gedacht, die sich professionell mit diesem Thema auseinandersetzen.
Wie ist die Struktur des Dokuments?
Das Dokument ist strukturiert mit einer Einleitung, verschiedenen Kapiteln zu spezifischen Aspekten des Themas und einer Zusammenfassung. Es verwendet Überschriften, Unterüberschriften und Aufzählungen, um die Informationen übersichtlich darzustellen.
- Quote paper
- Bachelor Kai Noack (Author), 2010, Alkoholismus – Eine Krankheit mit weitreichenden Folgen für die Gesellschaft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146265