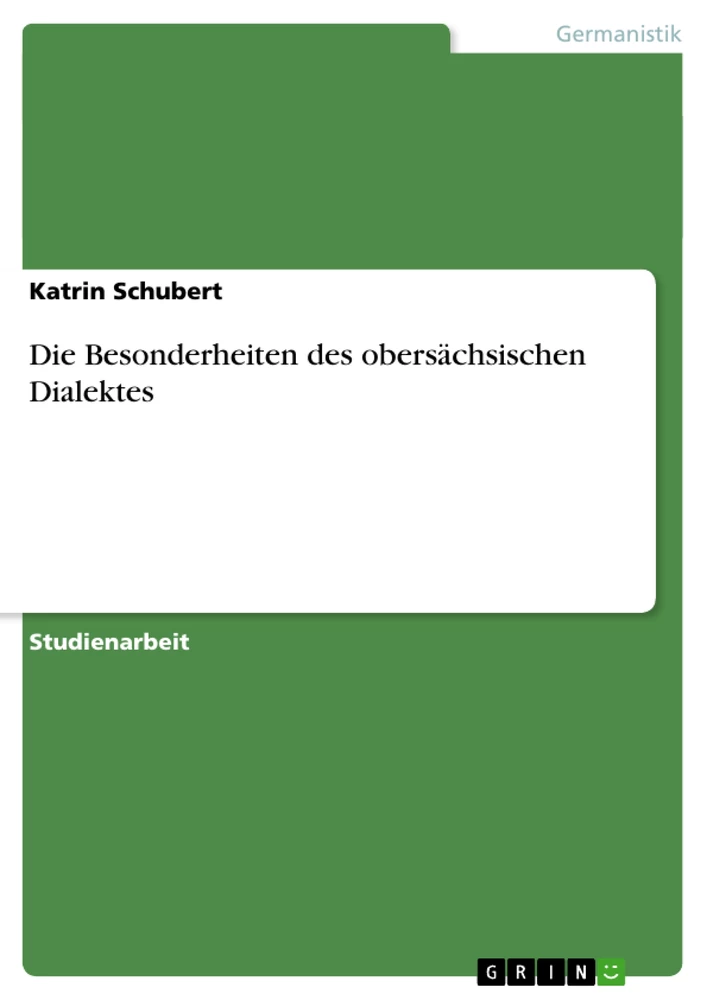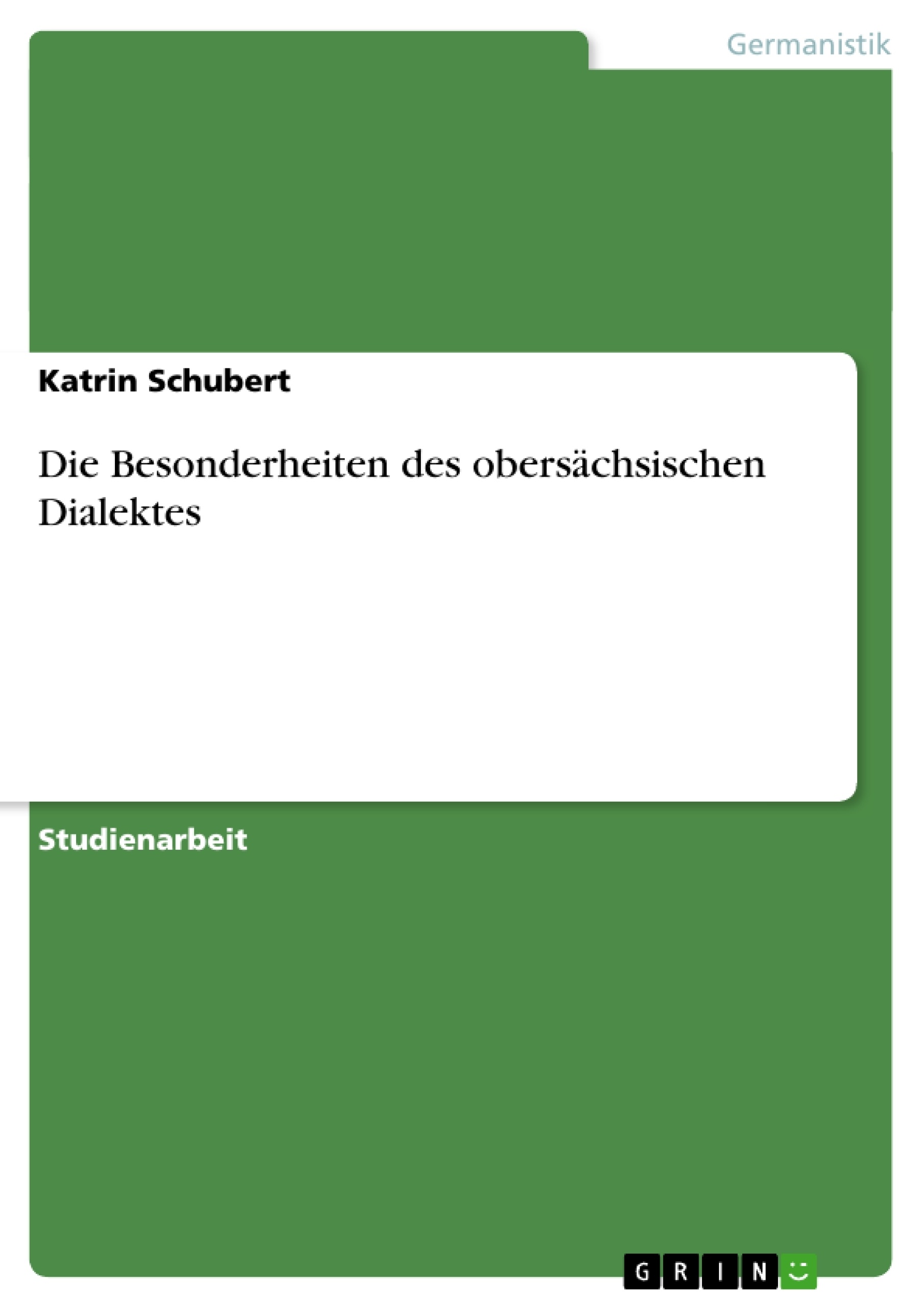„Die Mundart ist von jeher die Sprache der einfachen, arbeitenden Menschen gewesen. Durch die Jahrhunderte fort ist sie uns — freilich nicht ohne gewisse Veränderungen — von unseren Vorfahren vererbt worden. Sie ist lebendiges Zeugnis der Vergangenheit, sie gibt Aufschluß über die gesprochene Sprache längst verflossener Zeiten und ist deshalb zu Recht einer der wesentlichsten Forschungsgegenstände der Sprachwissenschaft geworden.“ (Becker/Bergmann 1969, 17) So schreibt Horst Becker in dem von Gunter Bergman neu bearbeiteten Buch „Sächsische Mundartenkunde“ und misst damit dem Dialekt als Forschungsgegenstand eine große Bedeutung zu. Dialekt ist nichts, was einfach so entsteht wie etwa eine sprunghafte Metamorphose in der Biologie. Dialekt bedeutet Geschichte, Tradition und auch Identität. Die Sprecher in einer bestimmten Region sind oftmals stolz auf Ihre Mundart und möchten sie nur ungern und bestenfalls zu öffentlichen Anlässen ablegen. ‚Zu Hause spricht man so, wie einem der Schnabel gewachsen ist’, so heißt es oftmals im Volksmund, und so weist jede Region andere, jedoch besondere Merkmale auf, die es sich zu untersuchen lohnt. In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich nun mit den Besonderheiten der obersächsischen Mundart befassen, wobei Phänomene im Vokalismus und im Konsonatismus Erwähnung finden werden. Die wesentliche Frage wird dabei sein: „Was ist bei der Aussprache bestimmter Vokale und Konsonanten im obersächsischen und teilweise auch erzgebirgischen Dialekt anders, als in standarddeutscher Realisierung?“ Ein Hauptaugenmerk wird dabei auf der Art und Weise der Artikulation liegen. Im zweiten Teil werden die aufgeführten dialektalen Phänomene anhand einiger Sprachbeispiele überprüft und damit auch hinterfragt. Eine Charakterisierung des Textkorpus der Sprachaufnahmen erfolgt zu Beginn des dritten Kapitels, wobei etwas über Alter, Beruf und Bildung der Sprecher und Sprecherinnen gesagt wird. Ziel der Arbeit soll es sein, besonders auffällige Merkmale des obersächsischen Dialektes herauszustellen und zu untersuchen, nicht aber alle Phänomene detailliert zu beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Theoretisch-begriffliche Grundlagen
- Der obersächsische Dialekt
- Eingrenzung des Untersuchungsgebietes
- Besonderheiten im Vokalismus und Konsonatismus
- Der Vokal a
- Der Vokal e
- Die Vokale ö und ü
- Die Vokale o und u
- Die Diphthonge ai und au
- Kürzungen
- Spirans-Realisierung von g
- Die Konsonanten p und t
- Zusammenfassung
- Empirische Untersuchungen und Ergebnisse
- Charakterisierung des Textkorpus
- Auswertung der Sprachaufnahmen
- Der Vokal a
- Der Vokal e
- Die Vokale ö und ü
- Die Vokale o und u
- Die Diphthonge ai und au
- Kürzungen
- Spirans-Realisierung von g
- Die Konsonanten p und t
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Textkorpus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Besonderheiten des obersächsischen Dialekts, fokussiert auf phonetisch-phonologische Merkmale im Vokalismus und Konsonatismus. Ziel ist es, auffällige Merkmale herauszustellen und zu analysieren, ohne alle Phänomene detailliert zu beschreiben. Die Arbeit stützt sich auf theoretische Grundlagen und empirische Untersuchungen, analysiert konkrete Sprachbeispiele und berücksichtigt regionale Variationen.
- Eingrenzung des obersächsischen Dialektraums und seiner Varietäten.
- Analyse spezifischer phonetischer Merkmale im Vokalismus (z.B. Realisierung von a und e).
- Untersuchung charakteristischer Konsonantenmerkmale (z.B. Spirans-Realisierung von g).
- Auswertung von Sprachaufnahmen zur Überprüfung der theoretischen Aussagen.
- Vergleich des obersächsischen Dialekts mit der Standardsprache.
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort betont die Bedeutung des Dialekts als lebendiges Zeugnis der Vergangenheit und Forschungsgegenstand der Sprachwissenschaft. Es kündigt die Fokussierung auf Besonderheiten des obersächsischen Dialekts im Vokalismus und Konsonatismus an und benennt die zentrale Forschungsfrage nach den Unterschieden zur Standardsprache.
Theoretisch-begriffliche Grundlagen: Dieses Kapitel definiert den obersächsischen Dialektraum und seine Grenzen. Es beschreibt die phonetisch-phonologischen Unterschiede zum Standarddeutschen und benennt die zu untersuchenden Merkmale im Vokalismus und Konsonatismus detailliert. Besondere Aufmerksamkeit wird der offenen Realisierung von e, der Verdunklung von a, der velaren Realisierung von ü und ö, sowie der Spirans-Realisierung von g gewidmet. Die Kapitel basiert stark auf der Literatur von Barden/Großkopf (1998).
Empirische Untersuchungen und Ergebnisse: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Untersuchung, die Auswertung des Textkorpus und die Ergebnisse der Analyse. Es präsentiert detaillierte Befunde zu den im vorherigen Kapitel beschriebenen Merkmalen des obersächsischen Dialekts, basierend auf den untersuchten Sprachaufnahmen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Aussprachevarianten und ihrer Häufigkeit.
Schlüsselwörter
Obersächsischer Dialekt, Vokalismus, Konsonatismus, Phonetik, Phonologie, Standardsprache, Sprachvariation, regionale Varietäten, Artikulation, Sprachaufnahmen, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Besonderheiten des obersächsischen Dialekts
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Besonderheiten des obersächsischen Dialekts, konzentriert sich dabei auf phonetisch-phonologische Merkmale im Vokalismus und Konsonatismus. Ziel ist die Herausstellung und Analyse auffälliger Merkmale, ohne alle Phänomene detailliert zu beschreiben. Die Arbeit kombiniert theoretische Grundlagen mit empirischen Untersuchungen, analysiert konkrete Sprachbeispiele und berücksichtigt regionale Variationen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Eingrenzung des obersächsischen Dialektraums und seiner Varietäten, die Analyse spezifischer phonetischer Merkmale im Vokalismus (z.B. Realisierung von a und e), die Untersuchung charakteristischer Konsonantenmerkmale (z.B. Spirans-Realisierung von g), die Auswertung von Sprachaufnahmen zur Überprüfung der theoretischen Aussagen und einen Vergleich des obersächsischen Dialekts mit der Standardsprache.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, einen theoretisch-begrifflichen Grundlagenteil, einen Teil zu empirischen Untersuchungen und Ergebnissen, ein Literaturverzeichnis und ein Textkorpus. Der theoretische Teil definiert den obersächsischen Dialektraum und beschreibt die phonetisch-phonologischen Unterschiede zum Standarddeutschen. Der empirische Teil beschreibt die Methodik, die Auswertung des Textkorpus und die Ergebnisse der Analyse, basierend auf Sprachaufnahmen.
Welche konkreten phonetischen Merkmale werden untersucht?
Im Fokus stehen der Vokal a, der Vokal e, die Vokale ö und ü, die Vokale o und u, die Diphthonge ai und au, Kürzungen, die Spirans-Realisierung von g und die Konsonanten p und t. Die Analyse betrachtet die Aussprachevarianten und deren Häufigkeit.
Wie wird die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einem Vorwort, das die Bedeutung des Dialekts und die Forschungsfrage beschreibt. Es folgt ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, welches den obersächsischen Dialektraum und seine Besonderheiten im Vokalismus und Konsonatismus definiert. Das darauf folgende Kapitel präsentiert die empirischen Untersuchungen und Ergebnisse basierend auf der Auswertung von Sprachaufnahmen. Die Arbeit schließt mit einem Literaturverzeichnis und dem Textkorpus.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Kombination aus theoretischen Grundlagen und empirischen Untersuchungen. Die empirischen Untersuchungen basieren auf der Auswertung von Sprachaufnahmen, um die theoretischen Aussagen zu überprüfen und die Aussprachevarianten und deren Häufigkeit zu beschreiben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Obersächsischer Dialekt, Vokalismus, Konsonatismus, Phonetik, Phonologie, Standardsprache, Sprachvariation, regionale Varietäten, Artikulation, Sprachaufnahmen, empirische Untersuchung.
Auf welchen Quellen basiert die Arbeit?
Die Arbeit basiert stark auf der Literatur von Barden/Großkopf (1998) und weiteren, im Literaturverzeichnis aufgeführten Quellen. Die empirischen Ergebnisse beruhen auf der Auswertung eines eigenen Textkorpus, welches ebenfalls in der Arbeit enthalten ist.
- Quote paper
- Katrin Schubert (Author), 2006, Die Besonderheiten des obersächsischen Dialektes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/146091