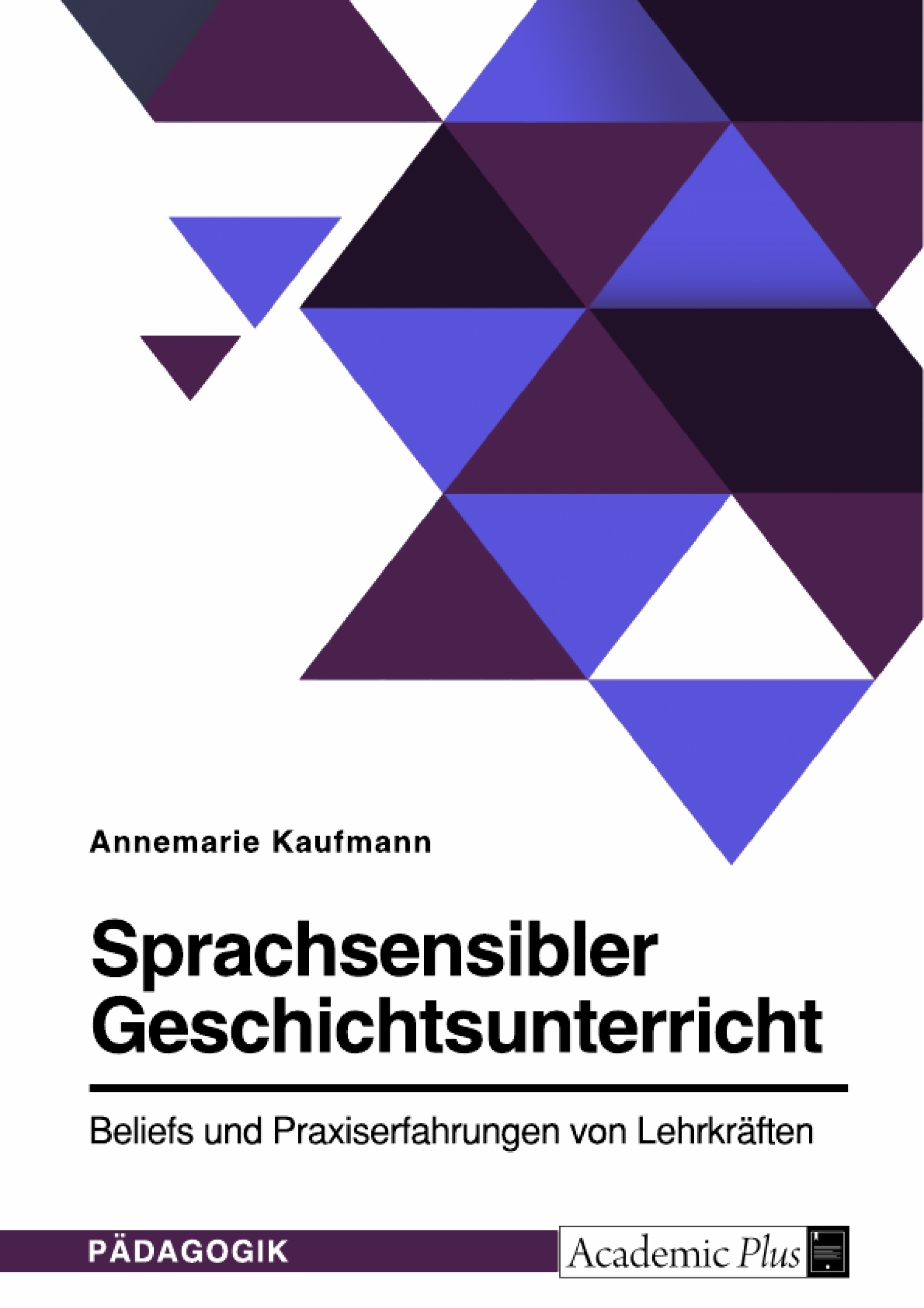Die Bedeutung von Sprache im Kontext des Geschichtsunterrichts ist von zentraler Relevanz für die Vermittlung historischer Inhalte und die Entwicklung geschichtswissenschaftlicher Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern (SuS). Insbesondere vor dem Hintergrund alarmierender Ergebnisse der PISA-Studie von 2022, welche die Lesekompetenz deutscher SuS auf einem historischen Tiefpunkt zeigten, wird die Notwendigkeit eines sprachsensiblen Ansatzes im Unterricht immer dringlicher.
In den letzten zwei Jahrzehnten wurde vermehrt Forschung zum sprachsensiblen Geschichtsunterricht (SSGU) betrieben. Dennoch zeigen Studien und Erfahrungsberichte, dass die Implementierung sprachsensibler Maßnahmen im Geschichtsunterricht auf Schwierigkeiten stößt. Insbesondere die Perspektive der Lehrkräfte und ihre Überzeugungen, auch als beliefs bezeichnet, sind dabei von entscheidender Bedeutung.
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die Lücke in der Forschung zu schließen, indem sie die Perspektive der Lehrkräfte hinsichtlich sprachsensibler Maßnahmen im Geschichtsunterricht untersucht. Dabei sollen nicht nur bestehende Kenntnisse und praktische Anwendungen von sprachsensiblen Ansätzen erfasst werden, sondern auch Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung identifiziert werden.
Um diesem Ziel gerecht zu werden, wird eine qualitativ-empirische Forschungsmethode angewendet. Durch Interviews mit Geschichtslehrkräften sollen Einblicke in ihre Überzeugungen, Erfahrungen und Einschätzungen bezüglich sprachsensibler Maßnahmen gewonnen werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen nicht nur den aktuellen Forschungsstand erweitern, sondern auch konkrete Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung des sprachsensiblen Geschichtsunterrichts liefern.
Durch die Analyse der Ergebnisse und die anschließende Diskussion wird diese Arbeit dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung von Sprache im Geschichtsunterricht zu schärfen und die Implementierung sprachsensibler Maßnahmen zu fördern. Letztendlich soll sie dazu beitragen, die historische Bildung der SuS zu verbessern und somit einen Beitrag zur Stärkung der Lesekompetenz und historischen Bewusstseinsbildung in Deutschland zu leisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretisches
- Sprachsensibler Geschichtsunterricht
- Forschungsstand
- Sprache in Geschichte und Geschichtsunterricht
- Begrifflichkeiten
- Sprachliche Besonderheiten im GU
- Definition
- Relevanz und Entwicklung von sprachsensiblem Unterricht
- Beliefs als Forschungsgegenstand
- Fazit/Desiderata
- Sprachsensibler Geschichtsunterricht
- Methodik
- Qualitativ-empirische Forschung
- Erhebungsmethode
- Sampling
- Kurzprofile der interviewten Personen
- Durchführung der Interviews
- Festlegung des Materials
- Auswertung
- Erläuterungen zur Ergebnisdarstellung
- Ergebnisse
- Sprache als Medium der Geschichte
- Sprachliche Herausforderungen im Geschichtsunterricht
- Bewusstsein für Sprache im Geschichtsunterricht
- Beurteilungen des Ansatzes
- Ansätze für Verbesserung
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Relevanz und Umsetzung sprachsensibler Maßnahmen im Geschichtsunterricht. Sie untersucht die Perspektiven von Lehrkräften auf das Thema und wie deren Überzeugungen (beliefs) den Einsatz sprachsensibler Methoden beeinflussen.
- Sprachliche Herausforderungen im Geschichtsunterricht und deren Einfluss auf das Lernen von Schülerinnen und Schülern
- Das Bewusstsein für Sprache im Geschichtsunterricht und die Bedeutung von sprachsensiblen Unterrichtsmethoden
- Die Überzeugungen von Lehrkräften (beliefs) zum Thema Sprachsensibilität im Geschichtsunterricht und deren Auswirkungen auf die Praxis
- Potenzielle Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Umsetzung sprachsensibler Maßnahmen im Geschichtsunterricht
- Ansätze zur Verbesserung der Sprachsensibilität im Geschichtsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des sprachsensiblen Geschichtsunterrichts (SSGU) vor dem Hintergrund der PISA-Studien und des zunehmenden Bedarfs an sprachlicher Förderung in allen Schulfächern. Sie stellt den Forschungsstand und die Notwendigkeit einer stärkeren Fokussierung auf die Perspektiven von Lehrkräften dar.
- Theoretisches: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Hintergrund zum Thema SSGU, inklusive des aktuellen Forschungsstands, der Beziehung zwischen Geschichte und Sprache, wichtiger Fachbegriffe und der Definition von SSGU. Es beleuchtet die Relevanz und Entwicklung sprachsensiblen Unterrichts und betrachtet das Konzept der beliefs als Forschungsgegenstand.
- Methodik: Es wird die qualitativ-empirische Forschungsmethode erläutert, die in dieser Arbeit zum Einsatz kommt. Dazu gehören die Erhebungsmethode, das Sampling, die Kurzprofile der interviewten Personen sowie die Durchführung und Auswertung der Interviews.
- Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, die Einblicke in die Überzeugungen von Lehrkräften zum Thema Sprachsensibilität im Geschichtsunterricht geben. Es untersucht die Wahrnehmung von Sprache als Medium der Geschichte, die sprachlichen Herausforderungen im Geschichtsunterricht, das Bewusstsein für Sprache bei Lehrkräften, die Beurteilungen des Ansatzes und schließlich die Ansätze für Verbesserungen.
Schlüsselwörter
Sprachsensibler Geschichtsunterricht (SSGU), Sprachbewusstsein, beliefs, Lehrkräfte, Geschichtsunterricht, Sprache, PISA, Lesekompetenz, fachliche Kompetenzen, qualitativ-empirische Forschung, Interview, historische Begriffsbildung, sprachliche Herausforderungen, Verbesserungspotenziale.
- Quote paper
- Annemarie Kaufmann (Author), 2024, Sprachsensibler Geschichtsunterricht. Beliefs und Praxiserfahrungen von Lehrkräften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1457478