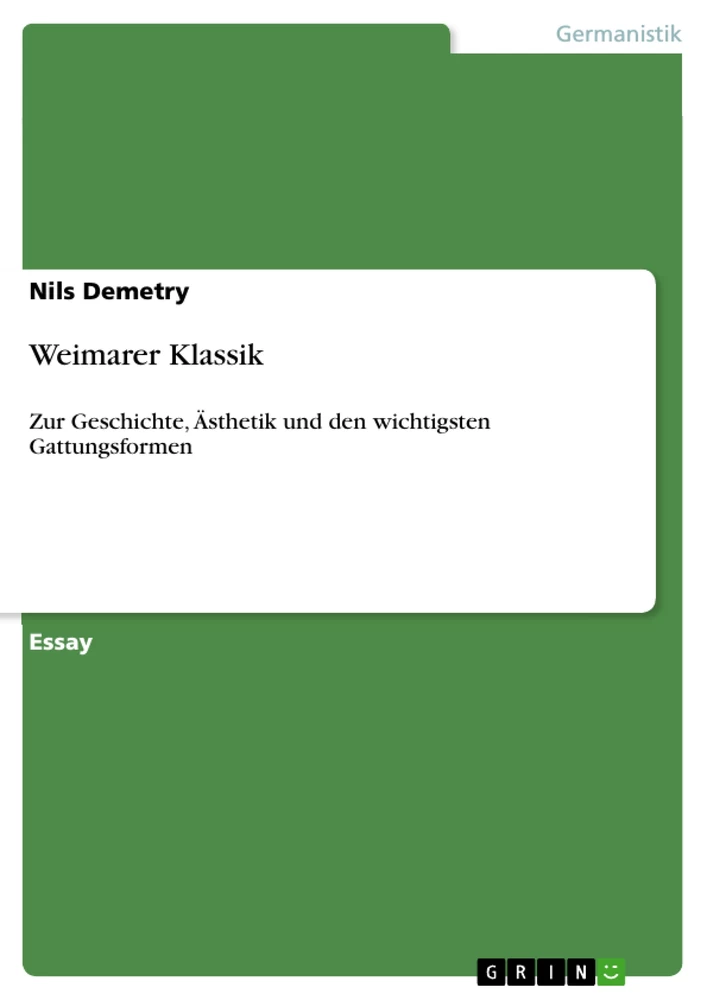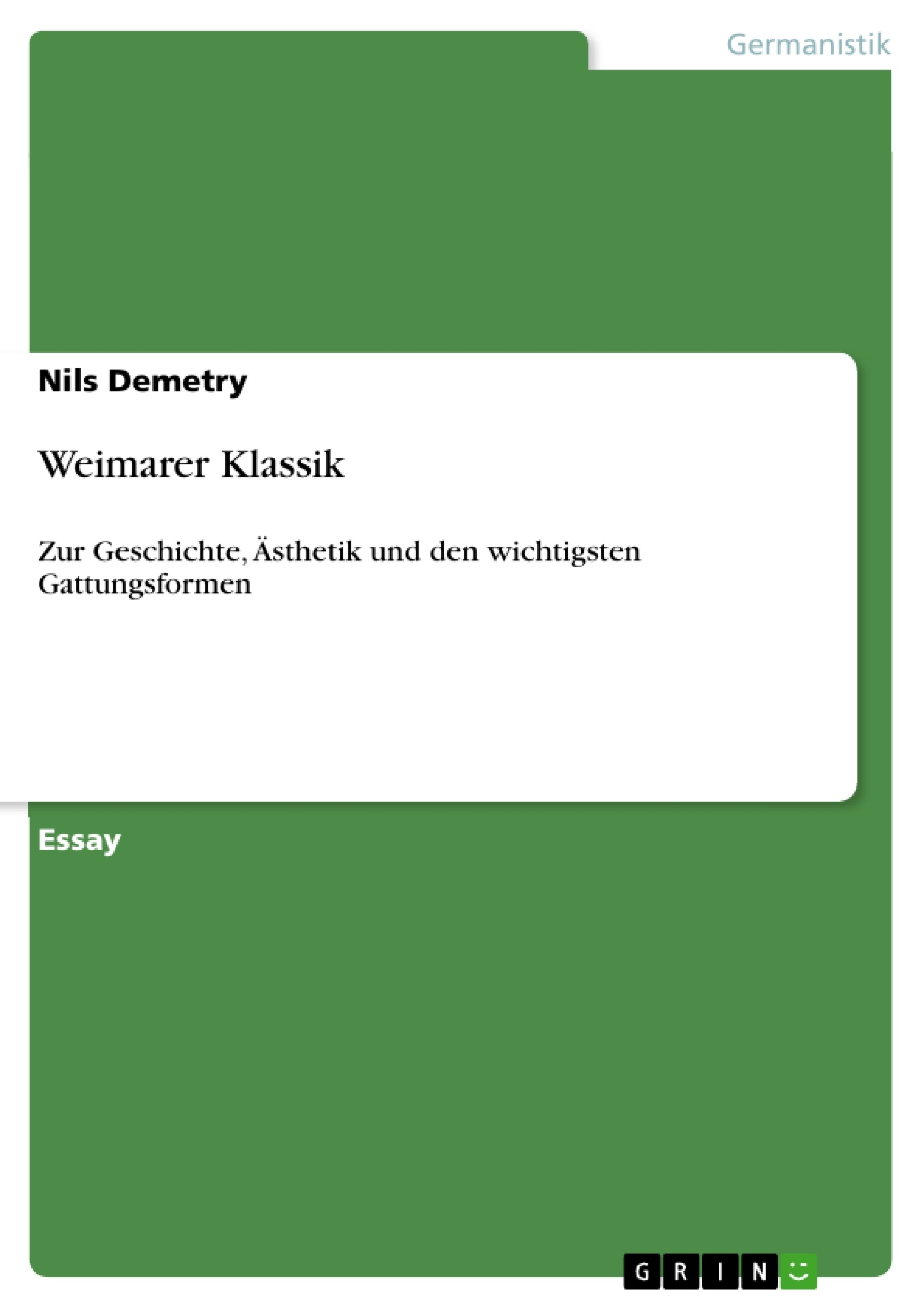Die Weimarer Klassik ist eine Richtung der deutschen Literaturgeschichte, die hauptsächlich auf der Freundschaft zwischen Goethe und Schiller basierte. Diese Zusammenarbeit deckte insgesamt nur einen sehr kurzen Zeitraum ab, nämlich von Goethes Italienreise von 1786 bis 1788 und Schillers Übersiedlung nach Weimar im Jahre 1788 bis zu Schillers Tod 1805.
Sie bezeichnet eine Verdichtung von produktiven Künstlern und Intellektuellen auf engem Raum an einem dafür unwahrscheinlichen Ort, denn Weimar war zu dieser Zeit eine eher kleine Residenzstadt mit etwa 6000 Einwohnern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Was ist die Weimarer Klassik?
- 2. Ästhetische Position der Klassik
- 3. Gattungsformen und Werke der Weimarer Klassik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Weimarer Klassik, ihren historischen Kontext, ihre ästhetischen Prinzipien und ihre wichtigsten literarischen Werke. Der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit von Goethe und Schiller und deren Beitrag zur Entwicklung dieser bedeutenden Epoche der deutschen Literatur.
- Die Entstehung und der historische Kontext der Weimarer Klassik
- Die ästhetischen Prinzipien der Weimarer Klassik (Harmonie, Autonomie etc.)
- Die wichtigsten Gattungen (Drama und Lyrik) der Weimarer Klassik
- Der Vergleich der dramatischen und lyrischen Werke Goethes und Schillers
- Die Rezeption der Weimarer Klassik im Vergleich zu zeitgenössischen Werken
Zusammenfassung der Kapitel
1. Was ist die Weimarer Klassik?: Dieses Kapitel definiert die Weimarer Klassik als eine produktive Phase der deutschen Literaturgeschichte, die hauptsächlich auf der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Goethe und Schiller basiert. Es beschreibt den kurzen Zeitraum dieser Zusammenarbeit (von Goethes Italienreise bis zu Schillers Tod) und hebt die intensive Phase von 1794 bis 1805 hervor. Der Text betont Weimars Bedeutung als ungewöhnlichen Ort für diese Konzentration von Künstlern und Intellektuellen und führt die Leitideen Harmonie und Humanität ein, die als Antwort auf die komplexe Situation in Deutschland und Europa am Ende des 18. Jahrhunderts verstanden werden. Die Rolle von Persönlichkeiten wie Herder, Wieland und Humboldt wird ebenfalls beleuchtet, sowie der Einfluss der Vorklassik, insbesondere Winckelmanns Schrift "Über die Nachahmung der griechischen Werke". Der Abschnitt endet mit der interessanten Beobachtung, dass die Klassiker zu ihrer Zeit weniger gelesen wurden als andere Autoren wie Vulpius, Iffland oder Kotzebue.
2. Ästhetische Position der Klassik: Das Kapitel beleuchtet die vorherrschenden ästhetischen Prinzipien der Weimarer Klassik, nämlich Autonomie und Harmonie, die sich in Vorstellungen wie Klarheit, Reinheit, Maß und Vollendung manifestieren. Es werden verschiedene Gründe für diese ästhetische Ausrichtung genannt: die Konsolidierungsphase Ende des 18. Jahrhunderts in Deutschland, der aufgeklärte Absolutismus in den Kleinstaaten und das Bestreben nach Ausgleich zwischen herrschenden und aufstrebenden Kräften. Der Reifeprozess von Goethe und Schiller weg vom Sturm und Drang wird ebenfalls thematisiert. Der Text diskutiert den von Moritz formulierten Grundsatz der Unabhängigkeit des Kunstwerks von Wirkung und hebt die zunehmende Bedeutung des Sendungsbewusstseins des Künstlers und die Notwendigkeit der Wahrnehmung durch das Publikum hervor (Hegel).
3. Gattungsformen und Werke der Weimarer Klassik: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die wichtigsten Gattungen der Weimarer Klassik – das Drama und die Lyrik – und betont die untergeordnete Rolle des Romans in diesem Kontext. Schillers Ablehnung des Romans als bedeutende literarische Gattung wird zitiert. Im Drama wird der Unterschied zwischen Schiller und Goethe hervorgehoben: Schiller verwendet Stoffe aus der neueren europäischen Geschichte und thematisiert den Konflikt zwischen Ideal und Wirklichkeit in Dramen wie "Don Carlos", "Wallenstein", "Maria Stuart", "Jungfrau von Orleans" und "Wilhelm Tell". Goethe hingegen bevorzugt klassische Stoffe und Prinzipien, wie in "Iphigenie" zu sehen. In der Lyrik wird Goethes Orientierung an klassischen Formen mit Schillers "Gedankenlyrik" kontrastiert, wobei Beispiele wie "Der Spaziergang" und "Das Lied von der Glocke" analysiert werden. Schließlich wird die Bedeutung der Ballade für beide Autoren beleuchtet, mit Goethes "Erlkönig" und Schillers antiken Stoffen als Beispielen. Der Text analysiert den Einsatz der Ballade als Mittel zur Integration von Epik, Drama und Lyrik, sowie der jambischen Sprachgebung in Schillers Balladen.
Schlüsselwörter
Weimarer Klassik, Goethe, Schiller, Harmonie, Humanität, Ästhetik, Autonomie, Drama, Lyrik, Ballade, Gedankenlyrik, Klassizismus, Idealismus, Aufklärung, deutsche Literaturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zur Weimarer Klassik
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über die Weimarer Klassik. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit von Goethe und Schiller und deren Beitrag zur Entwicklung dieser Epoche der deutschen Literatur.
Was wird unter "Weimarer Klassik" verstanden?
Die Weimarer Klassik wird als produktive Phase der deutschen Literaturgeschichte definiert, die hauptsächlich auf der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Goethe und Schiller basiert. Sie umfasst einen relativ kurzen Zeitraum (von Goethes Italienreise bis zu Schillers Tod), wobei die intensivste Phase von 1794 bis 1805 dauerte. Weimar spielte als Zentrum für Künstler und Intellektuelle eine entscheidende Rolle. Leitideen waren Harmonie und Humanität als Antwort auf die komplexe Situation in Deutschland und Europa am Ende des 18. Jahrhunderts.
Welche ästhetischen Prinzipien prägten die Weimarer Klassik?
Die Weimarer Klassik zeichnet sich durch die ästhetischen Prinzipien der Autonomie und Harmonie aus, die sich in Klarheit, Reinheit, Maß und Vollendung manifestieren. Diese ästhetische Ausrichtung wird mit der Konsolidierungsphase Ende des 18. Jahrhunderts in Deutschland, dem aufgeklärten Absolutismus und dem Bestreben nach Ausgleich zwischen herrschenden und aufstrebenden Kräften in Verbindung gebracht. Der Reifeprozess von Goethe und Schiller weg vom Sturm und Drang spielte ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Unabhängigkeit des Kunstwerks von seiner Wirkung (Moritz) und die Bedeutung des Sendungsbewusstseins des Künstlers sowie die Rezeption durch das Publikum (Hegel) werden hervorgehoben.
Welche Gattungen und Werke werden in der Weimarer Klassik behandelt?
Der Text konzentriert sich auf die wichtigsten Gattungen Drama und Lyrik, wobei der Roman eine untergeordnete Rolle spielt. Schillers Ablehnung des Romans wird erwähnt. Im Drama werden die unterschiedlichen Ansätze von Goethe (klassische Stoffe und Prinzipien, z.B. "Iphigenie") und Schiller (neuere europäische Geschichte und der Konflikt zwischen Ideal und Wirklichkeit, z.B. "Don Carlos", "Wallenstein") hervorgehoben. In der Lyrik wird Goethes Orientierung an klassischen Formen mit Schillers "Gedankenlyrik" kontrastiert (Beispiele: "Der Spaziergang", "Das Lied von der Glocke"). Die Bedeutung der Ballade (Goethes "Erlkönig", Schillers antike Stoffe) als Mittel zur Integration von Epik, Drama und Lyrik wird ebenfalls analysiert, ebenso wie die jambische Sprachgebung in Schillers Balladen.
Welche Rolle spielten Goethe und Schiller in der Weimarer Klassik?
Goethe und Schiller stehen im Zentrum der Weimarer Klassik. Der Text betont ihre enge Zusammenarbeit und ihren gemeinsamen Beitrag zur Entwicklung dieser Epoche. Ihre unterschiedlichen Herangehensweisen an das Drama und die Lyrik werden detailliert verglichen und analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Weimarer Klassik?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Weimarer Klassik, Goethe, Schiller, Harmonie, Humanität, Ästhetik, Autonomie, Drama, Lyrik, Ballade, Gedankenlyrik, Klassizismus, Idealismus, Aufklärung, deutsche Literaturgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Nils Demetry (Autor:in), 2008, Weimarer Klassik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/145124