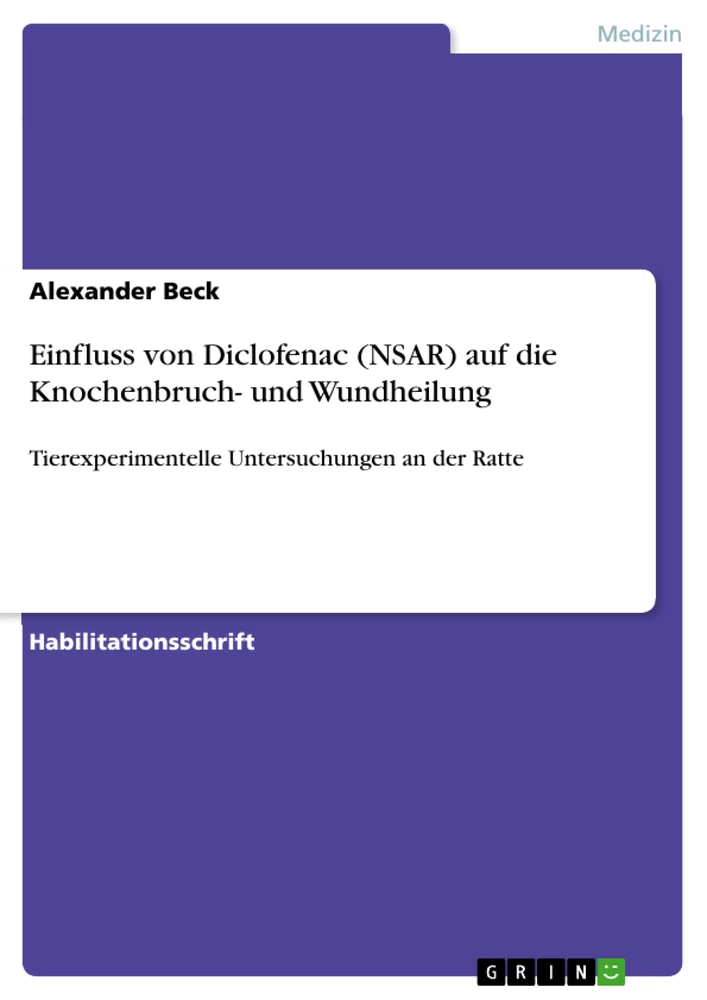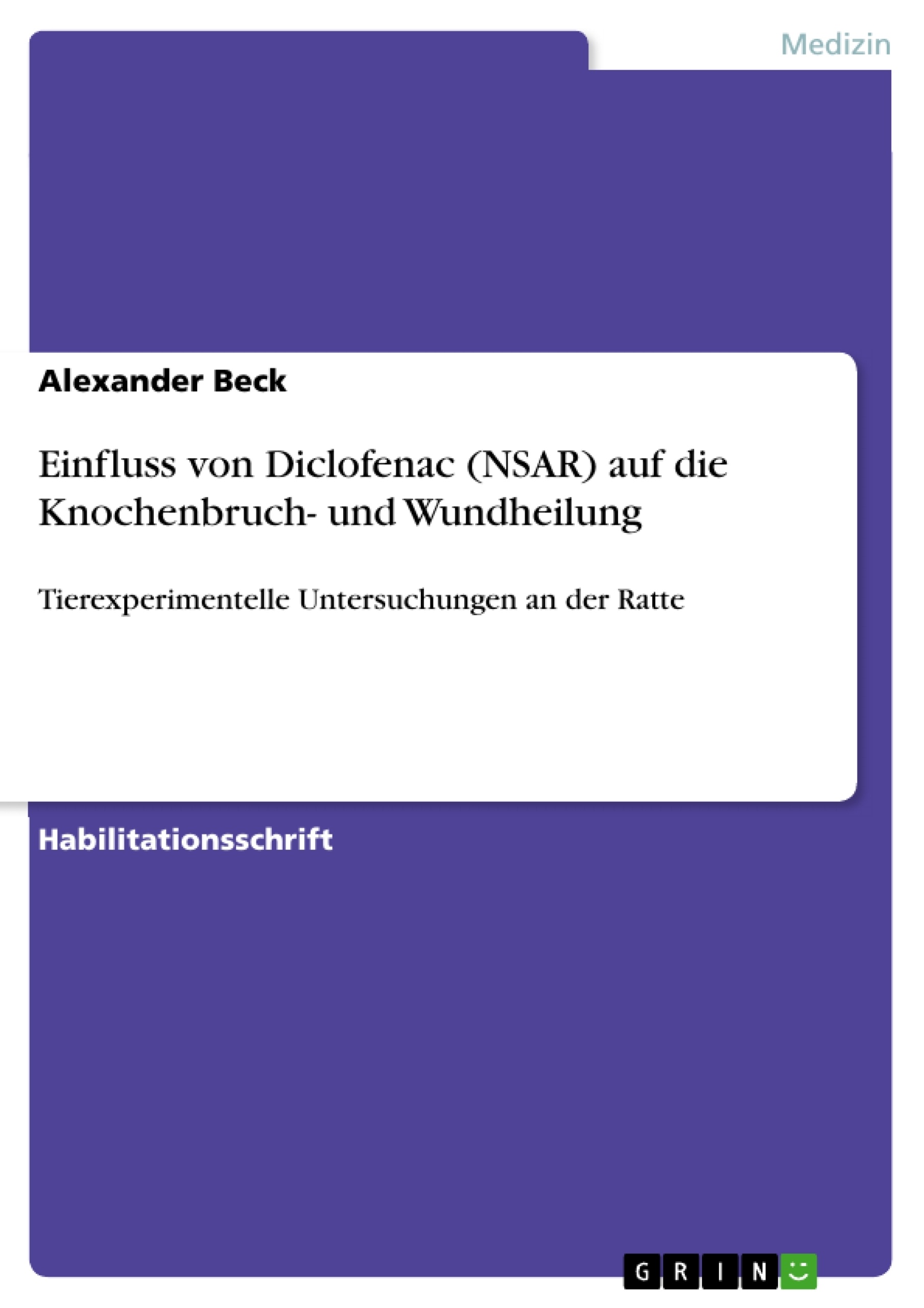Nichtsteroidale Antiphlogistika haben einen mehr oder weniger hemmenden bzw. verzögernden Einfluss auf die Knochenbruchheilung. Auch wenn dies bisher nur im Tierversuch eindeutig nachweisbar war: Alle vorliegenden Ergebnisse sowie die bisher gefundenen Wirkmechanismen lassen keine andere Schlussfolgerung zu als die – zumindest bedingte – Übertragbarkeit dieser Erkenntnisse auf den menschlichen Organismus.
Entwickelt wurde ein praktikables Frakturheilungsmodell an der Rattentibia, was sich - je nachdem ob zusätzlich eine Fibulafraktur gesetzt wird oder nicht - als stabiles oder instabiles Modell anwenden lässt und auch beide Modelle untereinander vergleichbar sind.
Bei der oralen Medikamentenapplikation konnte gezeigt werden, dass diese in der Zubereitungsform von Geleekügelchen von den Ratten problemlos aufgenommen wurde. Hilfsmittel wie Magensonden o.ä. waren hier nicht erforderlich.
In dieser Untersuchung konnte die Hemmung der Knochenbruchheilung unter Einnahme von Diclofenac mittels biomechanischer Testung eindeutig nachgewiesen werden. Diese Ergebnisse konnten bestätigt werden durch die radiologische Knochendichtemessung sowie die histologische Auszählung neu gebildeter Osteoblasten in der Spongiosa. Wenn auch diese Ergebnisse nicht in allen Punkten histologisch verifiziert werden konnten, so dürfte dies lediglich an der Anzahl der operierten Tiere liegen, da die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen in Relation zur Gruppengröße zu gering waren. Eine zeitliche Einordnung ist histologisch insofern möglich, als sich die Tiere der Placebogruppe in einem fortgeschritteneren Stadium der Heilung befanden verglichen zu den Tieren der Diclofenacgruppe. Somit kann man eindeutig von einer Verzögerung der Knochenbruchheilung sprechen.
Auch die Wundheilung wurde durch Diclofenac verändert. Die Einwanderung von Fibroblasten zur Stabilisierung der Narbe wurde deutlich negativ beeinflusst, so dass davon auszugehen ist, dass die Narbe durch Diclofenacapplikation in ihrer Stabilität geschwächt wurde. Die Migration der Epithelzellen und damit die oberflächliche Heilung der Wunde waren durch Diclofenac weitgehend unbeeinflusst.
Trotz der Hemmung von Fraktur- und Wundheilung ist neben der analgetischen Potenz gerade der antiphlogistische Effekt ein großer Vorteil bei der Applikation von Medikamenten aus der Gruppe der NSA. Insbesondere in der Behandlung des traumatischen und postoperativen Wundödems ist ja gerade dieser Effekt fast immer erwünscht.
Inhaltsverzeichnis
- ABKÜRZUNGEN
- 1. EINLEITUNG
- 1.1. NICHTSTEROIDALE ANTIPHLOGISTIKA
- 1.2. OPIOIDANALGETIKA
- 1.3. FRAKTUR UND FRAKTURHEILUNG
- 1.4. HAUT UND WUNDHEILUNG
- 2. ARBEITSHYPOTHESE
- 3. MATERIAL UND METHODEN
- 3.1. VERSUCHSREIHE A
- 3.2. VERSUCHSREIHE B
- 4. MEDIKAMENTÖSE THERAPIE
- 5. AUSWERTUNG
- 5.1. VERSUCHSREIHE A
- 5.2. VERSUCHSREIHE B
- 6. STATISTIK
- 7. ERGEBNISSE
- 7.1. VERSUCHSREIHE A
- 7.2. VERSUCHSREIHE B
- 8. DISKUSSION
- 9. ZUSAMMENFASSUNG
- 10. SCHLUSSFOLGERUNG
- 11. DANKSAGUNG
- 12. LITERATUR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss von Diclofenac auf die Knochenbruch- und Wundheilung bei Ratten. Ziel ist es, die Auswirkungen dieses nichtsteroidalen Antirheumatikums auf den Heilungsprozess experimentell zu belegen und zu analysieren.
- Wirkung von Diclofenac auf die Knochenheilung
- Einfluss von Diclofenac auf die Wundheilung
- Vergleich der Heilungsprozesse unter Diclofenac- und Placebo-Therapie
- Statistische Auswertung der Ergebnisse
- Diskussion der Ergebnisse im Kontext bestehender Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der nichtsteroidalen Antiphlogistika (NSAID) ein, beleuchtet deren Einsatzgebiete in der Chirurgie und Orthopädie, insbesondere in der Schmerz- und Entzündungstherapie nach Frakturen. Es wird auf die analgetische und antiinflammatorische Wirkung eingegangen und die Vorteile gegenüber Opioiden hervorgehoben. Die unerwünschten Wirkungen von NSAID, wie gastrointestinale Ulzera und Beeinträchtigung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems, werden ebenfalls diskutiert. Der Abschnitt legt den Grundstein für die Untersuchung des Einflusses von Diclofenac auf die Knochenbruch- und Wundheilung.
3. Material und Methoden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der tierexperimentellen Untersuchung. Es werden zwei Versuchsreihen (A und B) vorgestellt, die sich in der Art der Fraktur (Bohrloch am distalen Femur vs. Tibiaosteotomie) und der Behandlungsdauer unterscheiden. Es wird präzise auf die verwendeten Tiermodelle, die Induktion der Frakturen, die Applikation von Diclofenac (bzw. Placebo) sowie die eingesetzten Messmethoden eingegangen, um die Reproduzierbarkeit und Validität der Studie zu gewährleisten. Die unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Versuchsreihen und die dazugehörigen Behandlungsprotokolle werden klar definiert.
7. Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der beiden Versuchsreihen detailliert dargestellt und mittels statistischer Methoden ausgewertet. Die Ergebnisse beziehen sich auf die Knochenheilung und die Wundheilung in den verschiedenen Behandlungsgruppen. Es wird ein Vergleich zwischen den Diclofenac- und Placebo-Gruppen vorgenommen, um die Effekte der Medikation auf die Heilungsprozesse zu quantifizieren. Die Ergebnisse sind präzise beschrieben und werden durch Tabellen und Grafiken veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Diclofenac, Knochenbruchheilung, Wundheilung, NSAID, Tierexperiment, Ratte, Osteotomie, Frakturheilung, Entzündungshemmung, Analgesie, Placebo, Statistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Einfluss von Diclofenac auf die Knochenbruch- und Wundheilung bei Ratten
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des nichtsteroidalen Antirheumatikums (NSAID) Diclofenac auf die Knochenbruch- und Wundheilung bei Ratten. Ziel ist die experimentelle Untersuchung und Analyse der Auswirkungen von Diclofenac auf den Heilungsprozess.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Wirkung von Diclofenac auf die Knochenheilung, den Einfluss auf die Wundheilung, einen Vergleich der Heilungsprozesse unter Diclofenac- und Placebo-Therapie, die statistische Auswertung der Ergebnisse und die Diskussion der Ergebnisse im Kontext bestehender Literatur.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie basiert auf zwei tierexperimentellen Versuchsreihen (A und B) mit unterschiedlichen Frakturtypen (Bohrloch am distalen Femur vs. Tibiaosteotomie) und Behandlungsdauern. Detailliert beschrieben werden die Tiermodelle, die Frakturinduktion, die Applikation von Diclofenac (bzw. Placebo) und die Messmethoden. Die verschiedenen Gruppen und Behandlungsprotokolle sind klar definiert.
Wie sind die Ergebnisse strukturiert?
Die Ergebnisse beider Versuchsreihen werden detailliert dargestellt und statistisch ausgewertet. Sie beziehen sich auf die Knochen- und Wundheilung in den verschiedenen Behandlungsgruppen und vergleichen die Diclofenac- mit den Placebo-Gruppen, um die Effekte der Medikation zu quantifizieren. Tabellen und Grafiken veranschaulichen die Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Diclofenac, Knochenbruchheilung, Wundheilung, NSAID, Tierexperiment, Ratte, Osteotomie, Frakturheilung, Entzündungshemmung, Analgesie, Placebo, Statistik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung mit Ausführungen zu NSAIDs, Opioiden, Frakturen und Wundheilung; eine Arbeitshypothese; ein Kapitel zu Material und Methoden; ein Kapitel zur medikamentösen Therapie; ein Kapitel zur Auswertung; ein Kapitel zur Statistik; ein Kapitel zu den Ergebnissen; eine Diskussion; eine Zusammenfassung; eine Schlussfolgerung; einen Dank; und ein Literaturverzeichnis.
Welche Einleitung bietet die Arbeit?
Die Einleitung führt in die Thematik der NSAIDs ein, beleuchtet deren Einsatzgebiete in der Chirurgie und Orthopädie, insbesondere in der Schmerz- und Entzündungstherapie nach Frakturen. Sie beschreibt die analgetische und antiinflammatorische Wirkung, hebt Vorteile gegenüber Opioiden hervor und diskutiert unerwünschte Wirkungen von NSAIDs. Sie legt den Grundstein für die Untersuchung des Einflusses von Diclofenac.
Wie werden die Ergebnisse diskutiert?
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert detailliert die Ergebnisse beider Versuchsreihen (mit statistischer Auswertung), die sich auf Knochen- und Wundheilung beziehen. Der Vergleich zwischen Diclofenac- und Placebo-Gruppen quantifiziert die Medikationseffekte. Die "Diskussion" setzt die Ergebnisse in den Kontext bestehender Literatur.
- Quote paper
- Alexander Beck (Author), 2002, Einfluss von Diclofenac (NSAR) auf die Knochenbruch- und Wundheilung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144926