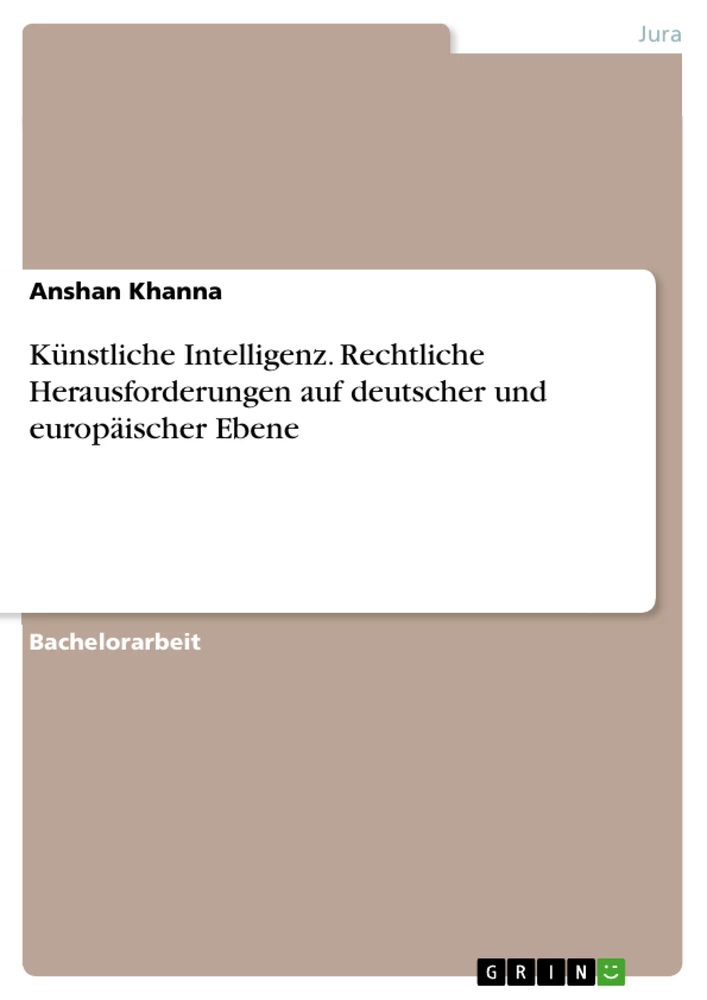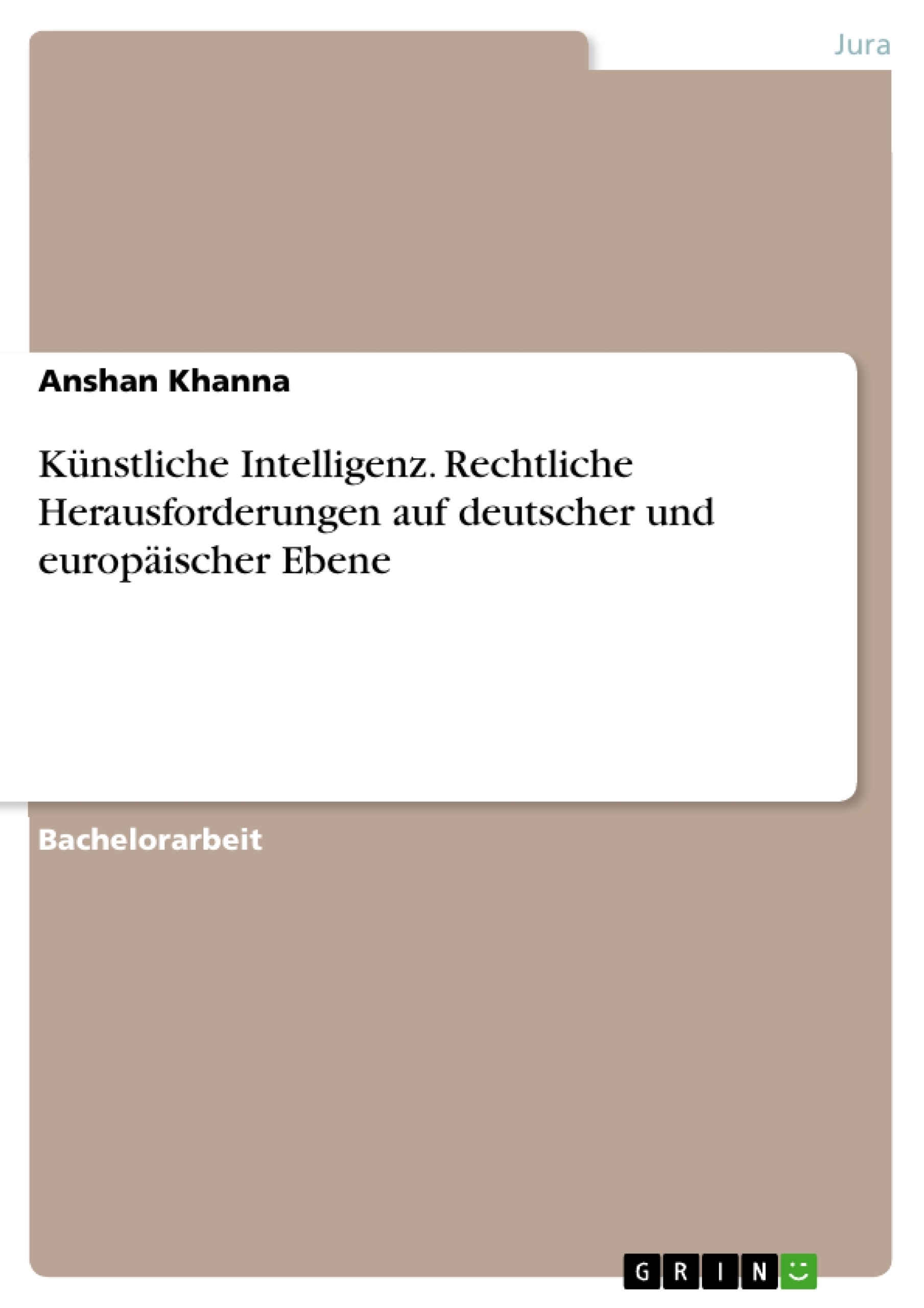Künstliche Intelligenz (KI) ist längst im Leben der Menschen angekommen. Neben ihren Vorteilen zeichnet sich KI allerdings auch durch Eigenschaften, wie Komplexität, Autonomie, und Unvorhersehbarkeit aus. Damit stellt sich die Frage, ob KI-Lebenssachverhalte auch vom geltenden Recht abgedeckt sind. Der folgende Beitrag befasst sich mit grundlegenden Fragen, wie zum Beispiel können Verträge mit KI-Systemen geschlossen werden und kann das Deliktsrecht bei Schäden durch KI herangezogen werden. Das Ergebnis: es kommt drauf an. Je komplexer und autonomer das KI-System ist, desto mehr gelangt das jetzige Recht an seine Grenzen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. KI und Recht
- II. Ziel und Struktur der Arbeit
- B. Künstliche Intelligenz
- I. Software
- II. Entwicklung der Software durch Techniken und Konzepte
- 1. Maschinelles Lernen („Machine Learning“)
- 2. Tiefes Lernen („Deep Learning“)
- III. Hervorbringen von Ergebnissen und Einflussnahme auf die Umwelt
- 1. Starke und schwache KI-Systeme
- 2. Superintelligenz
- IV. Vom Menschen festgelegte Ziele
- C. Vertragsrechtliche Herausforderungen beim Einsatz Künstlicher Intelligenz
- I. KI im Vertragsrecht
- II. Herausforderung im Vertragsschluss
- 1. Instrumente der Rechtsgeschäftslehre de lege lata
- a) Eigene Willenserklärung des KI-Systems
- b) Zurechnung der Willenserklärung an den KI-Nutzer
- aa) Einordnung als Computererklärung
- bb) Anwendung des Konstrukts der Botenschaft
- cc) Anwendung des Stellvertretungsrechts, §§ 164 ff. BGB
- (1) Eigene Willenserklärung des Stellvertreters
- (2) Zwischenergebnis
- dd) Analoge Anwendung des Stellvertretungsrechts
- (1) Planwidrige Regelungslücke
- (2) Vergleichbare Interessenslage
- ee) Einordnung als Blanketterklärung
- 2. Instrumente der Rechtsgeschäftslehre de lege ferenda
- a) Die e-Person
- b) Teilrechtsfähige KI-Systeme
- 1. Instrumente der Rechtsgeschäftslehre de lege lata
- D. Haftungsrechtliche Herausforderungen beim Einsatz Künstlicher Intelligenz
- I. KI im Haftungsrecht
- II. Deliktische Haftung de lege lata
- 1. Menschliches Verhalten
- a) Aktives Tun
- b) Pflichtwidriges Unterlassen
- aa) Verkehrssicherungspflichten der Haftungsadressaten
- bb) Sorgfaltsmaßstab
- c) Zwischenfazit zu 1
- 2. Kausalität
- a) Kausalität nach der Äquivalenztheorie
- b) Kausalität nach der Adäquanztheorie
- c) Schutzzweck der Norm
- d) Grundsätze der Fallgruppe der „Herausforderungsfälle“
- e) Sonderproblem: Vernetzung
- f) Zwischenfazit zu 2
- 3. Verschulden
- 4. Darlegungs- und Beweislast
- a) Grundsatz
- b) Sonderfall: Produzentenhaftung
- 1. Menschliches Verhalten
- III. Produkthaftung de lege lata
- 1. Anwendungsbereich des ProdHaftG
- a) Produkt i.S.d. § 2 ProdHaftG
- b) Fehler i.S.d. § 3 ProdHaftG
- 2. Ausschluss der Produkthaftung
- a) Ausschluss nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 ProdHaftG
- b) Ausschluss nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdHaftG
- 1. Anwendungsbereich des ProdHaftG
- IV. Haftung de lege ferenda
- E. Regulierungsrechtliche Herausforderungen beim Einsatz Künstlicher Intelligenz
- I. Regulierungsrecht für KI
- F. Fazit
- I. Gesamtbewertung
- 1. Die e-Person
- 2. Gefährdungshaftung
- II. Ausblick
- I. Gesamtbewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den rechtlichen Herausforderungen, die sich aus dem Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) im Vertrags- und Haftungsrecht ergeben. Sie analysiert die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen und diskutiert mögliche zukünftige Entwicklungen.
- Die rechtliche Einordnung von KI-Systemen im Vertragsrecht, insbesondere die Frage der Willenserklärung und der Zurechnung.
- Die Haftungsrechtlichen Folgen von Schäden, die durch KI-Systeme verursacht werden, mit Fokus auf die deliktische und die Produkthaftung.
- Die Regulierung von KI-Systemen und die Notwendigkeit einer Anpassung des Rechts an die technischen Entwicklungen.
- Die Diskussion möglicher zukünftiger Rechtsfiguren, wie der "e-Person", um die Besonderheiten von KI-Systemen im Recht zu erfassen.
- Die ethischen und gesellschaftlichen Implikationen des Einsatzes von KI-Systemen.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel A befasst sich mit der Einleitung und stellt das Thema der Arbeit vor. Kapitel B führt in die Thematik der Künstlichen Intelligenz ein und erläutert die wichtigsten Konzepte und Techniken. Kapitel C analysiert die vertraglichen Herausforderungen des Einsatzes von KI-Systemen und untersucht die verschiedenen Möglichkeiten der rechtlichen Einordnung von KI-Systemen im Vertragsrecht. Kapitel D beleuchtet die haftungsrechtlichen Implikationen des Einsatzes von KI-Systemen, indem es die deliktische und die Produkthaftung im Kontext von KI-Systemen betrachtet. Kapitel E behandelt die Regulierungsrechtlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI-Systemen und diskutiert die Notwendigkeit einer Anpassung des Rechts an die technischen Entwicklungen. Abschließend präsentiert Kapitel F eine Gesamtbewertung der Arbeit und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Künstliche Intelligenz, KI-Systeme, Vertragsrecht, Haftungsrecht, Produkthaftung, Regulierung, e-Person, Deliktshaftung, Maschinelles Lernen, Deep Learning, Rechtliche Herausforderungen, zukünftige Entwicklungen.
- Quote paper
- Anshan Khanna (Author), 2022, Künstliche Intelligenz. Rechtliche Herausforderungen auf deutscher und europäischer Ebene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1449096