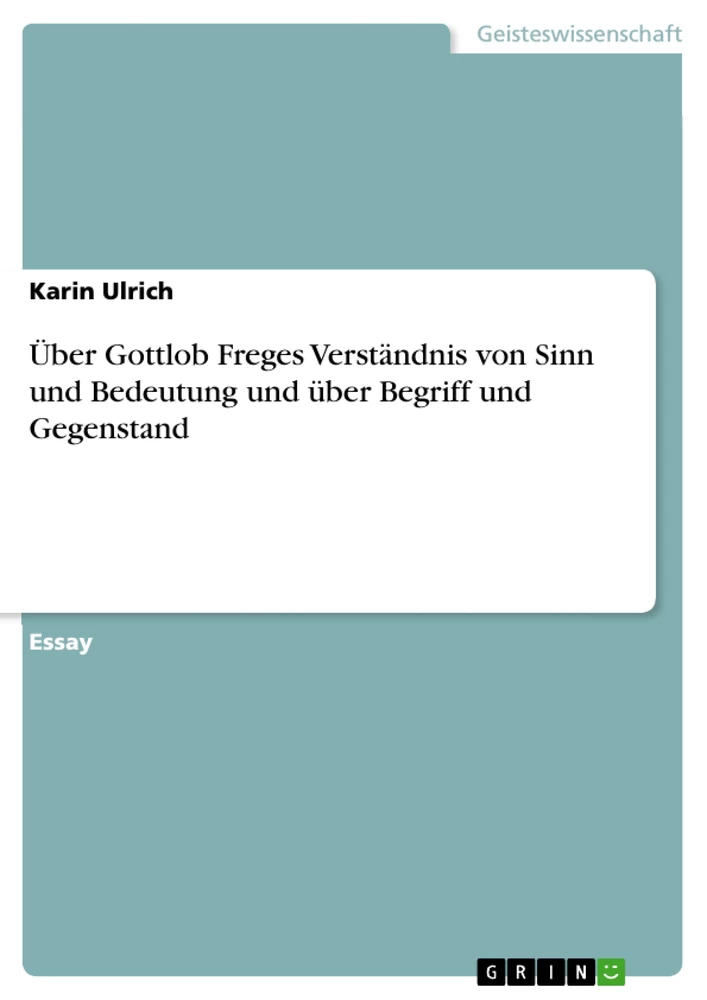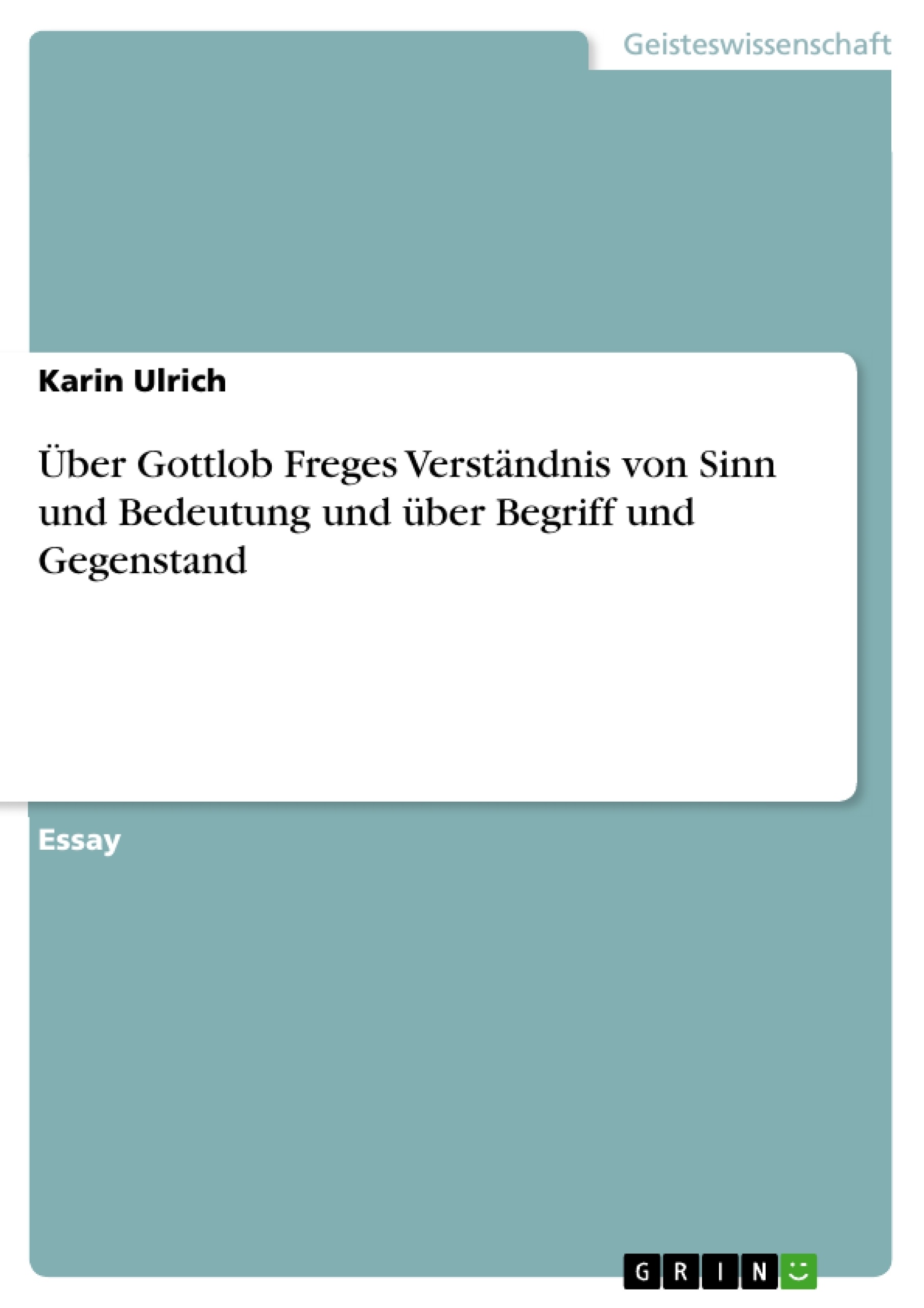Mit dem Begriff des „Linguistic Turn“ wird ein wissenschaftlicher Paradigmenwechsel bezeichnet, der im 20. Jahrhundert eine exponierte Bedeutung für die Geistes- und Sozi-alwissenschaften hatte. Der Begriff entstammt dem Titel einer berühmten Anthologie von Richard Rorty mit dem Titel „The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method“ aus dem Jahre 1967. In gewisser Weise stellt diese „Wende zur Sprache“ eine Radikalisierung der Kant´schen Fragestellung nach den Bedingungen der Möglichkeiten von Erkenntnis dar, die sich auf die Vorstellung stützt, dass Sprache wirklichkeitstragend und wirklichkeitsstiftend wirkt. „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“, so Ludwig Wittgenstein. Damit drückt er aus, dass das, was sprachlich nicht repräsentiert werden kann, der Erkenntnis und auch der Wahrnehmung verschlossen bleibt. Im umge-kehrten Fall formt die Sprache unser Denken so, dass eine Reduktion der Komplexität durch sprachliche Muster stattfindet. Im Gegenzug dazu, stützt sich das linguistische Pa-radigma auf die Überzeugung, dass sich alle Erfahrung nur sprachlich vermitteln lässt.
Die Anfänge der Sprachphilosophie entwickelten sich bereits im 18. Jahrhundert durch Wilhelm von Humboldt und Johann Gottfried Herder. Gottlob Frege, Ludwig Wittgenstein und Bertrand Russell prägten dann, daran anknüpfend, die „Analytische Philosophie“ An-fang des 20. Jahrhunderts und versuchten dabei, Sprache systematisch zu analysieren. In diesem Zusammenhang bildeten sich zwei Richtungen der analytischen Sprachphilosophie heraus: Die „Philosophie der Idealsprache“, u.a. vertreten durch Frege und Russell und die „Philosophie der Normalsprache“ mit G.E. Moore als ein Begründer (auf diesen Zweig werde ich hier nicht weiter eingehen). Frege und Russell folgten der Idee aus der sog. „Normalsprache“, mittels logischer Analyse, eine „Idealsprache“ zu entwickeln, die all das ausdrücken kann, was die Normalsprache ausdrückt, aber präzise und logisch eindeutig und immer mit der Orientierung an Logik und Standards.
Gottlob Frege (1848-1925), Mathematiker und Logiker, gilt, wie bereits erwähnt, als einer der Begründer der modernen Logik und versuchte diese als eine eigene Disziplin zwischen der Mathematik und der Philosophie zu etablieren. 1892 erscheint sein Aufsatz „Über Sinn und Bedeutung“, welcher im Rahmen der Seminarsitzung vom 27.04., zumindest in einer ersten Diskussion, zum Gegenstand gemacht wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Über Sinn und Bedeutung
- Teil I
- Teil II
- 2. Über Begriff und Gegenstand
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die schriftliche Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Analyse von Gottlob Freges Werken „Über Sinn und Bedeutung" (Teil I und II) und „Über Begriff und Gegenstand". Der Fokus liegt darauf, die zentralen Konzepte von Freges Sprachphilosophie zu verstehen und zu interpretieren. Dabei werden insbesondere die Unterscheidung von Sinn und Bedeutung von Begriffen und Sätzen, die Bedeutung von Identitätssätzen und die Rolle des „Gedankens“ als objektiver Inhalt von Sätzen beleuchtet.
- Die Unterscheidung von Sinn und Bedeutung in Freges Sprachphilosophie
- Die Analyse von Identitätssätzen und deren Erkenntniswert
- Der "Gedanken" als objektiver Inhalt von Sätzen
- Die Rolle der Sprache als Mittel der Erkenntnis
- Die Bedeutung von Freges Philosophie für die analytische Sprachphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit behandelt Freges Aufsatz „Über Sinn und Bedeutung“. Zunächst werden die Begriffe „Identitätssätze“ und „Identitätsaussagen“ erläutert, wobei die Unterscheidung zwischen Sätzen der Form „a = a“ und „a = b“ im Vordergrund steht. Es wird gezeigt, dass ersterer Satz zwar immer wahr ist, jedoch keinen Erkenntniswert besitzt, während letzterer Satz einen Erkenntniswert hat und durch Erfahrung überprüfbar ist. Anschließend wird die Frage nach Sinn und Bedeutung von Begriffen und Sätzen behandelt. Freges Unterscheidung von Sinn und Bedeutung wird anhand von Beispielen verdeutlicht, wobei der Sinn als „Weise des Gegebenseins“ eines Ausdrucks definiert wird.
Im Kontext der Seminardiskussion werden die Attribute „Objektivität“ und „Subjektivität“ in Bezug auf Sinn und Bedeutung diskutiert. Es wird gezeigt, dass die Bedeutung eines Eigennamens der Gegenstand selbst ist, während der Sinn, also die „Weise des Gegebenseins“, subjektiven Charakter haben kann, jedoch nicht mit subjektiver Vorstellung gleichgesetzt werden darf.
Die Arbeit behandelt auch Freges Ansicht über den „Gedanken“ als objektiven Inhalt von Sätzen. Es wird erläutert, dass der Gedanke unabhängig von individuellen Empfindungen und Ansichten ist und somit objektiven Charakter besitzt. Diese Interpretation wird im Zusammenhang mit der Frage diskutiert, ob Beleidigungen einen Wahrheitswert haben können.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Konzepten der Sprachphilosophie Gottlob Freges, insbesondere mit den Begriffen Sinn und Bedeutung, Identitätssätzen, dem „Gedanken“ als objektivem Inhalt von Sätzen, sowie der Rolle der Sprache als Mittel der Erkenntnis. Weitere wichtige Themen sind die Unterscheidung von analytischen und synthetischen Sätzen, die Referenztheorie und die Frage nach Objektivität und Subjektivität in der Sprache. Die Arbeit beleuchtet Freges Einfluss auf die Entwicklung der analytischen Sprachphilosophie und die Bedeutung seiner Ansätze für die moderne Sprachphilosophie.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtschaftsing. Karin Ulrich (Author), 2009, Über Gottlob Freges Verständnis von Sinn und Bedeutung und über Begriff und Gegenstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144343