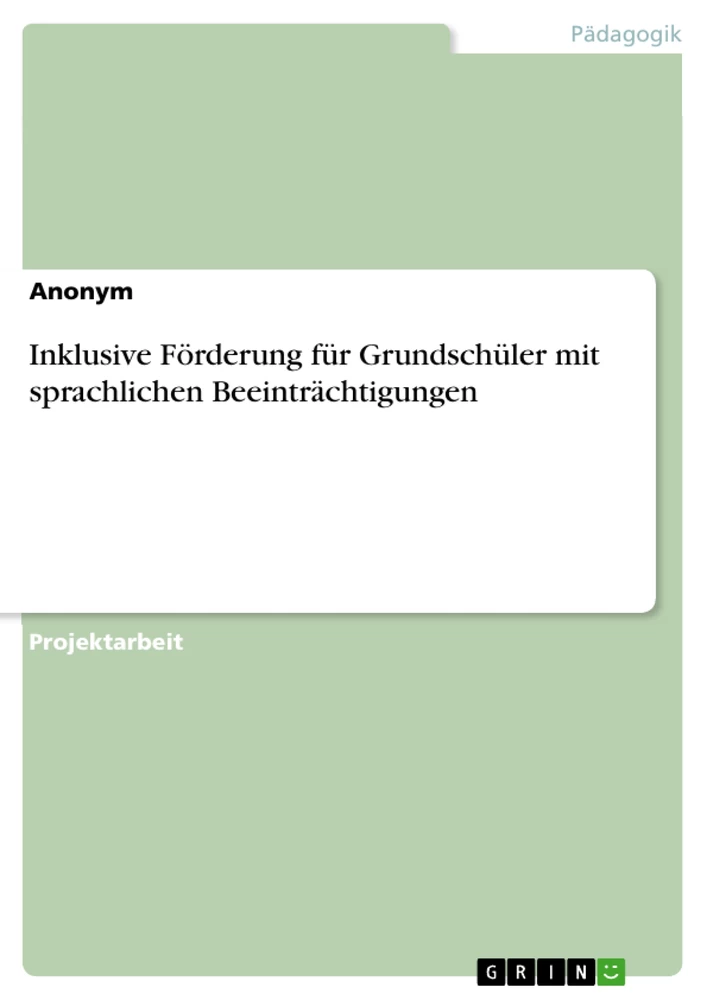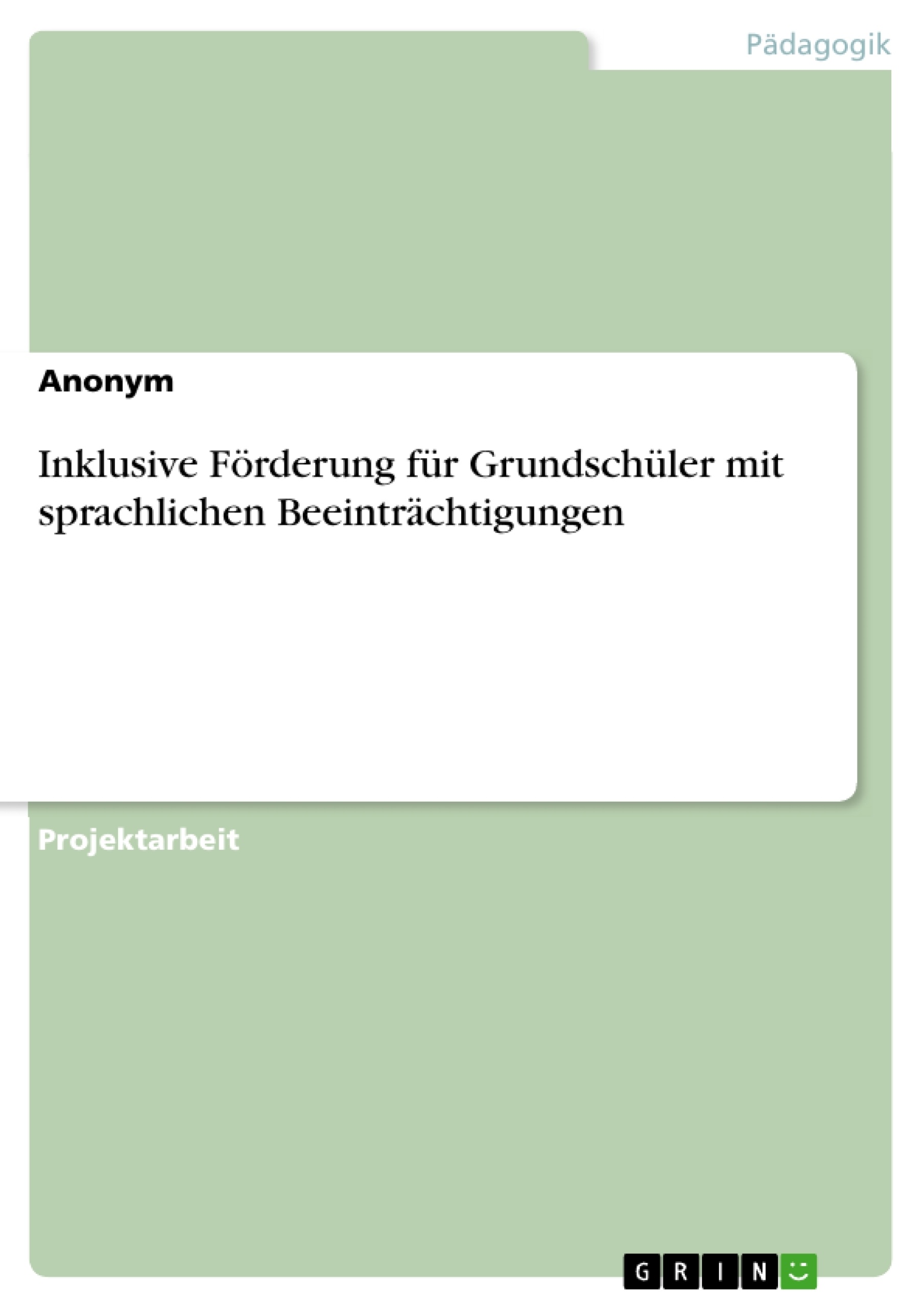Diese Arbeit beschäftigt sich mit der inklusiven Förderung von Grundschülern. Die zentrale Fragestellung lautet: „Mit welchen Strategien kann man Grundschüler, die sprachliche Beeinträchtigungen aufweisen, unterstützen?“ Als theoretische Grundlage dient die inklusive Pädagogik, die allen Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihren Auffälligkeiten, die Möglichkeit zum gemeinsamen Lernen an allgemeinbildenden Schulen einräumen soll, anstatt sie an Förderschulen zu unterrichten oder sie im Unterricht zu selektieren. Im Dezember 2006 verabschiedete die UNO Generalversammlung das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (UN-Behindertenrechtskonvention, UN-BRK). Grund für die Entstehung war die Auffassung, dass Menschen mit Behinderungen weltweit nicht genügend Schutz vor Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren haben und immer noch davon betroffen sind. In Bezug auf Grundschüler bedeutet dies, dass Kindern mit einer Behinderung der Zugang zu allgemeinbildenden Schulen nicht verwehrt werden darf und sie gleichberechtigt am sogenannten inklusiven Unterricht teilhaben können und individuell gefördert werden. Im Projektteil wird exemplarisch veranschaulicht, wie zwei Grundschulkinder der ersten Klasse mit sprachlichen Beeinträchtigungen im phonologischen Bereich (Aussprachstörungen) mit der ganzen Klasse oder auch in der individuellen Einzelarbeit an einer Regelschule integrativ gefördert werden können. Anhand eines Trainingsprogramms zur Förderung des phonologischen Bewusstseins „Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi“ von Maria Förster werden spezielle Übungen und Spiele angeboten, die sich nachweislich positiv und erfolgreich auf den Schriftspracherwerb der Kinder auswirken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Inklusion und Inklusive Pädagogik
- 2.2 Chancen inklusiver Pädagogik
- 2.3 Sprachliche Beeinträchtigungen vs. Behinderungen
- 3. Hauptteil: Das Projekt
- 3.1 Ausgangssituation
- 3.2 Zielerreichung
- 3.3 Projektdurchführung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit untersucht, mit welchen Strategien Grundschüler mit sprachlichen Beeinträchtigungen unterstützt werden können. Sie betrachtet die inklusive Pädagogik als theoretische Grundlage und beleuchtet die Chancen und Herausforderungen, die sie für Kinder mit sprachlichen Beeinträchtigungen bietet.
- Inklusive Pädagogik und ihre Bedeutung für die Bildung aller Kinder
- Die Herausforderungen und Chancen der Integration von Kindern mit sprachlichen Beeinträchtigungen in den gemeinsamen Unterricht
- Die Rolle der individuellen Förderung und gezielter Unterstützung in der Inklusion
- Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und anderen Fachdisziplinen, wie z.B. Logopäden
- Die positive Auswirkung von Trainingsprogrammen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der sprachlichen Beeinträchtigungen bei Grundschülern ein und stellt die Fragestellung der Projektarbeit vor. Sie beleuchtet die Bedeutung der inklusiven Pädagogik und die Relevanz der UN-Behindertenrechtskonvention. Das Kapitel "Theoretische Grundlagen" definiert den Begriff der Inklusion und erläutert die Chancen und Herausforderungen der inklusiven Pädagogik. Es behandelt die Unterschiede zwischen Behinderungen und Beeinträchtigungen und zeigt die spezifischen Schwierigkeiten auf, die sprachliche Beeinträchtigungen im Schulalltag mit sich bringen.
Schlüsselwörter
Inklusion, inklusive Pädagogik, sprachliche Beeinträchtigungen, phonologische Bewusstheit, Dyslalie, Förderung, Integration, gemeinsamer Unterricht, UN-Behindertenrechtskonvention, Trainingsprogramme, Sprachproduktion, Sprachverarbeitung, Grundschüler.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2022, Inklusive Förderung für Grundschüler mit sprachlichen Beeinträchtigungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1440771