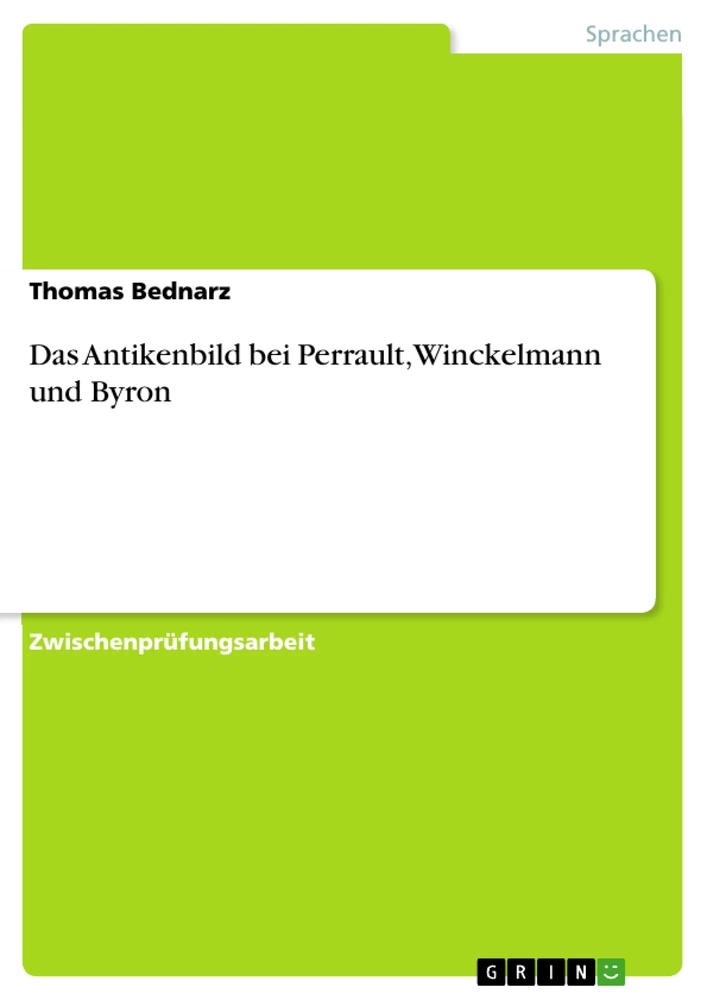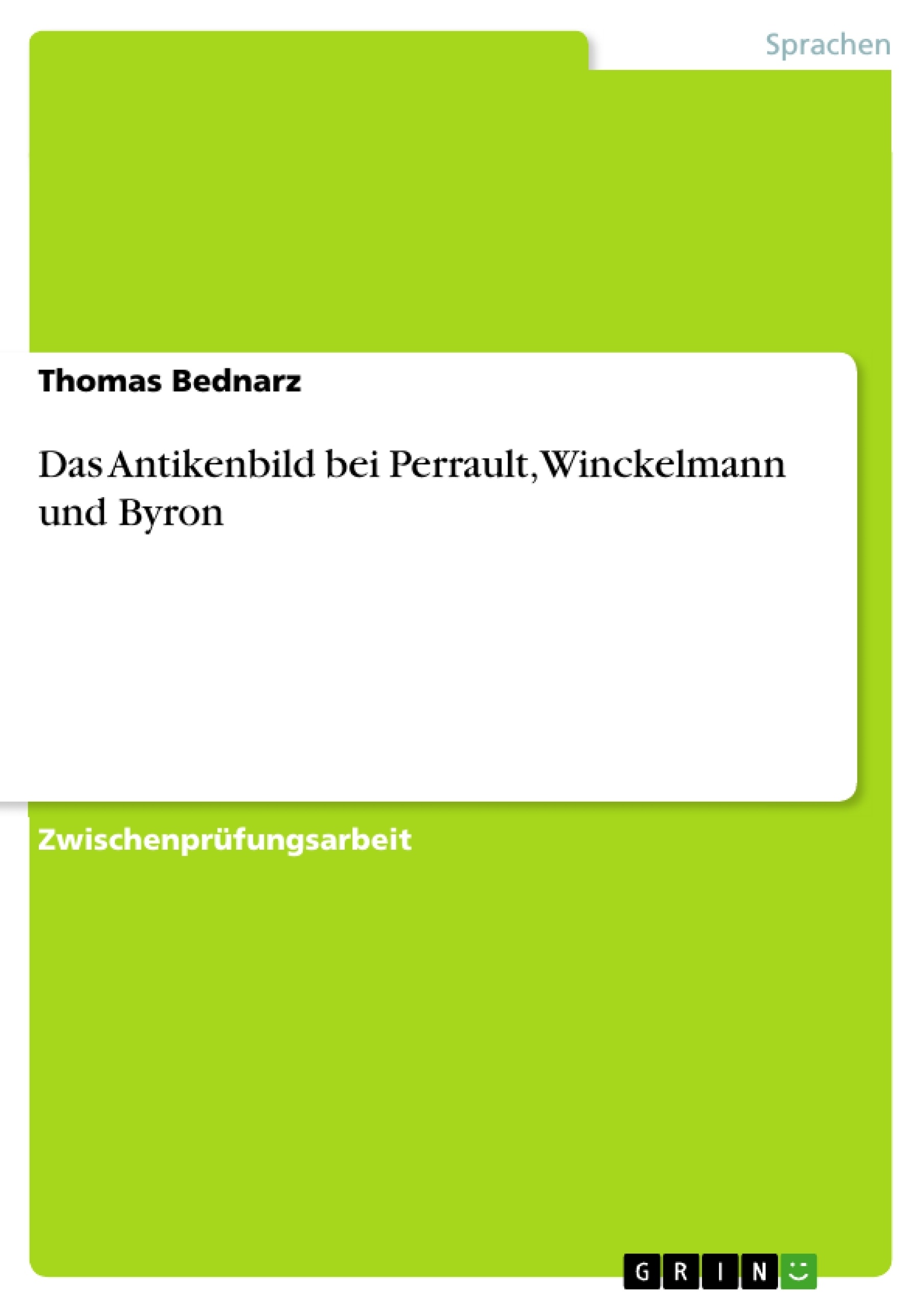Mit der Renaissance, der "Wiedergeburt der Menschheit durch Wiedergeburt des Menschen der Antike,"1 endet das christliche Mittelalter, das seine Existenz der Abwendung von der heidnischen Antike verdankte, und beginnt die sogenannte Neuzeit. Spätestens seit der Einführung einer "quantitativ orientierten" Naturbetrachtung durch Kepler und Galilei wurde jedoch deutlich, daß die antike Naturwissenschaft, die "die Natur aus qualitativ verschiedenen Kräften zu erklären"2 versuchte, für die moderne als Vorbild nicht geeignet war. Unklar blieb, ob dasselbe für die Kunst galt; in der Querelle des Anciens et des Modernes kam es darüber zu einer Auseinandersetzung zwischen Fürsprechern der antiken Kunst, die diese als vollkommen und somit als Vorbild für die moderne Kunst ansahen, den Anciens, und Verfechtern der Fortschrittsidee, den Modernes.
Ihren Höhepunkt fand die Querelle in Perraults Vortrag seines Le Siècle de Louis le Grand während einer Sitzung der Académie française, der Boileau-Despréaux als Vertreter der Anciens dazu veranlasste, entrüstet den Saal zu verlassen. In dieser Huldigungsadresse verwirft Perrault entschieden die Vorstellung einer Vorbildlichkeit der Antike und setzt ihr eine Fortschrittstheorie entgegen, die Kunst und Wissenschaft gleichermaßen umfaßt. Nach einem Ausgleich mit Boileau relativiert Perrault allerdings seine Ansichten am Schluß des vierten und letzten Bandes seiner Parallèle des Anciens et des Modernes, indem er einräumt, daß die Modernen den Alten in Rede- und Dichtkunst weniger weit überlegen seien als in den übrigen Bereichen. Ergebnisse der Querelle waren schließlich die "[h]istorische Betrachtung der Antike, Distanznahme zur eigenen Modernität und die Einsicht in die absolute Verschiedenartigkeit alter und neuer Kunst"3 und somit auch die endgültige Trennung von Kunst und Wissenschaft.
Für Winckelmann steht diese Trennung von vornherein außer Frage; er sieht Kunst zunächst generell als Nachahmung der schönen Natur. Wie in seinen Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst ersichtlich wird, geht er jedoch davon aus, daß in der Antike, besonders im antiken Griechenland, weitaus mehr Möglichkeiten zur Nachbildung der Schönheiten der Natur bestanden als zu seiner Zeit, weswegen er die Nachahmung antiker Kunstwerke modernen Künstlern als effektivere Alternative empfiehlt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Perraults Fortschrittstheorie
- 1. Perraults Antikenbild in Le Siècle de Louis le Grand
- 1.1 Zusammenfassung
- 1.2 Kritik
- 2. Fazit
- 1. Perraults Antikenbild in Le Siècle de Louis le Grand
- II. Winckelmanns Klassizismus
- 1. Winckelmanns Antikenbild in seinen Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst
- 1.1 Zusammenfassung
- 1.2 Kritik
- 2. Fazit
- 1. Winckelmanns Antikenbild in seinen Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst
- III. Perrault und Winckelmann: Eine Gegenüberstellung
- IV. Byrons Romantik
- 1. Byrons Antikenbild in Childe Harold's Pilgrimage
- 1.1 Griechenland
- 1.2 Rom
- 2. Der griechische Freiheitskampf
- 1. Byrons Antikenbild in Childe Harold's Pilgrimage
- V. Byron im Vergleich mit Perrault und Winckelmann: Ähnliche Erkenntnisse, unterschiedliche Interpretationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Antikenbild dreier bedeutender Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Epochen: Charles Perrault, Johann Joachim Winckelmann und Lord Byron. Das Ziel ist es, die jeweiligen Antikenbilder dieser Autoren zu analysieren und miteinander zu vergleichen, um die Bedeutung der Antike in ihrem jeweiligen Kontext zu verstehen. Dabei werden die Vorbedingungen und Konsequenzen ihrer Antikenbilder beleuchtet.
- Das Antikenbild in der Renaissance und der Neuzeit
- Die Querelle des Anciens et des Modernes und die Entwicklung der Fortschrittstheorie
- Der Einfluss der Antike auf die Kunst des Klassizismus und der Romantik
- Der Vergleich der Antikenbilder Perraults, Winckelmanns und Byrons
- Die Bedeutung der Antike für die historische und ästhetische Wahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Antike im Kontext der Renaissance und der Neuzeit ein und stellt die zentrale Rolle der Querelle des Anciens et des Modernes dar. Kapitel I widmet sich Perraults Fortschrittstheorie, die sich in seinem Werk Le Siècle de Louis le Grand manifestiert. Kapitel II analysiert Winckelmanns Klassizismus und seine Ansichten zur Nachahmung antiker Kunstwerke. Kapitel III setzt die beiden Autoren in Bezug zueinander und untersucht ihre unterschiedlichen Sichtweisen auf die Antike. Kapitel IV behandelt Byrons Romantik und seine Darstellung der Antike in Childe Harold's Pilgrimage. Schließlich werden in Kapitel V die Erkenntnisse der vorherigen Kapitel zusammengefasst und die unterschiedlichen Interpretationen der Antike durch Perrault, Winckelmann und Byron verglichen. Die Arbeit bietet einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Perspektiven auf die Antike in der Literatur und Kunstgeschichte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Antikenbild, der Querelle des Anciens et des Modernes, dem Klassizismus, der Romantik, der Fortschrittstheorie, der Nachahmung, der Kunstgeschichte, der Literaturgeschichte und der historischen Wahrnehmung der Antike.
Häufig gestellte Fragen
Was war die "Querelle des Anciens et des Modernes"?
Ein Gelehrtenstreit darüber, ob die antike Kunst (Anciens) als unübertreffliches Vorbild gilt oder ob die moderne Kunst (Modernes) durch Fortschritt überlegen ist.
Welche Position vertrat Charles Perrault?
Perrault war ein Verfechter der Modernes und vertrat eine Fortschrittstheorie, die die Überlegenheit der zeitgenössischen Kunst und Wissenschaft betonte.
Wie sah Johann Joachim Winckelmann die antike Kunst?
Winckelmann sah in der griechischen Antike das Ideal von "stiller Einfalt und edler Größe" und empfahl modernen Künstlern die Nachahmung antiker Werke.
Welchen Beitrag leistete Lord Byron zum Antikenbild?
Byron vertrat eine romantische Sichtweise, die die Antike mit dem Freiheitskampf (insbesondere Griechenlands) und melancholischer Ruinenästhetik verband.
Was ist das Ziel des Vergleichs dieser drei Autoren?
Die Arbeit analysiert, wie sich die Wahrnehmung der Antike vom Barock über den Klassizismus bis zur Romantik gewandelt hat.
- Quote paper
- Thomas Bednarz (Author), 2000, Das Antikenbild bei Perrault, Winckelmann und Byron, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14399