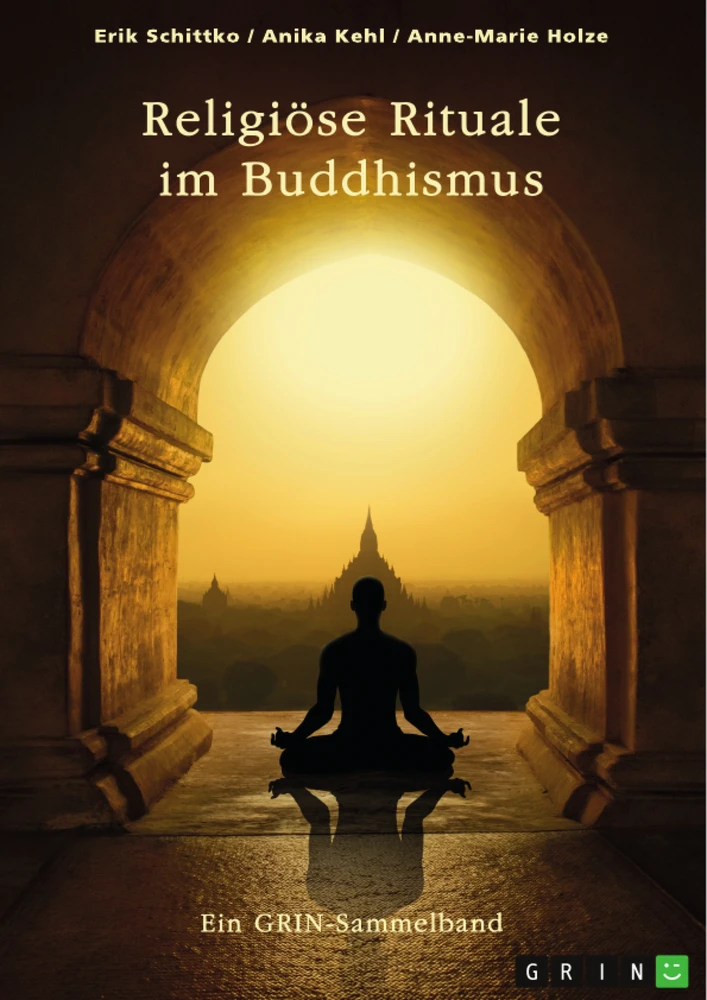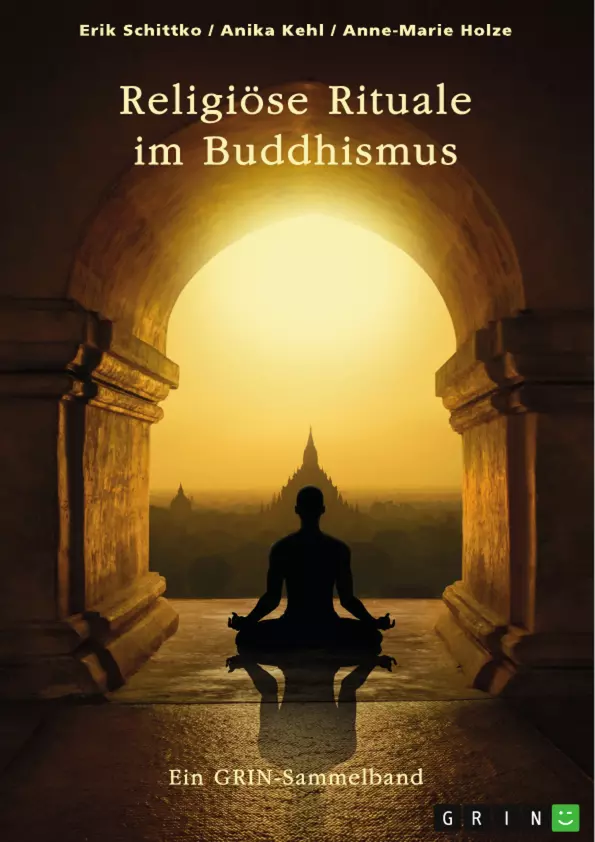Dieser Sammelband besteht aus drei Hausarbeiten.
Die erste Arbeit widmet sich der Untersuchung der Phänomenologie des Selbst im Buddhismus, insbesondere durch eine kritische Analyse der Anatta-Lehre und deren philosophischer Implikationen. Der Fokus liegt auf der Frage nach der Begründung für die Negation des Egos innerhalb buddhistischer Schulen und den ethischen Konsequenzen dieser Lehre. Des Weiteren werden Parallelen zwischen der Anatta-Lehre und dem deutschen Idealismus sowie mögliche Auswirkungen auf kollektive Prozesse in buddhistischen Gesellschaften beleuchtet.
Die zweite Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung und Bewertung des Lebens von Siddhartha Gautama, des historischen Buddha, als Thema des Religionsunterrichts. Es soll eine Zusammenstellung von Fakten und Legenden über Siddhartha Gautama präsentiert werden, gefolgt von einer religionspädagogischen Analyse, die sich auf die Aufnahme seines Lebens im Unterricht sowie die Darstellung in verschiedenen Schulbüchern fokussiert.
Die dritte Arbeit befasst sich mit der Untersuchung, wie religiöse Rituale, insbesondere das der Selbstmumifizierung im Buddhismus, Weltsichten ausdrücken können. Sie zielt darauf ab, die Rolle dieses Rituals im Kontext der buddhistischen Weltsicht zu erforschen und die Bedeutung von Ritualen als Ausdruck der Denkweise einer Religion zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Die Phänomenologie des Selbst innerhalb des Buddhismus
- Einleitung
- Die Nicht-Ich-Lehre im Kontext der Daseinsfaktoren und des Leidens
- Das Gleichnis des Wagens als Partikularisierung der Persönlichkeit
- Altruismus als ethische Konsequenz der Selbstlosigkeit
- Negation des Egos als Basis kollektivistisch-egalitärer Ideologie
- Fazit
- Das Leben des historischen Buddha als Thema des Religionsunterrichts
- Einleitung
- Der Begriff „Buddha“
- Der Buddha im Kontext seiner Zeit
- Wichtige historische Quellen für das Leben Buddhas
- Das Leben des historischen Buddha
- Empfängnis und Geburt
- Die Prophezeiung des Brahmanen
- Das Leben im Haus des Vaters
- Die vier Ausfahrten
- Auf der Suche - Leben als Asket
- Erleuchtung und Entscheidung
- Tod
- Religionspädagogischer Teil
- Analyse Buch A
- Analyse Buch B
- Vergleich von Schulbuch A und Schulbuch B
- Gliederung und Text
- Bilder
- Arbeitsaufträge und Glossar
- Umfang der Bücher und Themenvielfalt
- Das Lehrerhandbuch
- Vergleich der Darstellung des Lebens
- Zusammenfassung aus Sachteil und Religionspädagogischem Teil
- Fazit
- Wie religiöse Rituale Weltsichten ausdrücken können
- Einleitung
- Die Weltsicht einer Religion
- Die Rolle des Leidens im Buddhismus
- Rituale und Bräuche in der Religion – Kreieren einer Weltsicht
- Opferrituale
- Das Ritual der Selbstmumifizierung im Shingon-Buddhismus
- Die Aufmerksamkeit der Medienwelt
- Selbstmumifizierung & Weltsicht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des Buddhismus, fokussiert auf die Konzepte des Selbst und religiöser Rituale. Sie analysiert die buddhistische Lehre des Anatta (Nicht-Ich) und dessen philosophische Implikationen, beleuchtet das Leben des historischen Buddha im Kontext des Religionsunterrichts und untersucht, wie religiöse Rituale, insbesondere die Selbstmumifizierung, Weltsichten ausdrücken können.
- Die buddhistische Nicht-Ich-Lehre (Anatta)
- Das Leben und die Lehren des historischen Buddha
- Die Darstellung des Buddha-Lebens im Religionsunterricht
- Religiöse Rituale und ihre Bedeutung für die Weltsicht
- Selbstmumifizierung im Buddhismus als Beispiel eines religiösen Rituals
Zusammenfassung der Kapitel
Die Phänomenologie des Selbst innerhalb des Buddhismus: Dieses Kapitel befasst sich mit der buddhistischen Lehre des Anatta (Nicht-Ich) und untersucht deren philosophische Implikationen. Es analysiert die Konzepte des Selbst im Buddhismus im Vergleich zur westlichen Philosophie und untersucht die ethischen Konsequenzen der Negierung des Egos, indem es Parallelen zu Philosophen des deutschen Idealismus aufzeigt. Das Gleichnis des Wagens wird als Beispiel herangezogen, um die attributive Zusammensetzung von Objekten auf die Individuationsbeschaffenheit von Subjekten zu übertragen. Das Kapitel hinterfragt kritisch, ob die Entsagung der individuellen Wesenhaftigkeit totalitäre Kollektivierungsprozesse begünstigt hat.
Das Leben des historischen Buddha als Thema des Religionsunterrichts: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des Lebens des historischen Buddha in verschiedenen Schulbüchern des Religionsunterrichts. Es untersucht die unterschiedlichen Herangehensweisen und Schwerpunkte der Bücher, vergleicht deren Gliederung, Text, Bilder, Arbeitsaufträge und Glossare und bewertet den Umfang und die Themenvielfalt. Der Fokus liegt auf einem religionspädagogischen Vergleich, der die verschiedenen didaktischen Ansätze und ihre Eignung für den Unterricht beleuchtet.
Wie religiöse Rituale Weltsichten ausdrücken können: Dieses Kapitel untersucht, wie religiöse Rituale Weltsichten ausdrücken können, am Beispiel der Selbstmumifizierung im Shingon-Buddhismus. Es analysiert die Rolle des Leidens im Buddhismus und die Bedeutung von Ritualen und Bräuchen für die Konstruktion einer religiösen Weltsicht. Die mediale Aufmerksamkeit für die Selbstmumifizierung wird ebenso thematisiert wie die Verbindung zwischen dem Ritual und der zugrundeliegenden Weltsicht des Buddhismus.
Schlüsselwörter
Buddhismus, Anatta, Nicht-Ich, Selbst, historisches Buddha-Leben, Religionsunterricht, religiöse Rituale, Selbstmumifizierung, Weltsicht, ethische Konsequenzen, kollektivistische Ideologie, Religionspädagogik, Schulbuchvergleich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Buddhismus – Selbst, Rituale und Religionsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit verschiedenen Aspekten des Buddhismus, konzentriert sich auf die Konzepte des Selbst und religiöser Rituale. Sie analysiert die buddhistische Lehre des Anatta (Nicht-Ich) und dessen philosophische Implikationen, beleuchtet das Leben des historischen Buddha im Kontext des Religionsunterrichts und untersucht, wie religiöse Rituale, insbesondere die Selbstmumifizierung, Weltsichten ausdrücken können.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die buddhistische Nicht-Ich-Lehre (Anatta), das Leben und die Lehren des historischen Buddha, die Darstellung des Buddha-Lebens im Religionsunterricht, religiöse Rituale und ihre Bedeutung für die Weltsicht sowie die Selbstmumifizierung im Buddhismus als Beispiel eines religiösen Rituals. Es wird auch ein Vergleich verschiedener Schulbücher zum Thema Buddha im Religionsunterricht durchgeführt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: „Die Phänomenologie des Selbst innerhalb des Buddhismus“, „Das Leben des historischen Buddha als Thema des Religionsunterrichts“ und „Wie religiöse Rituale Weltsichten ausdrücken können“. Jedes Kapitel enthält eine Einleitung, einen Hauptteil mit detaillierten Analysen und ein Fazit. Zusätzlich gibt es ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was wird im Kapitel „Die Phänomenologie des Selbst innerhalb des Buddhismus“ behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die buddhistische Lehre des Anatta (Nicht-Ich) und deren philosophische Implikationen. Es untersucht die Konzepte des Selbst im Buddhismus im Vergleich zur westlichen Philosophie und die ethischen Konsequenzen der Negierung des Egos. Das Gleichnis des Wagens wird als Beispiel herangezogen und die Frage nach möglichen totalitären Kollektivierungsprozessen im Zusammenhang mit der Entsagung der individuellen Wesenhaftigkeit wird kritisch hinterfragt.
Was ist der Inhalt des Kapitels „Das Leben des historischen Buddha als Thema des Religionsunterrichts“?
Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des Lebens des historischen Buddha in verschiedenen Schulbüchern des Religionsunterrichts. Es vergleicht die unterschiedlichen Herangehensweisen und Schwerpunkte der Bücher anhand ihrer Gliederung, Texte, Bilder, Arbeitsaufträge, Glossare, Umfang, Themenvielfalt und der didaktischen Ansätze.
Worüber handelt das Kapitel „Wie religiöse Rituale Weltsichten ausdrücken können“?
Dieses Kapitel untersucht, wie religiöse Rituale Weltsichten ausdrücken, anhand des Beispiels der Selbstmumifizierung im Shingon-Buddhismus. Es analysiert die Rolle des Leidens im Buddhismus und die Bedeutung von Ritualen und Bräuchen für die Konstruktion einer religiösen Weltsicht. Die mediale Aufmerksamkeit für die Selbstmumifizierung und die Verbindung zwischen dem Ritual und der zugrundeliegenden Weltsicht werden ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Buddhismus, Anatta, Nicht-Ich, Selbst, historisches Buddha-Leben, Religionsunterricht, religiöse Rituale, Selbstmumifizierung, Weltsicht, ethische Konsequenzen, kollektivistische Ideologie, Religionspädagogik und Schulbuchvergleich.
- Arbeit zitieren
- GRIN Verlag (Hrsg.) (Herausgeber:in), Erik Schittko (Autor:in), Anika Kehl (Autor:in), Anne-Marie Holze (Autor:in), 2023, Religiöse Rituale im Buddhismus. Selbstmumifizierung und Weltsichten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1433659