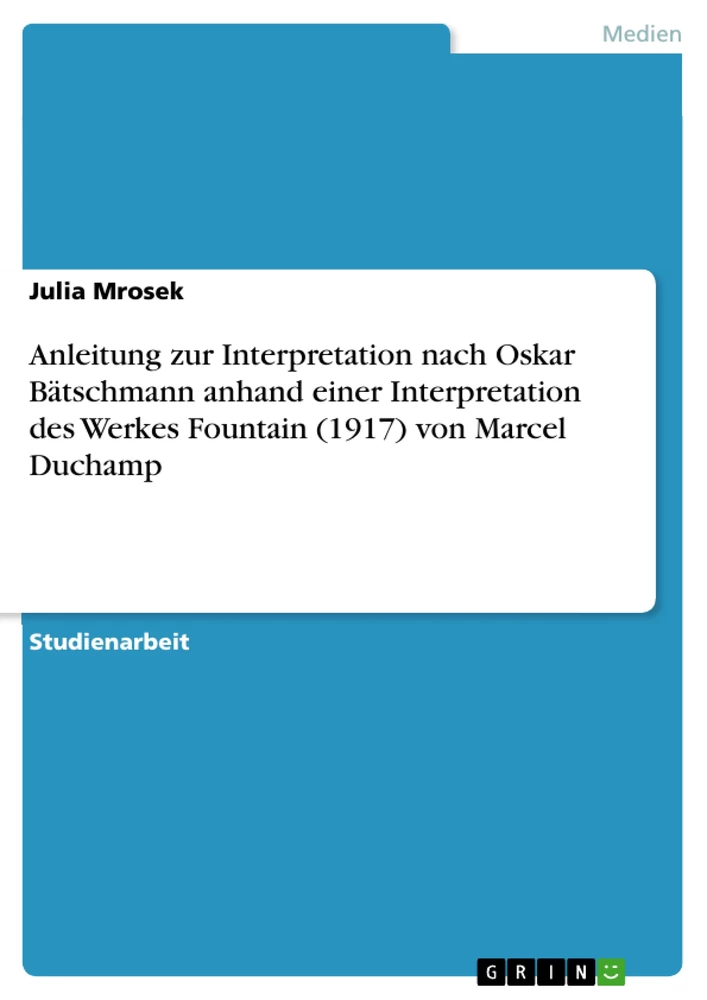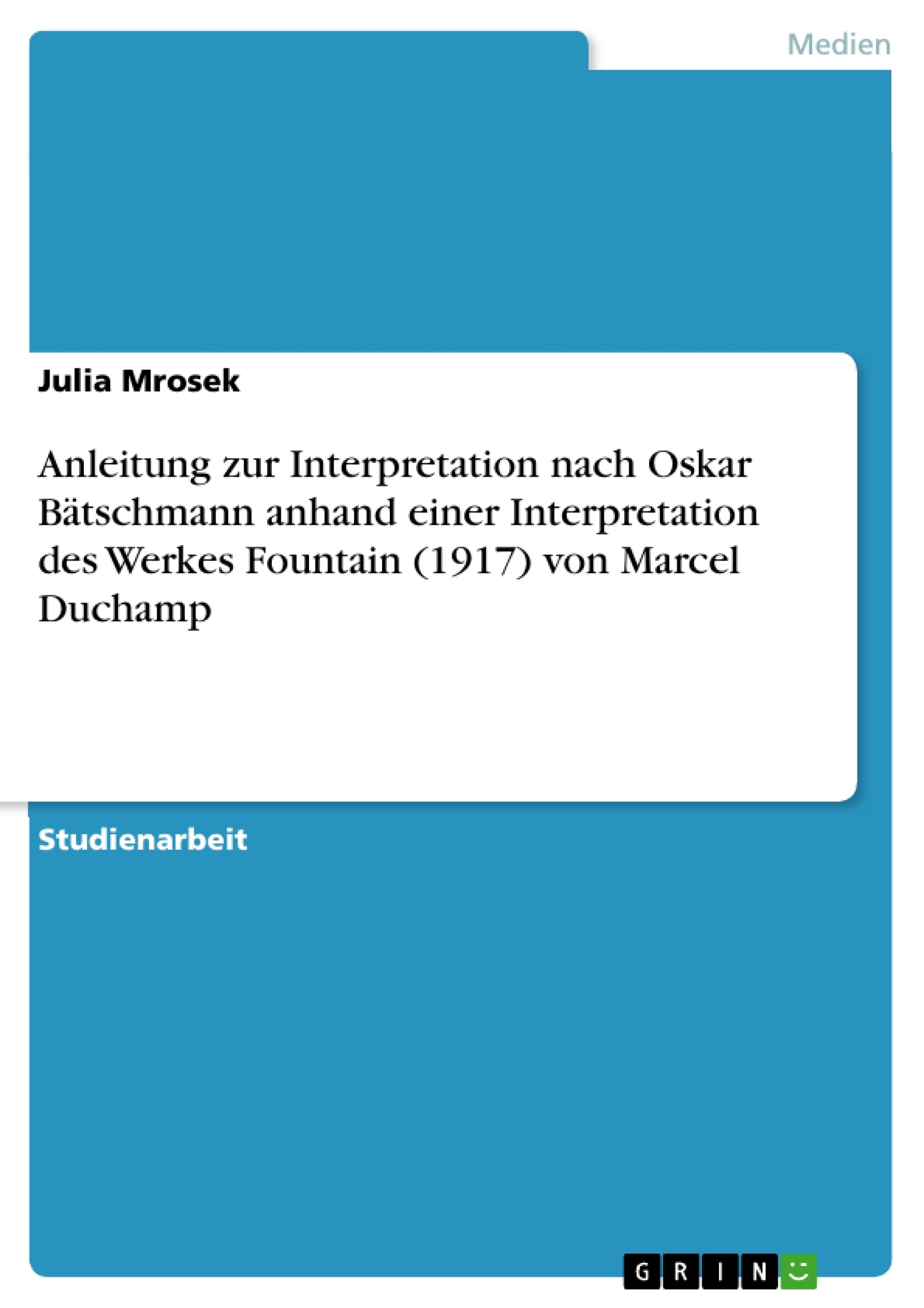Oskar Bätschmann vereinte die Ansätze verschiedener Methoden integrativ in einer Theorie, die mit Hilfe einer schrittweisen Herangehensweise die Interpretation eines Kunstwerks ermöglicht. Sein hermeneutischer Ansatz ist kein werkimmanenter, jedoch werden hierbei Erkenntnisse immer wieder auf das Werk zurückbezogen. Ein methodisch korrektes Vorgehen soll dazu führen, dass Vorwürfe nach Subjektivität verdrängt werden.
Ich werde in dieser Seminararbeit diesen Ansatz Bätschmanns auf ein Kunstwerk von Duchamp „Fountain“ anwenden und mich dabei kritisch mit ihm auseinandersetzen. Dabei gehe ich erst auf die theoretische Idee des Auslegungsprozesses ein, bevor ich beginne, mit Hilfe dessen das ausgewählte Kunstwerk zu interpretieren. Die theoretischen Inhalte entnehme ich seinem Aufsatz Anleitung zur Interpretation: Kunstgeschichtliche Hermeneutik., welcher in Kunstgeschichte. Eine Einführung. Von Martin Warnke veröffentlicht wurde.
Ich werde auf der einen Seite herausstellen, welche Möglichkeiten sich hierbei in Bezug auf die Interpretation eröffnen, aber auf der anderen Seite jedoch auch, an welche Grenzen ich bei der Anwendung der Theorie stoße. Bätschmann selbst schreibt nicht, dass eine Anwendung auf bestimmte Kunstgattungen unmöglich ist, er schreibt nur: „Die Übertragung auf andere Kunstgattungen (Architektur, Skulptur, Kunstgewerbe, Design) würde einen größeren Aufwand erfordern.“
Der Kunsthistoriker Dieter Daniels behauptete 1992 sogar,
„dass bei Duchamp viele der traditionellen kunstgeschichtlichen Methoden nicht mehr angewendet werden können. Die Verfahren der Stilanalyse und der Ikonographie, die von Cézanne über den Kubismus bis zur Abstraktion noch funktionieren, greifen bei Duchamp nicht.“
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Anleitung zur Interpretation: Kunstgeschichtliche Hermeneutik nach Oskar Bätschmann und die Anwendung der Interpretation Oskar Bätschmanns auf Marcel Duchamp: Fountain (1917)
- 2.1 Einstieg
- 2.2
- 2.3
- 2.3.1 Feststellung der Unverständlichkeit des Werks
- 2.3.2 Die Auswahl
- 2.3.3 Zur Signatur R. Mutt
- 2.3.4 Zur Benennung des Kunstwerks als Fountain
- 2.3.5 Der Zettel
- 2.3.6 Ausstellungen des Fountain
- 2.3.7 Und das soll Kunst sein?
- 3 Fazit und Kritik
- 4 Literaturnachweis
- 5 Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Anwendung der interpretativen Methode von Oskar Bätschmann auf Marcel Duchamps "Fountain" (1917). Ziel ist es, die Stärken und Schwächen dieses Ansatzes anhand eines konkreten Beispiels zu beleuchten und kritisch zu diskutieren. Dabei wird sowohl die theoretische Grundlage von Bätschmanns Hermeneutik als auch die praktische Anwendung auf das ausgewählte Kunstwerk analysiert.
- Anwendung von Bätschmanns interpretativer Methode
- Kritische Auseinandersetzung mit Bätschmanns Ansatz
- Analyse von Marcel Duchamps "Fountain"
- Die Grenzen der traditionellen kunstgeschichtlichen Methoden im Umgang mit Duchamps Werk
- Das Konzept der "Unverständlichkeit" des Kunstwerks als Ausgangspunkt der Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Sie stellt Oskar Bätschmanns integrativen Ansatz der kunstgeschichtlichen Hermeneutik vor, der eine schrittweise Interpretation ermöglicht und Subjektivität minimieren soll. Die Autorin kündigt an, Bätschmanns Methode auf Duchamps "Fountain" anzuwenden und dabei sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen dieses Ansatzes herauszustellen. Der Bezug zu Dieter Daniels' Kritik an der Anwendbarkeit traditioneller Methoden auf Duchamps Werk wird hergestellt, um die Relevanz der gewählten Methodik zu unterstreichen.
2 Anleitung zur Interpretation: Kunstgeschichtliche Hermeneutik nach Oskar Bätschmann und die Anwendung der Interpretation Oskar Bätschmanns auf Marcel Duchamp: Fountain (1917): Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es beginnt mit einem Einstieg, der Informationen über das Kunstwerk, basierend auf einem Ausstellungskatalog, bereitstellt. Bätschmanns Fokus auf die "Unverständlichkeit" des Werks als Ausgangspunkt der Interpretation wird erläutert. Die Autorin beschreibt die Herausforderungen, die sich aus der Dreidimensionalität der Skulptur und dem Verlust des Originals ergeben. Das Kapitel analysiert verschiedene Aspekte von "Fountain", einschliesslich der Signatur, der Benennung, des Ausstellungs Kontextes und der damit verbundenen Fragen und kontroversen Diskussionen um die Kunstdefinition selbst. Der gesamte Abschnitt ist darauf ausgerichtet, die Anwendung von Bätschmanns methodischem Ansatz auf ein komplexes und vielschichtiges Werk wie "Fountain" zu demonstrieren und kritisch zu hinterfragen.
Schlüsselwörter
Oskar Bätschmann, Kunstgeschichtliche Hermeneutik, Interpretation, Marcel Duchamp, Fountain, Readymade, Moderne Kunst, Unverständlichkeit, Kunstdefinition, methodische Analyse.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Anwendung der kunstgeschichtlichen Hermeneutik nach Oskar Bätschmann auf Marcel Duchamps "Fountain" (1917)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Anwendbarkeit der interpretativen Methode von Oskar Bätschmann auf Marcel Duchamps Readymade "Fountain" (1917). Sie analysiert die Stärken und Schwächen dieses Ansatzes anhand eines konkreten Beispiels und diskutiert diese kritisch.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet den integrativen Ansatz der kunstgeschichtlichen Hermeneutik nach Oskar Bätschmann. Dieser Ansatz zielt auf eine schrittweise Interpretation ab und versucht, Subjektivität zu minimieren. Die Autorin wendet die Methode Schritt für Schritt auf Duchamps "Fountain" an.
Welche Aspekte von Duchamps "Fountain" werden analysiert?
Die Analyse umfasst verschiedene Aspekte von "Fountain", darunter die Signatur "R. Mutt", die Benennung des Werks, der Ausstellungs-Kontext, die Dreidimensionalität der Skulptur und der Verlust des Originals. Ein zentraler Punkt ist die "Unverständlichkeit" des Werks als Ausgangspunkt der Interpretation.
Welche Herausforderungen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen, die sich aus der Anwendung traditioneller kunstgeschichtlicher Methoden auf ein Werk wie "Fountain" ergeben. Sie beleuchtet die Grenzen dieser Methoden im Umgang mit Duchamps Werk und die Notwendigkeit alternativer interpretativer Ansätze.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Anwendung von Bätschmanns Methode auf "Fountain", ein Fazit mit Kritik, einen Literaturnachweis und ein Abbildungsverzeichnis. Das Hauptkapitel analysiert detailliert verschiedene Aspekte des Kunstwerks im Lichte von Bätschmanns Hermeneutik.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Anwendbarkeit und die Grenzen von Bätschmanns interpretativem Ansatz anhand des Beispiels "Fountain" zu beleuchten. Sie soll die Stärken und Schwächen des Ansatzes kritisch diskutieren und zur Auseinandersetzung mit der Interpretation moderner Kunst anregen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Oskar Bätschmann, Kunstgeschichtliche Hermeneutik, Interpretation, Marcel Duchamp, Fountain, Readymade, Moderne Kunst, Unverständlichkeit, Kunstdefinition, methodische Analyse.
Wie wird die "Unverständlichkeit" des Werks behandelt?
Die "Unverständlichkeit" von Duchamps "Fountain" wird als Ausgangspunkt der Interpretation nach Bätschmann betrachtet. Die Arbeit untersucht, wie sich diese Unverständlichkeit auf den interpretativen Prozess auswirkt und welche methodischen Ansätze notwendig sind, um das Werk dennoch zu verstehen.
- Quote paper
- Julia Mrosek (Author), 2007, Anleitung zur Interpretation nach Oskar Bätschmann anhand einer Interpretation des Werkes Fountain (1917) von Marcel Duchamp, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142439