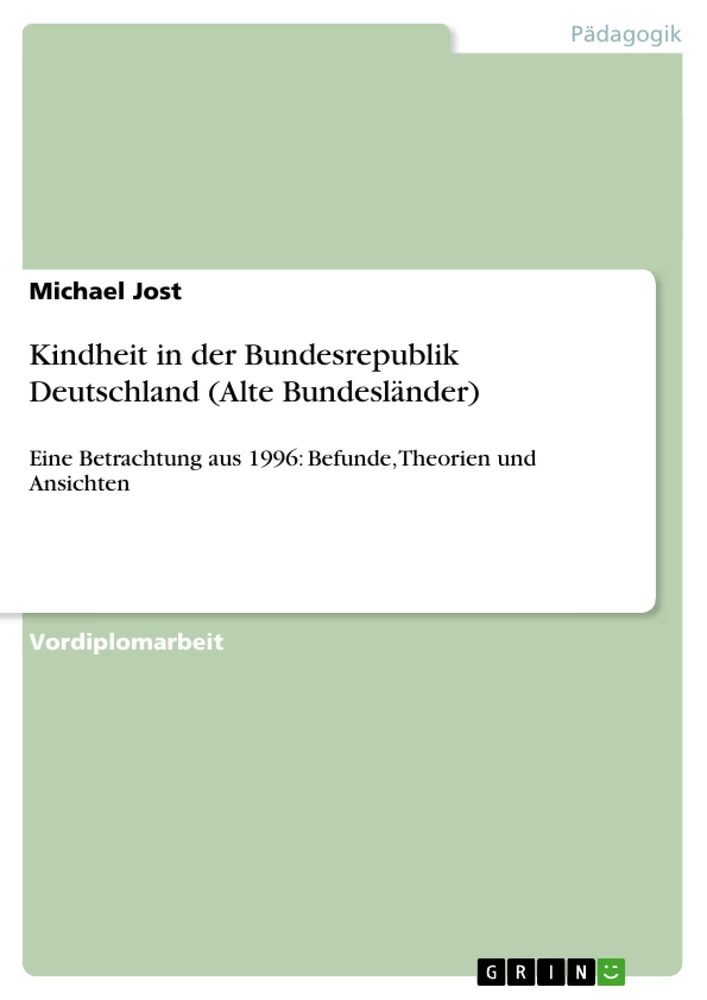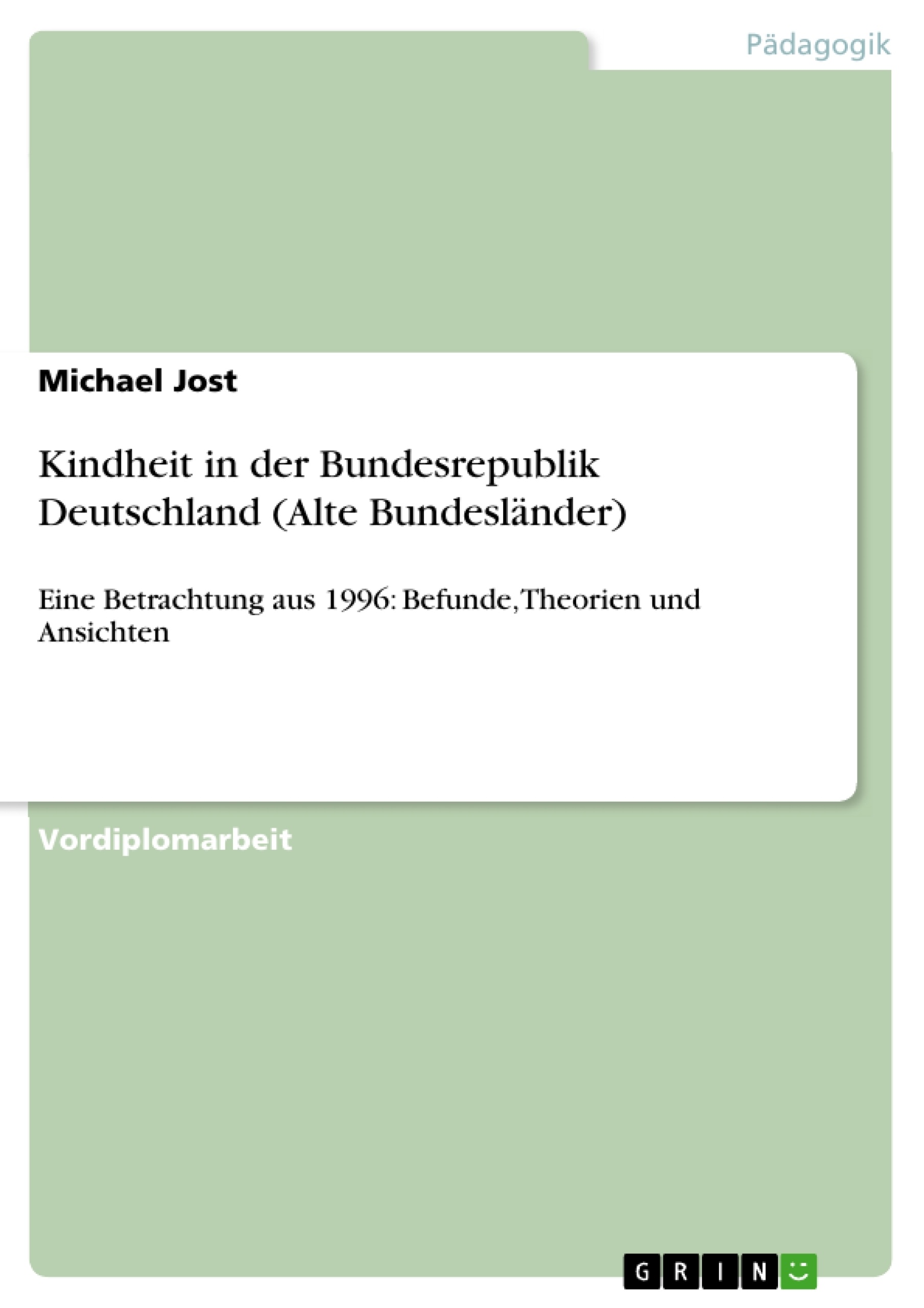Ziel dieser Arbeit aus dem Jahre 1996 war es, ein Spotlight auf die Lebensumstände der Kinder in den sogenannten "alten" Bundesländern zu werfen.
Empirische Befunde kamen dabei ebenso zum tragen, wie eine theoretische Betrachtung der Lebensphase "Kindheit" auf der Folie der damals allgemein konstatierten "Risikogesellschaft" nach Beck (1986).
Ein Textausschnitt:
Wir befinden uns in einer Zeit des gesellschaftlichen Strukturwandels. Die traditionelle Industriegesellschaft unserer Väter und Großväter gehört immer mehr der Vergangenheit an. Niemand, der die aktuelle Diskussion um die Symptome und Ursächlichkeiten dieser Entwicklung verfolgt hat, wird diesen Umstand ernsthaft in Abrede stellen wollen. Es tut sich etwas, unser Leben bewegt sich in immer schneller wechselnden Zyklen. Der Mensch läuft mehr und mehr Gefahr, Spielball seines eigenen, riskanten, aber chancenreichen Spiels zu werden. Entfaltungsmöglichkeiten von unberechenbarem Potential eröffnen sich ihm und können gleichzeitig zum sozialen „Eigentor“ mutieren.
„Entstrukturierung“, „Individualisierung“, „Freisetzung aus schicht- und klassenspezifischen Lebenslagen“ sind nur einige der Schlagworte, die im Rahmen dieser Debatte immer wieder fallen und im Verlauf meiner Darstel-lungen, gerade in Bezug auf die derzeitigen Sozialisationsbedingungen der Kindheit, eine primäre Rolle spielen...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kindheit
- Das neue Bild der Kindheit
- Zur Entstehung einer autarken kindlichen Lebensphase
- Bedeutung und Abgrenzung der Entwicklungsphase „Kind“
- Die gegenwärtigen Sozialisationsbedingungen
- Der gesellschaftliche Wandel nach Beck
- Positive und negative Wertschätzung von Kindern
- Der Wandel der Altersstruktur
- Die Familie
- Zwei Betreuungsinstitutionen: Kinderkrippe und Kindergarten
- Die Schule
- Das Freizeit- und Medien/Fernsehverhalten
- Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die veränderten Lebensumstände von Kindern in der Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) im Kontext des gesellschaftlichen Strukturwandels. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der gegenwärtigen Lebenswelt von Kindern, wobei wertende Deutungen des Wandels nur ansatzweise erfolgen. Dies liegt an der Komplexität des Themas und der Divergenz bestehender Forschungsergebnisse.
- Der Wandel des Bildes von Kindheit
- Der Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf die Sozialisation von Kindern
- Die Rolle der Familie und von Betreuungseinrichtungen
- Das veränderte Freizeit- und Medienverhalten von Kindern
- Die Herausforderungen und Chancen der neuen Lebenswelten für Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den gesellschaftlichen Strukturwandel und dessen Auswirkungen auf die Kindheit. Der rasante Wandel, gekennzeichnet durch Begriffe wie „Entstrukturierung“ und „Individualisierung“, beeinflusst die Lebenswelten von Kindern maßgeblich. Die Arbeit konzentriert sich auf die Beschreibung der gegenwärtigen Lebenswelt von Kindern und verzichtet weitgehend auf wertende Interpretationen aufgrund der Komplexität des Themas und des Mangels an eindeutigen Forschungsergebnissen bezüglich der positiven oder negativen Auswirkungen des Wandels.
Kindheit: Dieses Kapitel beleuchtet das veränderte Verständnis von Kindheit. Im Gegensatz zu früheren Auffassungen, die Kindheit als defizitären Zustand sahen, betont die moderne Kindheitsforschung die Individualität und das „Subjektsein“ des Kindes. Kinder werden als aktive Gestalter ihrer Lebenswelt betrachtet, die durch Interaktion ihre Umwelt beeinflussen und an der Konstruktion ihres eigenen Lebens beteiligt sind. Trotz der Abhängigkeit von Erwachsenen in vielen Bereichen, werden Kinder als eigenständige und sozial handlungsfähige Mitglieder der Gesellschaft anerkannt, die spezielle Ressourcen benötigen.
Die gegenwärtigen Sozialisationsbedingungen: Dieses Kapitel analysiert die aktuellen Sozialisationsbedingungen von Kindern. Es thematisiert den gesellschaftlichen Wandel nach Beck, die unterschiedlichen Wertschätzungen von Kindern, den Wandel der Altersstruktur, die Rolle der Familie, die Bedeutung von Kinderkrippen und Kindergärten sowie die Einflüsse von Schule und Medienkonsum. Es beschreibt die vielfältigen Faktoren, die die Entwicklung von Kindern in der heutigen Gesellschaft prägen.
Schlüsselwörter
Kindheit, Sozialisation, gesellschaftlicher Wandel, Individualisierung, Familie, Betreuungseinrichtungen, Schule, Medien, Lebenswelt von Kindern, Kindheitsforschung.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Veränderte Lebensumstände von Kindern in der Bundesrepublik Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die veränderten Lebensumstände von Kindern in der Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) im Kontext des gesellschaftlichen Strukturwandels. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der gegenwärtigen Lebenswelt von Kindern, wobei wertende Deutungen des Wandels nur ansatzweise erfolgen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel des Bildes von Kindheit, den Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf die Sozialisation von Kindern, die Rolle der Familie und von Betreuungseinrichtungen, das veränderte Freizeit- und Medienverhalten von Kindern sowie die Herausforderungen und Chancen der neuen Lebenswelten für Kinder.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Kindheit, ein Kapitel über die gegenwärtigen Sozialisationsbedingungen und abschließende Bemerkungen. Die Einleitung beschreibt den gesellschaftlichen Strukturwandel und dessen Auswirkungen auf die Kindheit. Das Kapitel über Kindheit beleuchtet das veränderte Verständnis von Kindheit. Das Kapitel über die gegenwärtigen Sozialisationsbedingungen analysiert die aktuellen Sozialisationsbedingungen von Kindern, inklusive gesellschaftlichem Wandel nach Beck, Wertschätzung von Kindern, Wandel der Altersstruktur, Rolle der Familie, Bedeutung von Kinderkrippen und Kindergärten sowie Einflüsse von Schule und Medienkonsum.
Wie wird das veränderte Verständnis von Kindheit dargestellt?
Im Gegensatz zu früheren Auffassungen, die Kindheit als defizitären Zustand sahen, betont die moderne Kindheitsforschung die Individualität und das „Subjektsein“ des Kindes. Kinder werden als aktive Gestalter ihrer Lebenswelt betrachtet.
Welche Rolle spielen Familie und Betreuungseinrichtungen?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Familie und von Betreuungseinrichtungen wie Kinderkrippen und Kindergärten im Kontext der Sozialisation von Kindern und deren Einfluss auf die Entwicklung in der heutigen Gesellschaft.
Wie wird der Einfluss des gesellschaftlichen Wandels beschrieben?
Der gesellschaftliche Wandel, gekennzeichnet durch Begriffe wie „Entstrukturierung“ und „Individualisierung“, wird als maßgeblicher Einflussfaktor auf die Lebenswelten von Kindern beschrieben. Die Arbeit betont jedoch die Komplexität des Themas und die Divergenz bestehender Forschungsergebnisse hinsichtlich der positiven oder negativen Auswirkungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kindheit, Sozialisation, gesellschaftlicher Wandel, Individualisierung, Familie, Betreuungseinrichtungen, Schule, Medien, Lebenswelt von Kindern, Kindheitsforschung.
Wo liegt der Fokus der Arbeit?
Der Fokus liegt auf der Beschreibung der gegenwärtigen Lebenswelt von Kindern. Wertende Interpretationen des Wandels werden aufgrund der Komplexität des Themas und des Mangels an eindeutigen Forschungsergebnissen nur ansatzweise vorgenommen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen im Kontext der Sozialisation von Kindern.
- Citar trabajo
- Dr. phil. Michael Jost (Autor), 1996, Kindheit in der Bundesrepublik Deutschland (Alte Bundesländer), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142403