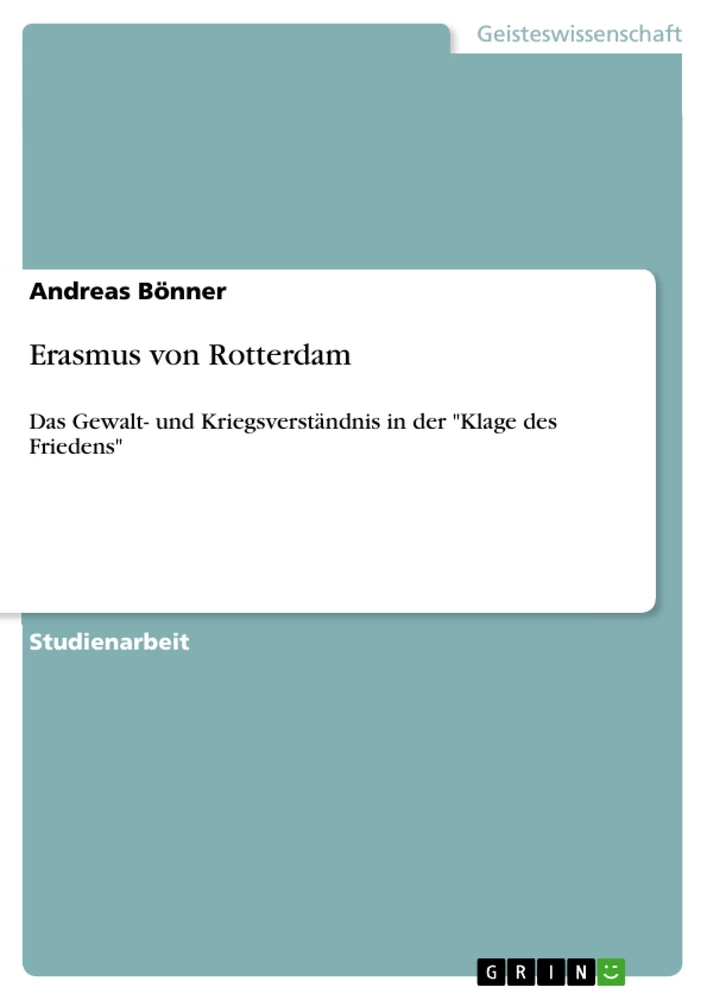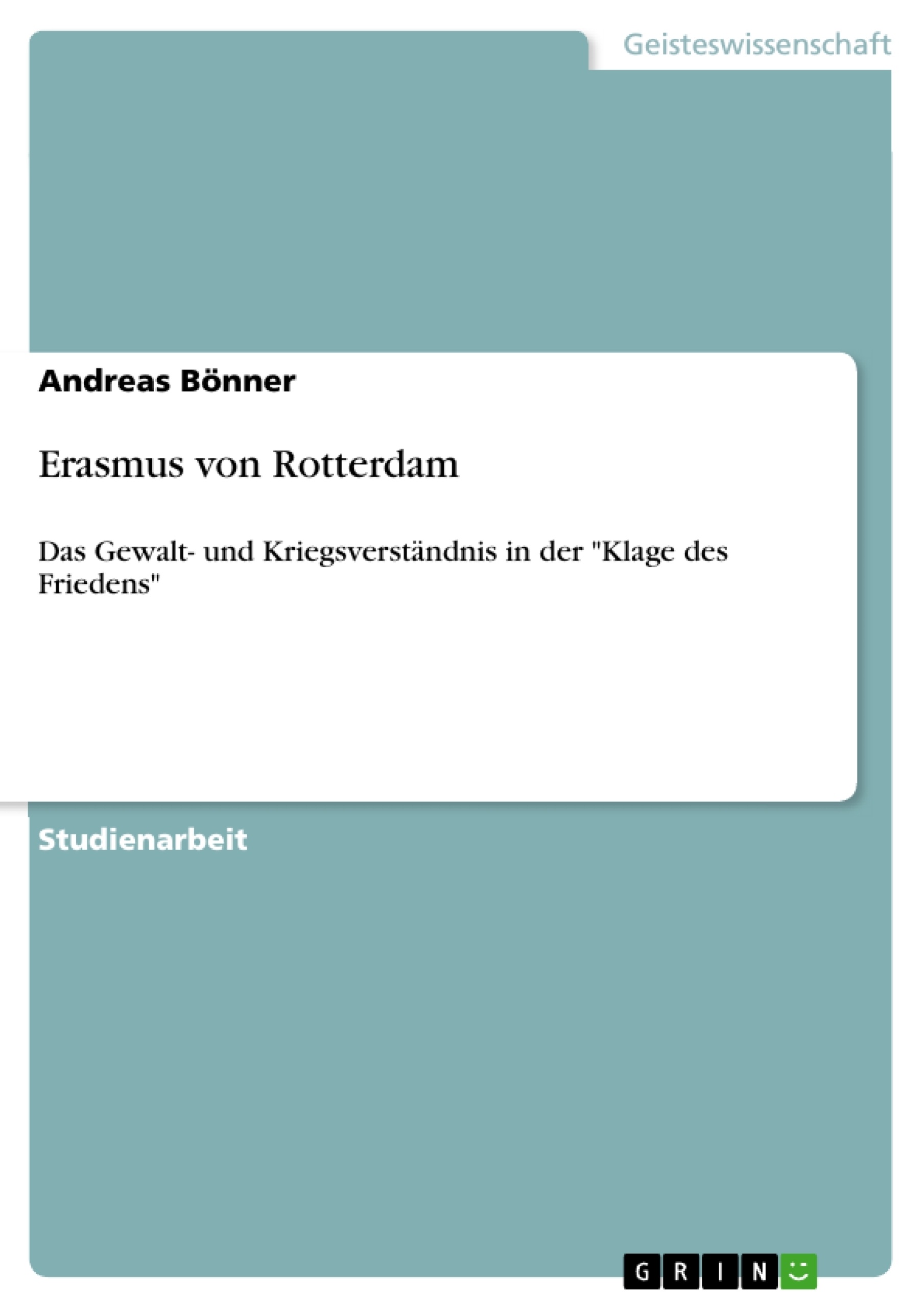Themeneinführung und Forschungsstand
„Schon Erasmus von Rotterdam und einige nach ihm haben dies als die Wahrheit, die es einzusehen gilt, verkündet“, sagte Albert Schweitzer in seiner Friedensnobelpreisrede 1954. Diese Wahrheit bedeutete die Überwindung des Krieges durch den Frieden, da er unmenschlich ist. Der Augustinerchorherr Erasmus von Rotterdam verkündete diese Tatsache schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts, zu einem Zeitpunkt, wo die bekanntesten (un-)christlichen Kriege, die Kreuzzüge, schon Geschichte waren und die unmenschlichsten Kriege in weiter Zukunft. Die Geschichte der Mensch- und der Christenheit war stets vom Krieg bestimmt, aber über die Jahrhunderte veröffentlichten immer wieder einzelne Gelehrte Schriften über den Frieden und die Überwindung des Krieges. Sie versuchten, dem Krieg eine rechtliche Grundlage zu geben. Vor Erasmus von Rotterdam waren dies zum Beispiel Cicero, Augustinus und Aristoteles; nach Erasmus vor allem die Kirche, Gelehrte wie Spinoza, Schiller, Voltaire, Tolstoi, Ghandi und die entstehende Friedensbewegung. Erasmus von Rotterdam wurde allerdings als der größte Friedensstifter bezeichnet. Er legte die Grundlage für eine Friedensethik, er begründete die Idee des Humanismus, er war das Idealbild eines Christen und er war seiner Zeit voraus.
Die Reformation wurde von ihm maßgeblich beeinflusst, doch war es nie seine Absicht, die Kirche zu spalten. Er wollte eine Reform der geistlichen und weltlichen Herrschaft, damit die Christenheit in einer friedfertigen Welt leben kann. Erasmus von Rotterdam verfasste dazu viele Schriften, die die Gelehrten und Herrscher beeinflussen sollten. Seine bekanntesten Werke sind „Vom Freien Willen“ (1524), „Das Lob der Torheit“ (1509), „Das neue Testament“ (1516) und schließlich „Die Klage des Friedens“ (1517), die die Grundlage dieser Arbeit ist. In dieser Schrift trägt die Friedensgöttin Pax ihre Klage über den Krieg in Redeform vor, und appelliert an die geistlichen und weltlichen Herrscher sowie jeden einzelnen Christen, dem Krieg abzuschwören und den Weg des Friedens einzuschlagen. Dazu zieht die Friedensgöttin Vergleiche mit der Tierwelt sowie auch vorbildliche Reiche und Herrscher als positive Beispiele heran. Die indirekte Kritik ist derart gestaltet, dass die Schrift vorerst nicht verboten wurde und sich in Europa verbreiten konnte.
Inhaltsverzeichnis
- Themeneinführung und Forschungsstand
- Kurze historische Einordnung
- „Querela Pacis“ – „Klage des Friedens“
- Zusammenfassung des Inhalts
- Gründe für die Entstehung der Schrift
- Bedeutung der „Klage des Friedens“
- Kritik und Probleme
- Gewaltverständnis des Erasmus von Rotterdam in seiner Schrift „Klage des Friedens“
- Erasmus von Rotterdam und die „Klage des Friedens“ heute
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Gewaltverständnis des Erasmus von Rotterdam in seiner Schrift „Klage des Friedens“ (1517). Ziel ist es, Erasmus' Argumentation zu analysieren und ihren historischen Kontext sowie ihre heutige Relevanz zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich mit den Ursachen von Krieg und Gewalt, wie sie von Erasmus dargestellt werden, und untersucht seine Vorschläge zur Friedensstiftung.
- Erasmus' Friedensphilosophie und ihre Wurzeln im Humanismus
- Analyse der rhetorischen Strategien in der „Klage des Friedens“
- Die Kritik an Krieg und Gewalt im Werk Erasmus'
- Der historische Kontext der Schrift und ihre Rezeption
- Die Aktualität von Erasmus' Gedanken im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Themeneinführung und Forschungsstand: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt den aktuellen Forschungsstand zu Erasmus von Rotterdam und seiner Schrift „Klage des Friedens“. Es beleuchtet die Bedeutung von Erasmus als Friedensstifter und verortet seine Arbeit im Kontext der bisherigen Friedensliteratur. Der Forschungsüberblick umfasst wichtige Biographien und Interpretationen der „Klage des Friedens“, wobei besondere Aufmerksamkeit der aktuellen Ausgabe mit Kommentar von Brigitte Hannemann gewidmet wird. Das Kapitel betont die Relevanz von Erasmus' Werk und die Notwendigkeit einer gründlichen Auseinandersetzung mit seinem Gewaltverständnis.
Kurze historische Einordnung: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über die historischen Umstände, die zur Entstehung der „Klage des Friedens“ führten. Es skizziert das politische und gesellschaftliche Umfeld des frühen 16. Jahrhunderts, in dem Kriege und Konflikte an der Tagesordnung waren. Das Kapitel hebt die Bedeutung des Werkes im Kontext der damaligen Zeit hervor und erklärt, warum Erasmus' Appell zum Frieden so wichtig war. Es bereitet den Boden für das Verständnis der Motive und Intentionen hinter der Schrift.
„Querela Pacis“ – „Klage des Friedens“: Dieses Kapitel bietet eine zusammenfassende Darstellung des Inhalts der „Klage des Friedens“. Es erklärt die Struktur der Schrift und die darin dargestellten Argumente für den Frieden. Der Fokus liegt auf der rhetorischen Gestaltung und der inhaltlichen Argumentation der Schrift. Es werden die Gründe für die Entstehung der Schrift beleuchtet sowie ihre damalige Bedeutung und die dazugehörige Kritik und eventuelle Probleme erörtert.
Gewaltverständnis des Erasmus von Rotterdam in seiner Schrift „Klage des Friedens“: Dieses Kapitel analysiert das Gewaltverständnis des Erasmus von Rotterdam, wie es in der „Klage des Friedens“ zum Ausdruck kommt. Es untersucht seine Argumentationslinie und seine anschaulichen Beispiele. Die Analyse konzentriert sich auf Erasmus’ Ansichten zu den Ursachen von Krieg und Gewalt und seine Vorschläge für ein friedliches Zusammenleben. Die Kapitel werden durch die Textstellen belegt und kritisch bewertet.
Schlüsselwörter
Erasmus von Rotterdam, Klage des Friedens, Friedensphilosophie, Gewalt, Krieg, Humanismus, Rhetorik, Reformation, Friedensethik, historisches Kontext, Aktualität.
Häufig gestellte Fragen zur "Klage des Friedens" von Erasmus von Rotterdam
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Gewaltverständnis des Erasmus von Rotterdam in seiner Schrift „Klage des Friedens“ (1517). Sie untersucht Erasmus' Argumentation, ihren historischen Kontext und ihre heutige Relevanz. Die Arbeit beleuchtet die Ursachen von Krieg und Gewalt nach Erasmus und seine Vorschläge zur Friedensstiftung. Sie beinhaltet eine Themeneinführung, eine historische Einordnung, eine detaillierte Zusammenfassung der "Klage des Friedens", eine Analyse von Erasmus' Gewaltverständnis und einen Ausblick auf die Aktualität seiner Gedanken.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Themeneinführung und Forschungsstand; Kurze historische Einordnung; „Querela Pacis“ – „Klage des Friedens“ (mit Unterkapiteln zur Inhaltszusammenfassung, Entstehungsgründen, Bedeutung, Kritik und Problemen); Gewaltverständnis des Erasmus von Rotterdam in seiner Schrift „Klage des Friedens“; Erasmus von Rotterdam und die „Klage des Friedens“ heute.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Erasmus' Friedensphilosophie und ihre humanistischen Wurzeln, die Analyse der rhetorischen Strategien in der „Klage des Friedens“, die Kritik an Krieg und Gewalt im Werk Erasmus', den historischen Kontext und die Rezeption der Schrift sowie die Aktualität von Erasmus' Gedanken im 21. Jahrhundert.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, Erasmus' Argumentation in der „Klage des Friedens“ zu analysieren und ihren historischen Kontext sowie ihre heutige Relevanz zu beleuchten. Es geht um die Untersuchung der Ursachen von Krieg und Gewalt aus Erasmus' Sicht und die Analyse seiner Vorschläge zur Friedensstiftung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Erasmus von Rotterdam, Klage des Friedens, Friedensphilosophie, Gewalt, Krieg, Humanismus, Rhetorik, Reformation, Friedensethik, historischer Kontext, Aktualität.
Wie wird die "Klage des Friedens" in der Arbeit behandelt?
Die „Klage des Friedens“ wird umfassend behandelt: Es gibt eine Zusammenfassung des Inhalts, eine Erläuterung der Struktur und Argumente, eine Analyse der rhetorischen Gestaltung und der inhaltlichen Argumentation, eine Untersuchung der Entstehungsgründe, der Bedeutung, der Kritik und möglicher Probleme der Schrift.
Wie wird Erasmus' Gewaltverständnis analysiert?
Die Arbeit analysiert Erasmus' Gewaltverständnis, wie es in der „Klage des Friedens“ zum Ausdruck kommt. Sie untersucht seine Argumentationslinie, seine Beispiele, seine Ansichten zu den Ursachen von Krieg und Gewalt und seine Vorschläge für ein friedliches Zusammenleben. Die Analyse wird durch Textbelege gestützt und kritisch bewertet.
Welche Bedeutung hat die Arbeit im Kontext der Friedensforschung?
Die Arbeit trägt zum Verständnis von Erasmus' Friedensphilosophie und ihrer Bedeutung für die heutige Friedensforschung bei. Sie beleuchtet einen wichtigen Beitrag zur Friedensliteratur und bietet neue Perspektiven auf die Ursachen von Gewalt und die Möglichkeiten der Friedensstiftung.
- Quote paper
- Andreas Bönner (Author), 2009, Erasmus von Rotterdam, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142031