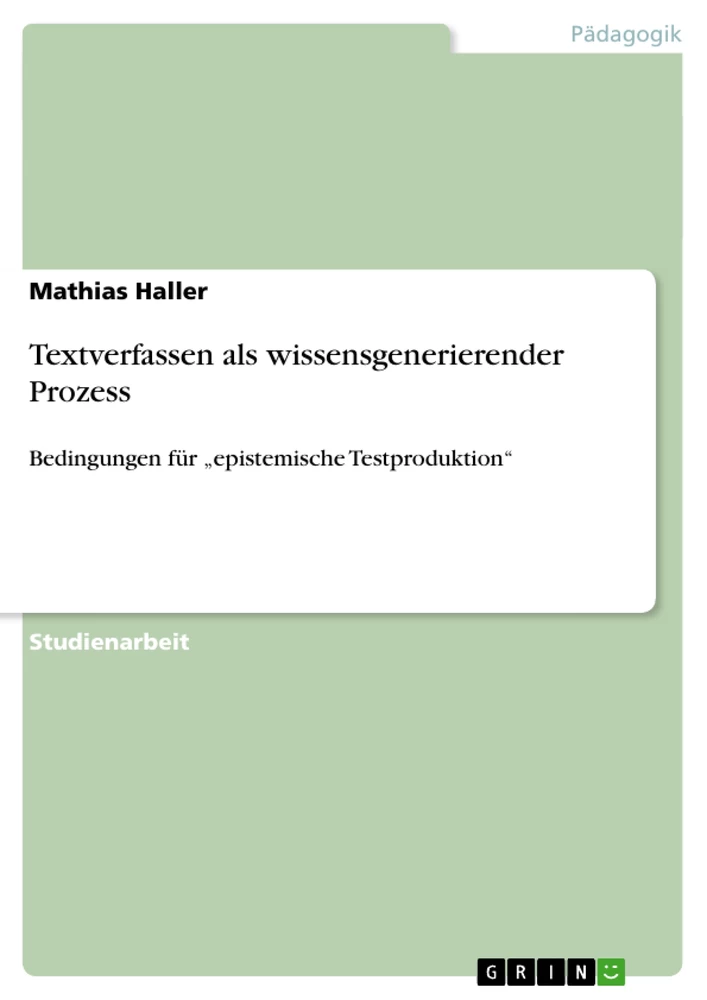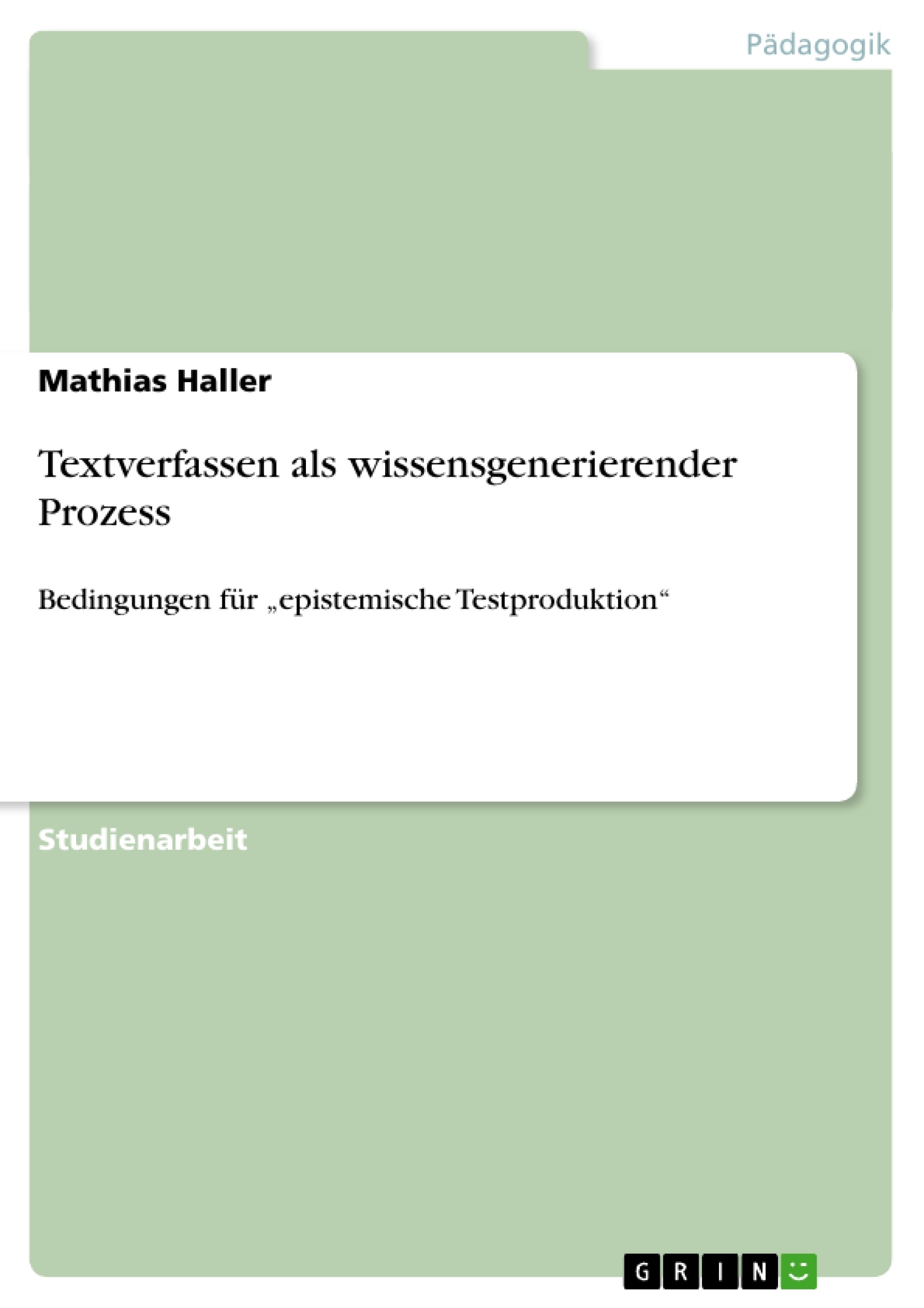Schreiben gilt zunächst als Mittel der Kommunikation – der Text als Medium, mit dem Autorinnen und Autoren Informationen, Meinungen oder Fiktionen über einen Sachverhalt potentiellen Adressaten mitteilen. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht das Verhältnis zwischen Autor und Leser. In kognitiver Hinsicht interessant ist aber auch die Wechselwirkung zwischen dem Autor und seinem Text. Untersuchungsgegenstand sind in dieser Betrachtungsweise die kognitiven Fähigkeiten, die die Grundlage für den Einsatz der rhetorischen Kompetenz im Textverfassen bilden. Der Umgang mit Wissen beim Textverfassen erhält in dieser Betrachtungsweise eine besondere Bedeutung. Denn beim Verfassen eines „Texts als Sprachwerk“ (vgl. Pospiech 2004, S. 205f.) wird nicht nur bereits aufgebautes, im Gedächtnis gespeichertes Wissen genutzt. Unter geeigneten Voraussetzungen können auch, indem Wissen bearbeitet und weiterverarbeitet wird, neue Zusammenhänge hergestellt und neue Wissensstrukturen aufgebaut werden. Wenn der Textproduktionsprozess neues Wissen generiert, kann von einer epistemischen Funktion des Textverfassen oder epistemischem Schreiben gesprochen werden.
Im Zentrum der vorliegenden Arbeit soll die Frage stehen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass epistemisches Textverfassen möglich ist.
Dafür werden zwei Modellierungsversuche vorgestellt, die in der Textproduktionsforschung bis heute einen zentralen Stellenwert einnehmen. Es handelt sich um das Modell von Hayes und Flower und die beiden Modelle von Bereiter und Scardamalia.
In einem ersten Schritt wird die Rekonstruktion des Textproduktionsprozesses als Problemlöseprozess anhand von Hayes und Flowers Modell erläutert. Die Kritik am Modell von Hayes und Flower soll in einem nächsten Schritt zu Bereiter und Scardamalias entwicklungspsychologischem Ansatz überleiten.
In der Folge bildet das „knowledge-transforming“-Modell von Bereiter und Scardamalia die Grundlage für die Auseinandersetztung mit dem Konzept des epistemischen Textberfassen.
Die Motivation der Fragestellung soll pragmatisch sein: Die Frage nach den Bedingungen epistemischen Schreibens wird gestellt, um im Wissen darüber epistemisches Textverfassen als Lernstrategie nutzbar zu machen.
In einem letzten Teil wird auf Schwierigkeiten im Umgang mit dem Konzept eingegangen. Probleme in der Verwendung des Begriffs und der empirischen Erforschung sollen kurz angesprochen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Problemstellung
- 2. Textverfassen als Problemlöseprozess
- 2.1. Das Modell von Hayes und Flower
- 2.2. Einwände gegen das Modell von Hayes und Flower
- 3. Textverfassen als Problemlösestrategie
- 3.1. Die Entwicklungshypothese von Bereiter und Scardamalia
- 3.2. Offene und geschlossene Diskursschemata
- 3.3. Die Modelle von Bereiter und Scardamalia
- 4. Epistemische Funktion des Textproduzierens
- 4.1. Bedingungen für epistemisches Schreiben als Lernstrategie
- 4.2. Schwierigkeiten mit dem Konzept des epistemischen Schreibens
- 5. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Voraussetzungen für epistemisches Textverfassen, also das Generieren von neuem Wissen durch den Schreibprozess. Sie analysiert bestehende Modelle der Textproduktion, um die Bedingungen für erfolgreiches epistemisches Schreiben als Lernstrategie zu identifizieren. Die Arbeit fokussiert auf die Anwendung dieser Erkenntnisse in der Praxis.
- Modellierung des Textproduktionsprozesses als Problemlöseprozess
- Analyse des Modells von Hayes und Flower und Kritik daran
- Entwicklungspsychologischer Ansatz von Bereiter und Scardamalia
- Das Konzept des epistemischen Schreibens als Lernstrategie
- Schwierigkeiten bei der Anwendung und Erforschung des Konzepts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Voraussetzungen für epistemisches Textverfassen. Sie beschreibt Textproduktion nicht nur als Kommunikation, sondern als komplexen Prozess, der unter bestimmten Bedingungen zur Generierung neuen Wissens führen kann. Die Arbeit kündigt die Analyse der Modelle von Hayes & Flower und Bereiter & Scardamalia an, um die Bedingungen für epistemisches Schreiben zu erforschen und deren praktische Anwendung als Lernstrategie zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Erarbeitung von Kriterien, die erfolgreiches epistemisches Schreiben ermöglichen.
2. Textverfassen als Problemlöseprozess: Dieses Kapitel untersucht den Textproduktionsprozess als Problemlöseprozess. Es beginnt mit der Beschreibung der typischen Situation des Schreibens als Problem, dessen Lösungsweg von Anfang an nicht klar ist. Im Mittelpunkt steht die Vorstellung von Hayes und Flowers Modell, das den Textproduktionsprozess als zyklisches Zusammenspiel verschiedener kognitiver Prozesse darstellt. Das Kapitel beleuchtet kritische Punkte dieses Modells und bereitet den Weg zur Betrachtung des entwicklungspsychologischen Ansatzes von Bereiter und Scardamalia.
3. Textverfassen als Problemlösestrategie: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklungshypothese von Bereiter und Scardamalia, die verschiedene Strategien beim Textverfassen unterscheidet. Die Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Diskursschemata wird erläutert und in den Kontext der Modelle von Bereiter und Scardamalia eingeordnet. Es wird untersucht, wie verschiedene Schreibstrategien die Möglichkeit zum Generieren neuen Wissens beeinflussen.
4. Epistemische Funktion des Textproduzierens: Aufbauend auf dem „knowledge-transforming“-Modell von Bereiter und Scardamalia wird das Konzept des epistemischen Schreibens vertieft. Dieses Kapitel analysiert die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Schreiben zum Aufbau neuer Wissensstrukturen führt. Es werden sowohl förderliche Faktoren als auch potenzielle Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Konzept des epistemischen Schreibens beleuchtet.
Schlüsselwörter
Epistemisches Schreiben, Textproduktion, Problemlöseprozess, Hayes und Flower, Bereiter und Scardamalia, Wissensgenerierung, Lernstrategie, kognitive Schreibforschung, Diskursschemata.
Häufig gestellte Fragen zum Text über Epistemisches Schreiben
Was ist das zentrale Thema des Textes?
Der Text untersucht die Voraussetzungen für epistemisches Textverfassen, also das Generieren von neuem Wissen durch den Schreibprozess. Er analysiert bestehende Modelle der Textproduktion, um die Bedingungen für erfolgreiches epistemisches Schreiben als Lernstrategie zu identifizieren und deren praktische Anwendung zu beleuchten.
Welche Modelle der Textproduktion werden im Text analysiert?
Der Text analysiert hauptsächlich die Modelle von Hayes und Flower (Textproduktion als Problemlöseprozess) und Bereiter und Scardamalia (Entwicklungspsychologischer Ansatz, verschiedene Schreibstrategien und das „knowledge-transforming“-Modell). Die Stärken und Schwächen dieser Modelle werden kritisch beleuchtet.
Was versteht der Text unter „epistemischem Schreiben“?
„Epistemisches Schreiben“ bezeichnet im Kontext des Textes den Schreibprozess, der aktiv zur Generierung und zum Aufbau von neuem Wissen beiträgt. Es ist mehr als bloße Kommunikation; es ist ein Prozess der Wissenskonstruktion.
Welche Rolle spielt der Problemlöseprozess beim Textverfassen?
Der Text betrachtet das Textverfassen als komplexen Problemlöseprozess. Die Modelle von Hayes und Flower und Bereiter und Scardamalia werden herangezogen, um diesen Prozess zu beschreiben und zu analysieren. Die verschiedenen Strategien beim Problemlösen beeinflussen die Möglichkeit, neues Wissen zu generieren.
Wie werden die Modelle von Hayes und Flower und Bereiter und Scardamalia verglichen?
Der Text vergleicht die beiden Modelle, indem er die Stärken und Schwächen von Hayes und Flowers zyklischem Modell herausarbeitet und diese mit dem entwicklungspsychologischen Ansatz von Bereiter und Scardamalia kontrastiert. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die jeweiligen Modelle das epistemische Schreiben erklären.
Welche Bedeutung haben offene und geschlossene Diskursschemata im Kontext des Textes?
Offene und geschlossene Diskursschemata werden im Zusammenhang mit dem Modell von Bereiter und Scardamalia diskutiert. Sie beschreiben unterschiedliche Strategien beim Textverfassen, die sich auf die Möglichkeit auswirken, neues Wissen zu generieren. Offene Schemata fördern eher das epistemische Schreiben.
Welche Schwierigkeiten werden im Zusammenhang mit epistemischem Schreiben genannt?
Der Text benennt Schwierigkeiten bei der Anwendung und Erforschung des Konzepts des epistemischen Schreibens. Es werden potenzielle Herausforderungen und Hindernisse bei der Umsetzung in der Praxis beleuchtet.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Textes wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Epistemisches Schreiben, Textproduktion, Problemlöseprozess, Hayes und Flower, Bereiter und Scardamalia, Wissensgenerierung, Lernstrategie, kognitive Schreibforschung und Diskursschemata.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung und Problemstellung, Textverfassen als Problemlöseprozess, Textverfassen als Problemlösestrategie, Epistemische Funktion des Textproduzierens und Schlusswort. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der Forschungsfrage zum epistemischen Schreiben.
Für wen ist dieser Text relevant?
Der Text ist relevant für Wissenschaftler*innen, die sich mit kognitiver Schreibforschung, Lernprozessen und der Didaktik des Schreibens befassen. Er bietet einen Überblick über relevante Theorien und Modelle sowie eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept des epistemischen Schreibens.
- Quote paper
- Mathias Haller (Author), 2009, Textverfassen als wissensgenerierender Prozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141733