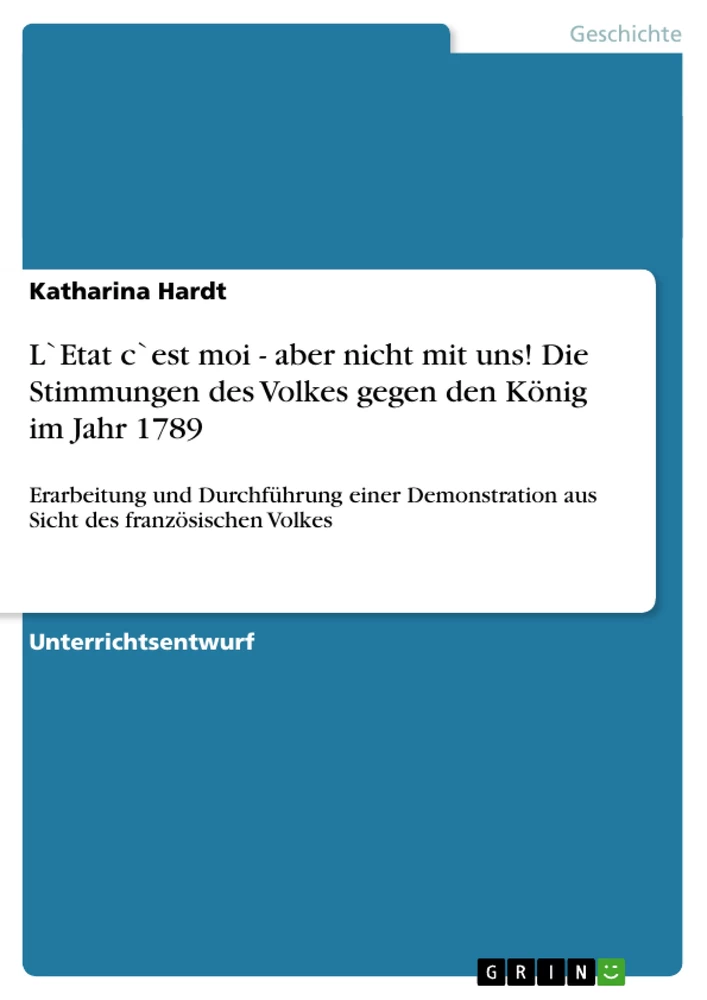Die Unterrichtsreihe mit dem Titel „Französische Revolution“ ist im Kernlehrplan für Hauptschulen in Nordrhein- Westfalen für das Fach Geschichte unter der Themeneinheit „Freiheit- Gleichheit- Brüderlichkeit“ verankert. Folgende Gegenstandsbereich werden dazu im Unterricht behandelt:
- Absolutismus in Frankreich als historische Bedingung der „großen“ Revolution
- Der Dritte Stand
- Verlauf und Ergebnisse der Französischen Revolution
- Symbol demokratischer Partizipationsbewegung
Zu den Schwerpunkten und Inhalten der Reihe zählen:
- Klärung des Begriffes „Revolution“
- Menschenrechte
- Unterdrückung und Widerstand
- Ursachen, Anlass und Verlauf der Französischen Revolution
- Die Französische Revolution und daraus resultierende langfristige Folgen.
Im bisherigen Verlauf der Unterrichtsreihe wurde auf die heutigen Menschenrechte eingegangen und diesbezüglich Begriffe wie Unterdrückung, Recht auf Eigentum, Freiheit und Sicherheit geklärt. Des Weiteren wurde der Begriff „Revolution“ im Hinblick auf eine allgemeine Definition erläutert und durch verschiedene Arbeitsaufgaben verdeutlicht. In den letzten Stunden Stand das Thema „Ständepyramide“ im Vordergrund. Dazu arbeiteten die Lernenden die Unterschiede innerhalb der Drei-Stände- Gesellschaft heraus.
Inhaltsverzeichnis
- Thema der Unterrichtsstunde
- Die Unterrichtsreihe „Französische Revolution“
- Schwerpunkte und Inhalte der Reihe
- Thema der Stunde
- Lernziele
- Methodisch-didaktische Begründung
- Zur Lerngruppe
- Zum Leistungsniveau der Klasse
- Zur Begründung der Stunde
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Unterrichtsstunde besteht darin, den Schülern die negativen Stimmungen des französischen Volkes im Jahr 1789 näherzubringen und sie dazu anzuregen, diese Stimmungen aus der Perspektive des Volkes auszudrücken. Die Stunde dient als Einführung in die Ursachen und den Verlauf der Französischen Revolution. Der Fokus liegt auf dem empathischen Verständnis der damaligen Situation.
- Die Unzufriedenheit des französischen Volkes als Auslöser der Revolution
- Die sozialen und ökonomischen Ungerechtigkeiten im Frankreich des 18. Jahrhunderts
- Die Rolle des Dritten Standes
- Die Bedeutung von Partizipation und Widerstand
- Die Entwicklung des Gefühls der Ungerechtigkeit und des Wunsches nach Veränderung
Zusammenfassung der Kapitel
Thema der Unterrichtsstunde: Diese Einleitung beschreibt den Fokus der Stunde: die Erarbeitung und Durchführung einer Demonstration aus der Sicht des französischen Volkes im Jahr 1789, um die Stimmung der Bevölkerung gegen den König zu verdeutlichen. Der Titel "L'Etat c'est moi- aber nicht mit uns!" unterstreicht den Widerstand gegen die absolute Monarchie. Die Stunde soll die Schüler emotional einbeziehen und ein Verständnis für die Ursachen der Revolution fördern.
Die Unterrichtsreihe „Französische Revolution“: Die Unterrichtsreihe ist im Kernlehrplan für Hauptschulen in Nordrhein-Westfalen verankert und behandelt den Absolutismus in Frankreich, den Dritten Stand, den Verlauf und die Ergebnisse der Französischen Revolution, sowie deren Symbolcharakter als demokratische Partizipationsbewegung. Die Reihe zielt auf die Klärung von Begriffen wie „Revolution“, Menschenrechte, Unterdrückung und Widerstand ab, und beleuchtet Ursachen, Anlass, Verlauf und langfristige Folgen der Revolution.
Schwerpunkte und Inhalte der Reihe: Dieser Abschnitt spezifiziert die Schlüsselthemen der Reihe: die Klärung des Begriffs „Revolution“, die Auseinandersetzung mit Menschenrechten, die Untersuchung von Unterdrückung und Widerstand, sowie die Analyse der Ursachen, des Anlasses und des Verlaufs der Französischen Revolution inklusive ihrer langfristigen Folgen. Die bisherigen Stunden behandelten bereits die heutigen Menschenrechte, den Begriff „Revolution“ und die Ständepyramide.
Thema der Stunde: Diese Sektion detailliert die Stunde, in der die Schüler die Stimmungen im französischen Volk 1789 erarbeiten und ausdrücken sollen. Ein französischer Bauer wird als Gast auftreten und seine Geschichte erzählen, um den Schülern die damalige Situation näherzubringen. Die Schüler bearbeiten in Partnerarbeit einen Arbeitsauftrag, der sich mit ungerechten Steuern, Armut und gesetzlicher Ungerechtigkeit befasst. Die Ergebnisse werden in einer simulierten Demonstration vor einem Königsmodell präsentiert. Die Stunde schließt mit einer Reflexionsphase.
Lernziele: Die Hauptzielsetzung ist das affektive Erfassen und Ausdrücken der negativen Stimmungen des französischen Volkes 1789 durch die Übertragung der Bauern-Geschichte auf die eigene Rolle als Teil des Volkes. Nebenziele umfassen das Erkennen der Lebensumstände der Menschen um 1789 und deren Beitrag zur Unzufriedenheit, sowie das Verständnis für politische Partizipation, das Hinterfragen von Regierungssystemen und das Äußern von Unzufriedenheit.
Methodisch-didaktische Begründung: Dieser Abschnitt erläutert die methodische Vorgehensweise im Kontext der Lerngruppe (Klasse 7a mit sprachlichen Defiziten und Migrationshintergrund). Die Stunde nutzt eine empathische Methode der Perspektivübernahme, um den Schülern den Missmut des Volkes als Auslöser der Revolution zu verdeutlichen. Die aktive Auseinandersetzung mit der Thematik, anstatt der alleinigen Textarbeit, soll das Verständnis fördern.
Schlüsselwörter
Französische Revolution, Absolutismus, Dritter Stand, Ungerechtigkeit, Armut, Steuern, Menschenrechte, Widerstand, Revolution, Partizipation, Demonstration.
Häufig gestellte Fragen zur Unterrichtsplanung: "L'Etat c'est moi- aber nicht mit uns!"
Was ist das Thema der Unterrichtsstunde und der Reihe?
Die Unterrichtsstunde konzentriert sich auf die Darstellung der negativen Stimmung des französischen Volkes 1789 vor dem Hintergrund der Französischen Revolution. Die gesamte Unterrichtsreihe behandelt den Absolutismus in Frankreich, den Dritten Stand, den Verlauf und die Folgen der Revolution sowie deren Bedeutung als demokratische Bewegung. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Begriffen wie "Revolution", Menschenrechte, Unterdrückung und Widerstand.
Welche Lernziele werden in der Stunde verfolgt?
Die Schüler sollen die negativen Stimmungen des französischen Volkes 1789 empathisch erfassen und ausdrücken. Zusätzliche Lernziele umfassen das Verstehen der Lebensumstände der Menschen um 1789, deren Beitrag zur Unzufriedenheit, das Verständnis von politischer Partizipation, das Hinterfragen von Regierungssystemen und das Äußern von Unzufriedenheit.
Welche Methoden werden eingesetzt?
Die Stunde verwendet eine empathische Methode der Perspektivübernahme. Die Schüler bearbeiten einen Arbeitsauftrag in Partnerarbeit zum Thema ungerechte Steuern, Armut und gesetzliche Ungerechtigkeit. Die Ergebnisse werden in einer simulierten Demonstration präsentiert. Ein französischer Bauer (Gastauftritt) erzählt seine Geschichte, um die damalige Situation zu veranschaulichen. Die Stunde schließt mit einer Reflexionsphase.
Welche Schwerpunkte und Inhalte werden in der Unterrichtsreihe behandelt?
Die Reihe behandelt den Begriff "Revolution", Menschenrechte, Unterdrückung und Widerstand, sowie die Ursachen, den Anlass, den Verlauf und die langfristigen Folgen der Französischen Revolution. Die Ständepyramide und der Absolutismus werden ebenfalls thematisiert.
Für welche Lerngruppe ist die Unterrichtsplanung konzipiert?
Die Planung ist für die Klasse 7a konzipiert, die durch sprachliche Defizite und Migrationshintergrund gekennzeichnet ist. Die methodische Vorgehensweise berücksichtigt diese Besonderheiten.
Wie wird die Thematik der Unzufriedenheit des französischen Volkes 1789 vermittelt?
Durch die Simulation einer Demonstration, die Bearbeitung eines Arbeitsauftrags zu sozialen Ungerechtigkeiten und das Zuhören der Geschichte eines französischen Bauern sollen die Schüler die negativen Stimmungen des Volkes nachvollziehen und ausdrücken können.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Thematik relevant?
Französische Revolution, Absolutismus, Dritter Stand, Ungerechtigkeit, Armut, Steuern, Menschenrechte, Widerstand, Revolution, Partizipation, Demonstration.
Wie wird der Bezug zum Lehrplan hergestellt?
Die Unterrichtsreihe ist im Kernlehrplan für Hauptschulen in Nordrhein-Westfalen verankert.
Wie wird die Stunde strukturiert?
Die Stunde beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von der Partnerarbeit, der Präsentation der Ergebnisse in Form einer simulierten Demonstration und einer abschließenden Reflexionsphase.
Welche Rolle spielt der "französische Bauer" in der Stunde?
Der französische Bauer fungiert als Gast und erzählt seine Geschichte, um den Schülern die Lebensbedingungen und die damit verbundene Unzufriedenheit der Menschen um 1789 näherzubringen und so das empathische Verständnis zu fördern.
- Quote paper
- Katharina Hardt (Author), 2009, L`Etat c`est moi - aber nicht mit uns! Die Stimmungen des Volkes gegen den König im Jahr 1789 , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141396