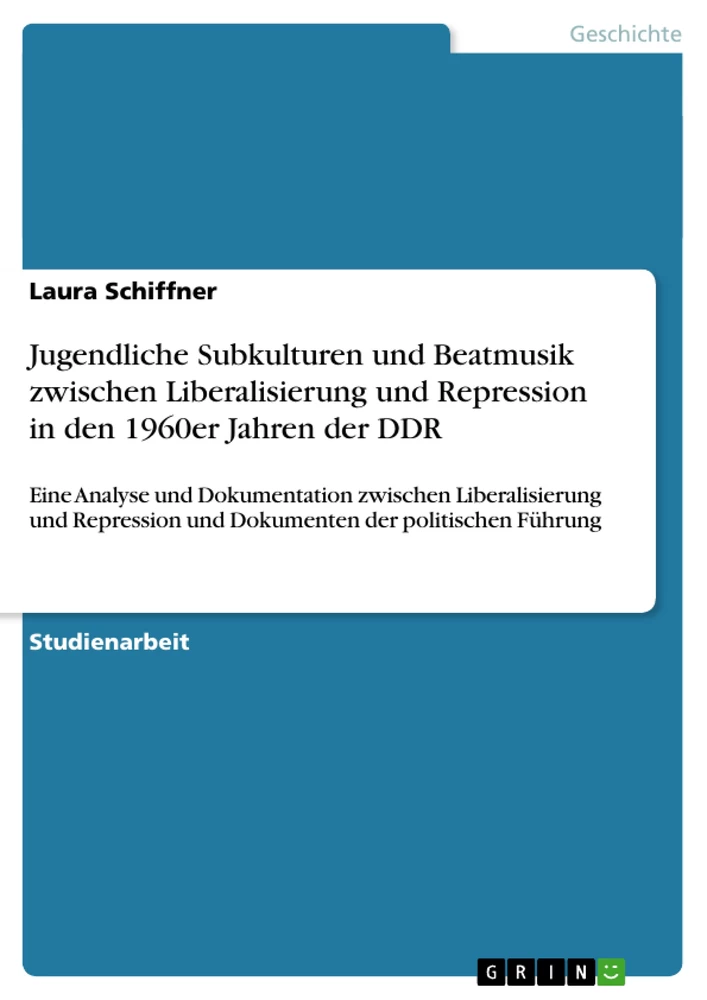Beschäftigt man sich mit der Jugend und der Jugendpolitik in der DDR kommt man nicht umhin, sich auch mit der Kulturarbeit in der DDR auseinander zu setzen. Daher muss vor einer näheren Betrachtung der Beatmusik in der DDR auch die Entwicklung der Kulturpolitik dargestellt werden. Ohne diese, den entstehenden jugendlichen Subkulturen vorausgehenden Ereignisse, werden jene nicht greif- und erklärbar. Daher muss die Entwicklung der Beatmusik in den politischen und ideologischen Kontext eingeordnet werden.
Wenn wir uns heute mit der DDR befassen, ist uns bewusst, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Immer häufiger werden aber auch die historischen Ereignisse in unprofessionellen Diskussionen verklärt und verharmlost. Öffentlicher Meinungsstreit endet nicht selten in einer (n)ostalgischen Mystifizierung. Gerade vor diesem Hintergrund muss immer der Zusammenhang von Gesellschafts-, Kultur- und Mentalitätsgeschichte verdeutlicht und betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kulturpolitik im Zeitalter der Extreme
- Entwicklungsphasen in der DDR
- Kulturpolitik bis 1961
- Jugendpolitik
- Erstes Jugendkommuniqué 1961
- Zweites Jugendkommuniqué 1963
- Jugendpolitik und Beatmusik zwischen Repression und Anpassung
- Die Politik und der Beat
- Die „Rockbürokratie“
- Die Jugend und der Beat
- Die Wahrnehmung der Beatkultur aus Sicht der politischen Führung
- Die Abgrenzungsversuche der jugendlichen Subkulturen
- Der Beat-Aufstand in Leipzig
- Wahrnehmung und Kontrollversuche der politischen Führung
- Der Weg zum kulturpolitischen Kahlschlag
- Ausgewähltes Einzelschicksal eines 16jährigen Mädchens
- Erich Loest „Es geht seinen Gang oder die Mühen in unserer Ebene“
- Das 11. Plenum
- Nach dem Plenum
- Haarschneide - Aktion im Kreis Pößneck
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Beatmusik in der DDR und ihrer Einordnung in den politischen und ideologischen Kontext. Ziel ist es, die jugendlichen Subkulturen der 1960er Jahre anhand von Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) und Dokumenten der politischen Führung der DDR zu analysieren und zu dokumentieren.
- Kulturpolitik und deren Einfluss auf jugendliche Subkulturen
- Die Rolle der Beatmusik in der DDR
- Die Reaktion der politischen Führung auf den Beat
- Kontroll- und Abgrenzungsversuche der Staatsorgane
- Die jugendliche Subkultur im Kontext der DDR-Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Jugend und Jugendpolitik in der DDR ein und beleuchtet die Rolle der Kulturarbeit. Es wird die Notwendigkeit der Einordnung der Beatmusik in den politischen und ideologischen Kontext der DDR betont. Die Kapitel 2 und 3 befassen sich mit der Kultur- und Jugendpolitik der DDR, insbesondere mit den Jugendkommuniqués und deren Auswirkungen auf die Beatmusik. Kapitel 4 analysiert die Reaktion der politischen Führung auf den Beat und zeigt die Entstehung der „Rockbürokratie“ auf. Kapitel 5 untersucht die Wahrnehmung der Beatkultur durch die politische Führung und die Abgrenzungsversuche der jugendlichen Subkulturen. Kapitel 6 beleuchtet den Beat-Aufstand in Leipzig, die Kontrollversuche der politischen Führung und den Weg zum kulturpolitischen Kahlschlag. Kapitel 7 analysiert die Reaktionen der politischen Führung auf die Beatkultur nach dem 11. Plenum.
Schlüsselwörter
Jugendpolitik, Beatmusik, DDR, Kulturpolitik, Staatssicherheit, politische Führung, Jugendkultur, Subkultur, Repression, Anpassung, Kontrollversuche, Abgrenzung, Kahlschlag.
- Quote paper
- Laura Schiffner (Author), 2009, Jugendliche Subkulturen und Beatmusik zwischen Liberalisierung und Repression in den 1960er Jahren der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141358