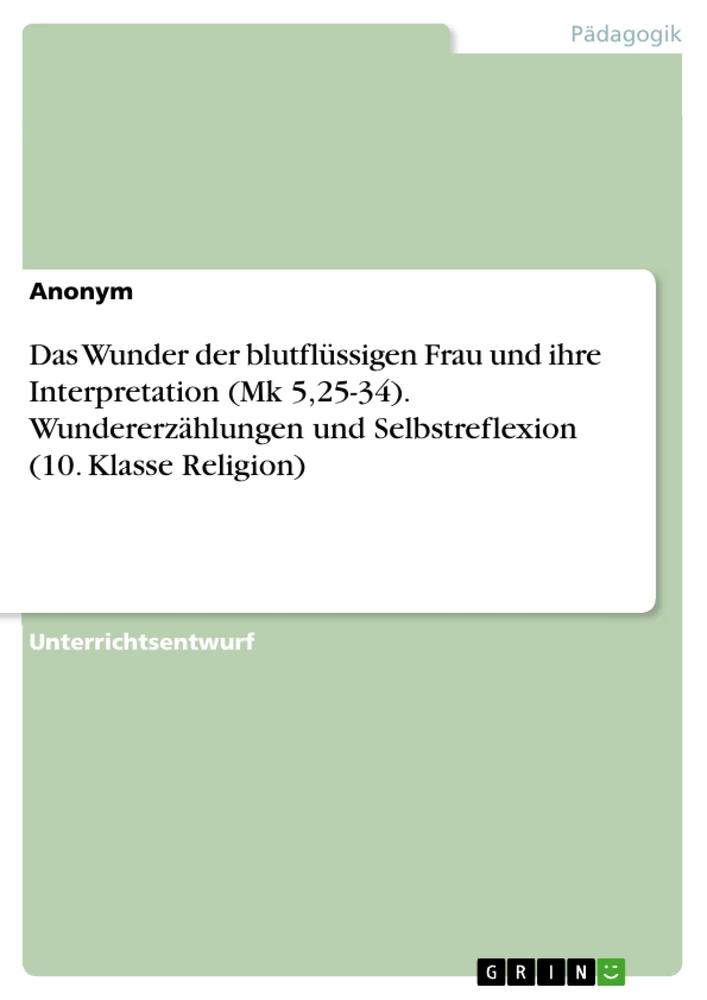In der geplanten Unterrichtsstunde soll die Wundergeschichte der blutflüssigen Frau aus Markus 5,25-34 untersucht werden. Die biblische Erzählung berichtet von einer Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen leidet und von Ärzten nicht geheilt werden konnte. Mutig entschließt sie sich, zu Jesus zu gehen und sein Gewand zu berühren, in der Hoffnung, geheilt zu werden. Ihr Glaube führt zur Heilung und Jesus erkennt nicht nur die von ihm ausgegangene Kraft, sondern auch ihre Berührung und Heilung an. Diese Geschichte veranschaulicht Jesus als Heiler und betont die Bedeutung von Glauben, Vertrauen und Fürsorge für ausgestoßene Menschen.
Um einen differenzierten und fundierten Zugang zu ermöglichen, werden in diesem Kapitel relevante Hintergrundinformationen mittels einer historisch-kritischen Methode erörtert. Die Analyse konzentriert sich hauptsächlich auf eine religionsgeschichtliche Betrachtung, da dies für die Vorbereitung und Durchführung der Unterrichtsstunde von Bedeutung ist.
Eine Einführung in die Arbeit mit einer Wundererzählung bietet sich an, indem den Schüler*innen bestimmte Hintergrundinformationen vermittelt werden. Es ist wichtig zu erklären, dass die Wundergeschichten im Neuen Testament verschiedenen Untergattungen zugeordnet werden können. Die Heilung der blutflüssigen Frau fällt unter die Untergattung der Therapien, welche Heilungswunder darstellen, ohne dass ein Kampf stattfindet. Stattdessen erfolgt die Heilung durch die Übertragung der Kraft des Wundertäters auf die betroffene Person. Dies kann, wie im Fall der blutflüssigen Frau, unwissentlich geschehen (Mk 5,21ff), oder wissentlich durch eine bewusste Berührung von Jesus.
Für die Unterrichtsstunde wurde eine eigens angefertigte Übersetzung des griechischen Textes gewählt, um näher am Originaltext zu bleiben und eine einfache, klare Sprache mit weniger komplexen Wörtern zu verwenden. Dies könnte den SuS den Zugang zum Text erleichtern. Die unmittelbaren und anschaulichen Ausdrücke sowie die direkte Rede der Charaktere ermöglichen es den SuS, die zentrale Botschaft der Heilungsgeschichte besser zu verstehen und sich intensiver mit den darin enthaltenen Botschaften und Themen auseinanderzusetzen. Der Markustext eignet sich besonders gut für die geplante Unterrichtsstunde, da er im Vergleich zum Matthäus- und Lukastext länger ist und daher mehr Details enthält.
Inhaltsverzeichnis
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Methodische Analyse
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Übersetzung
- Stundenraster
- Bild: Die Heilung der blutflüssigen Frau
- Arbeitsbogen I
- Arbeitsbogen I - Erwartungshorizont
- Arbeitsbogen II
- Arbeitsbogen III
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Fachdidaktische Übung im Sommersemester 2023 befasst sich mit der Wundergeschichte der blutflüssigen Frau aus Markus 5,25-34. Die Arbeit analysiert die biblische Erzählung aus verschiedenen Perspektiven und legt einen Schwerpunkt auf die didaktische Umsetzung für den Unterricht.
- Religionsgeschichtliche Betrachtung der Wundererzählung und ihrer Bedeutung im Kontext der Reinheitsvorschriften
- Analyse der sozialen Dimension der Heilung und ihrer Auswirkungen auf die blutflüssige Frau
- Interpretation der Wundergeschichte als Beispiel für Jesus als Heiler und die Bedeutung von Glauben und Vertrauen
- Didaktische Überlegungen zur Umsetzung der Wundergeschichte im Unterricht
- Methodische Ansätze zur Bearbeitung des Textes mit Schüler*innen
Zusammenfassung der Kapitel
Sachanalyse
Die Sachanalyse beschäftigt sich mit der Wundergeschichte der blutflüssigen Frau aus Markus 5,25-34 und untersucht die relevanten Hintergrundinformationen aus religionsgeschichtlicher Perspektive. Die Analyse betrachtet die Einordnung der Erzählung in die Gattung der Therapien, welche Heilungswunder ohne Kampf darstellen. Außerdem werden die Reinheitsvorschriften aus Levitikus 15,19-33, 18,19 und 20,18 beleuchtet, die die soziale Isolation der blutflüssigen Frau verdeutlichen.
Didaktische Analyse
Die Didaktische Analyse konzentriert sich auf die didaktische Umsetzung der Wundergeschichte im Unterricht. Sie beleuchtet verschiedene didaktische Ansätze, die sich für die Bearbeitung des Textes mit Schüler*innen eignen, und berücksichtigt die spezifischen Bedürfnisse und Interessen der Lernenden.
Methodische Analyse
Die Methodische Analyse stellt verschiedene methodische Ansätze vor, die sich für die Bearbeitung der Wundergeschichte im Unterricht eignen. Diese Ansätze dienen der Vertiefung des Textverständnisses und der Förderung der aktiven Auseinandersetzung der Schüler*innen mit der Geschichte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Wundergeschichte der blutflüssigen Frau aus Markus 5,25-34, die Reinheitsvorschriften im Levitikus, die soziale Isolation, die Bedeutung von Glauben und Vertrauen sowie die didaktische Umsetzung der Wundergeschichte im Unterricht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Botschaft der Heilung der blutflüssigen Frau (Mk 5,25-34)?
Die Geschichte betont die Bedeutung von Glauben und Vertrauen sowie Jesus' Fürsorge für gesellschaftlich ausgestoßene Menschen.
Warum war die Frau in der damaligen Zeit sozial isoliert?
Aufgrund der Reinheitsvorschriften im Levitikus galt sie wegen ihrer dauerhaften Blutungen als unrein, was jeglichen sozialen und religiösen Kontakt verhinderte.
Zu welcher Gattung gehört diese Wundererzählung?
Sie gehört zur Untergattung der Therapien (Heilungswunder), bei denen die Heilung durch die Kraftübertragung des Wundertäters erfolgt.
Welche didaktischen Methoden eignen sich für den Religionsunterricht?
Empfohlen werden die Arbeit mit Textquellen, Bildanalysen und Arbeitsbögen, die die Schüler zur Selbstreflexion über Glauben und Ausgrenzung anregen.
Warum wird eine eigene Übersetzung des griechischen Textes verwendet?
Um den Schülern durch eine einfache, klare Sprache den Zugang zum Originaltext zu erleichtern und die Details der Markuserzählung hervorzuheben.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2023, Das Wunder der blutflüssigen Frau und ihre Interpretation (Mk 5,25-34). Wundererzählungen und Selbstreflexion (10. Klasse Religion), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1400534