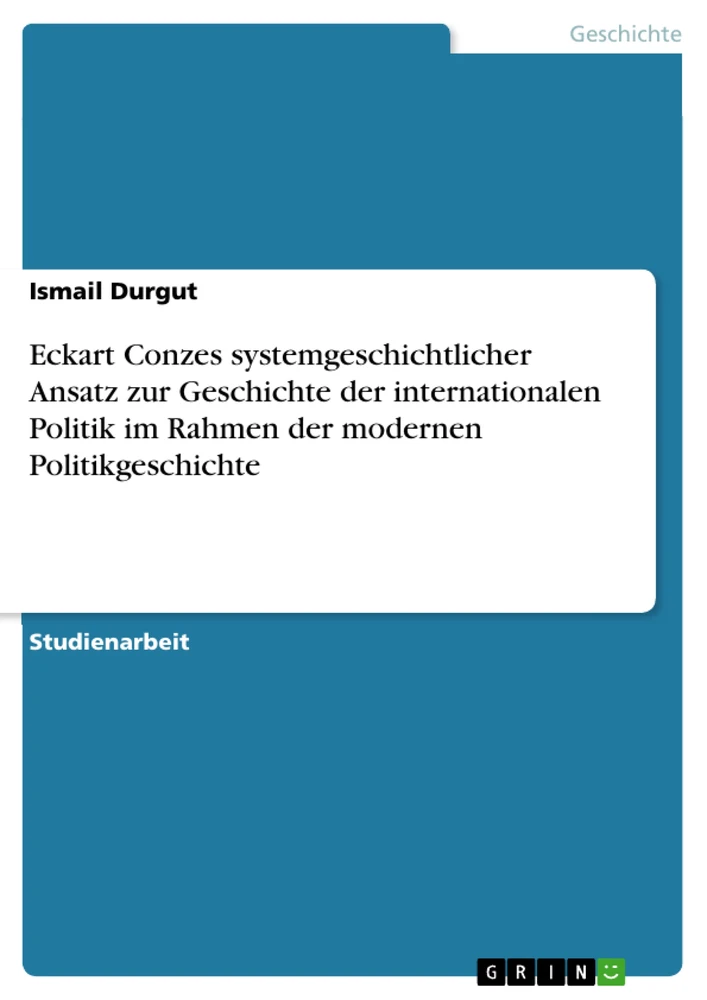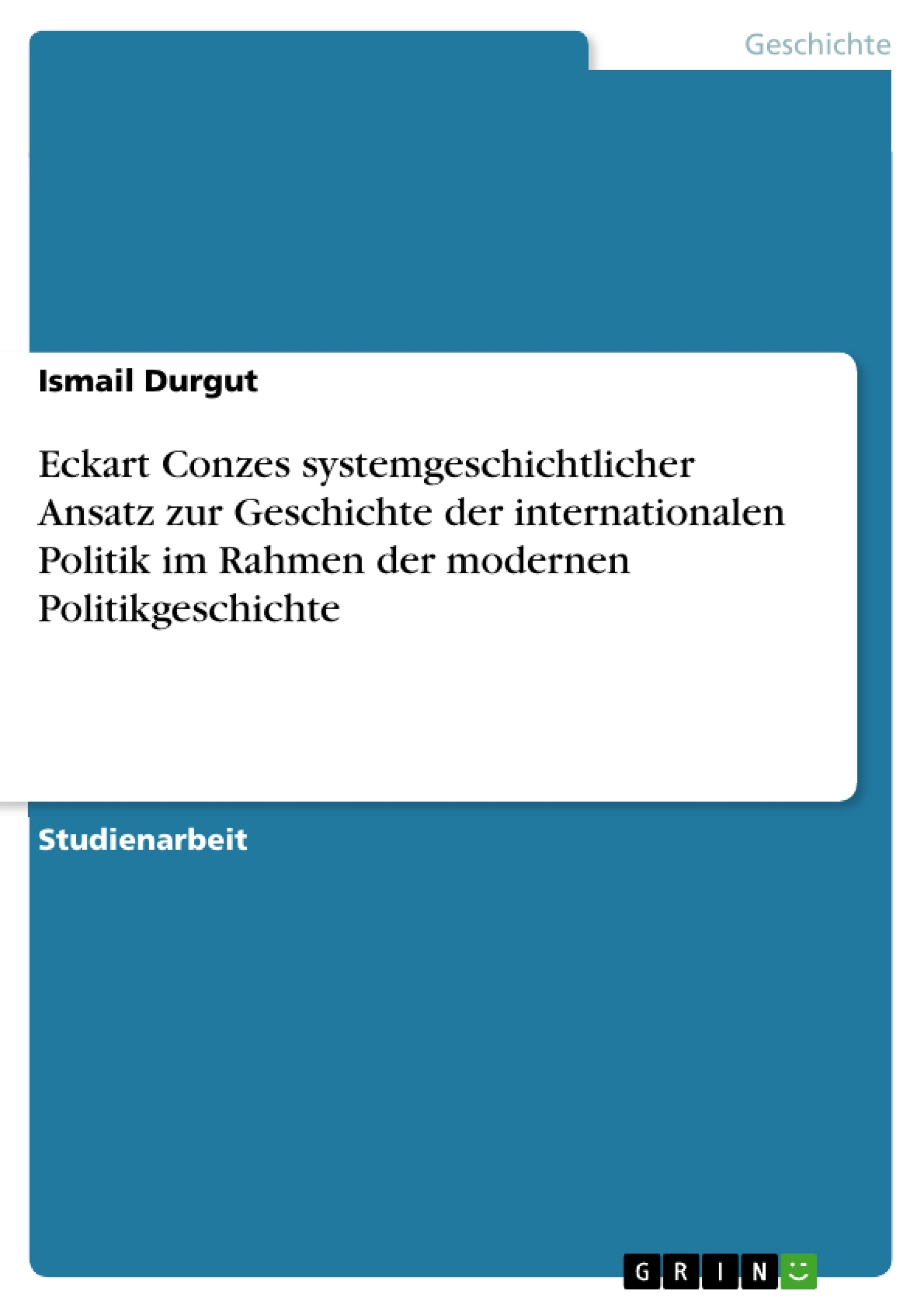[D]ie Historiographie der Internationalen Beziehungen [verfügt] über eine große Tradition, aber auch über beträchtliche methodische Innovationspotenziale [...] . Niederschlag findet dies unter anderem in einigen neuen großen Synthesen, die den Versuch unternehmen, die Geschichte des neuzeitlichen Mächtesystems neu zu schreiben. Und tatsächlich liegt eine große methodisch-wissenschaftliche Herausforderung darin, bei der Erforschung der Internationalen Beziehungen eine konsequente Systemperspektive einzunehmen.
Eckart Conze, ein Historiker der jüngeren Generation, stellt in seinem Aufsatz „Jenseits von Männern und Mächten - Geschichte der internationalen Politik als Systemgeschichte“ aus dem Sammelband Geschichte der Politik - Alte und neue Wege, herausgegeben von Hans-Christof Kraus und Thomas Nicklas, die Vorteile einer konsequent eingenommenen Systemperspektive für die Historiographie der internationalen Politik dar.
Sein Aufsatz gliedert sich in zwei Kapitel. Im ersten Kapitel legt Conze die theoretischen Thesen zu seinem Ansatz dar, um sie dann im zweiten Kapitel mit einem Beispiel empirisch abzusichern. Nach einer Einleitung, in der er die aktuelle Entwicklung innerhalb der Geschichte der Internationalen Beziehungen zusammenfasst, erklärt Conze dem Leser die Entwicklung von einer nationalen hin zu einer internationalen Perspektive innerhalb der Geschichte der internationalen Politik. Dem folgt die Definition eines internationalen Systems und seines Aufbaus. Im zweiten Kapitel führt Eckart Conze dann ein Beispiel für seinen methodischen Ansatz an, in dem er versucht den „Zusammenhang von Liberalismus, politischer Öffentlichkeit und dem Wandel des europäischen Staatensystems zwischen 1815 und 1871“ systemgeschichtlich zu veranschaulichen.
Die folgende Arbeit stellt einen Versuch dar, Conzes methodischen Ansatz in einem Kontext aktueller Entwicklungen innerhalb der Geschichtswissenschaft zu verorten. Schlagwörter wie „Neue“ Politikgeschichte, „Kulturgeschichte des Politischen“, transnationale Geschichte, „Internationalisierung“ beziehungsweise „Globalisierung“ der Geschichtswissenschaft, „Renaissance der Politikgeschichte“ und so weiter deuten darauf hin, dass sich in letzter Zeit, bezogen auf einen methodisch-wissenschaftlichen Kontext, einiges in Bewegung gesetzt haben muss. Inwieweit Eckart Conze mit seinem Ansatz diesem Trend folgt oder nicht, soll hier gezeigt werden...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die internationale Perspektive in der modernen Politikgeschichte
- ,,Neue\" Politikgeschichte
- Perspektiven in der „Neuen“ internationalen Politikgeschichte
- Die Geschichte der internationalen Politik als Systemgeschichte
- Aktuelle Entwicklung innerhalb der Geschichte der Internationalen Beziehungen
- Theoretische Thesen zum internationalen System
- Struktur des internationalen Systems
- Beispiel: Die Transformation des europäischen Staatensystems im 19. Jahrhundert
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert den systemgeschichtlichen Ansatz von Eckart Conze in Bezug auf die Geschichte der internationalen Politik und setzt ihn in den Kontext aktueller Entwicklungen innerhalb der Geschichtswissenschaft. Der Fokus liegt auf der Vermittlung der theoretischen Grundzüge des Ansatzes und seiner empirischen Illustration anhand eines historischen Beispiels.
- Die Entwicklung der "Neuen" Politikgeschichte
- Die Abkehr von der traditionellen Fokussierung auf Außenpolitik
- Die Bedeutung der Interdependenz von Innen- und Außenpolitik
- Die Anwendung der Systemtheorie auf die Geschichte der internationalen Politik
- Die Transformation des europäischen Staatensystems im 19. Jahrhundert als Beispiel für die systemgeschichtliche Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den aktuellen Stand der Historiographie der internationalen Beziehungen und hebt die methodischen Innovationspotenziale hervor. Sie stellt Eckart Conzes systemgeschichtlichen Ansatz vor, der die Vorteile einer konsequenten Systemperspektive für die Historiographie der internationalen Politik betont.
Das erste Kapitel erläutert die theoretischen Thesen zu Conzes Ansatz. Dabei wird die Entwicklung von einer nationalen hin zu einer internationalen Perspektive in der Geschichte der internationalen Politik aufgezeigt und die Definition eines internationalen Systems vorgestellt.
Das zweite Kapitel präsentiert ein Beispiel für Conzes methodischen Ansatz, indem er den Zusammenhang von Liberalismus, politischer Öffentlichkeit und dem Wandel des europäischen Staatensystems zwischen 1815 und 1871 systemgeschichtlich zu veranschaulichen versucht.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes sind „Neue“ Politikgeschichte, Systemgeschichte, internationale Politik, internationale Beziehungen, Wandel des europäischen Staatensystems, Liberalismus, politische Öffentlichkeit, Interdependenz von Innen- und Außenpolitik.
- Quote paper
- Ismail Durgut (Author), 2009, Eckart Conzes systemgeschichtlicher Ansatz zur Geschichte der internationalen Politik im Rahmen der modernen Politikgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139902