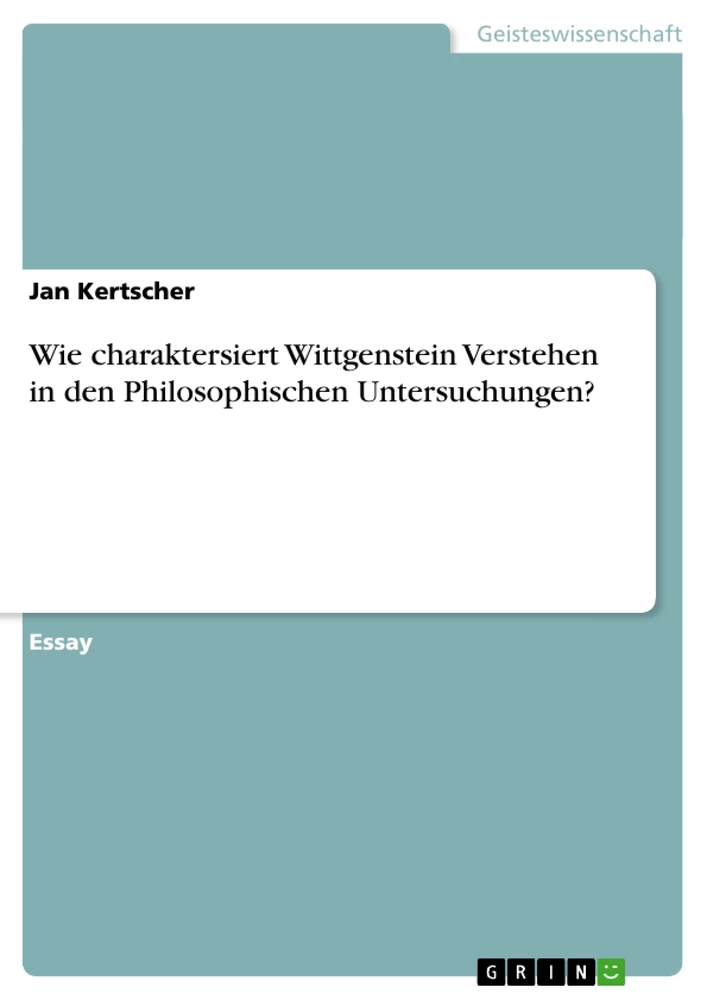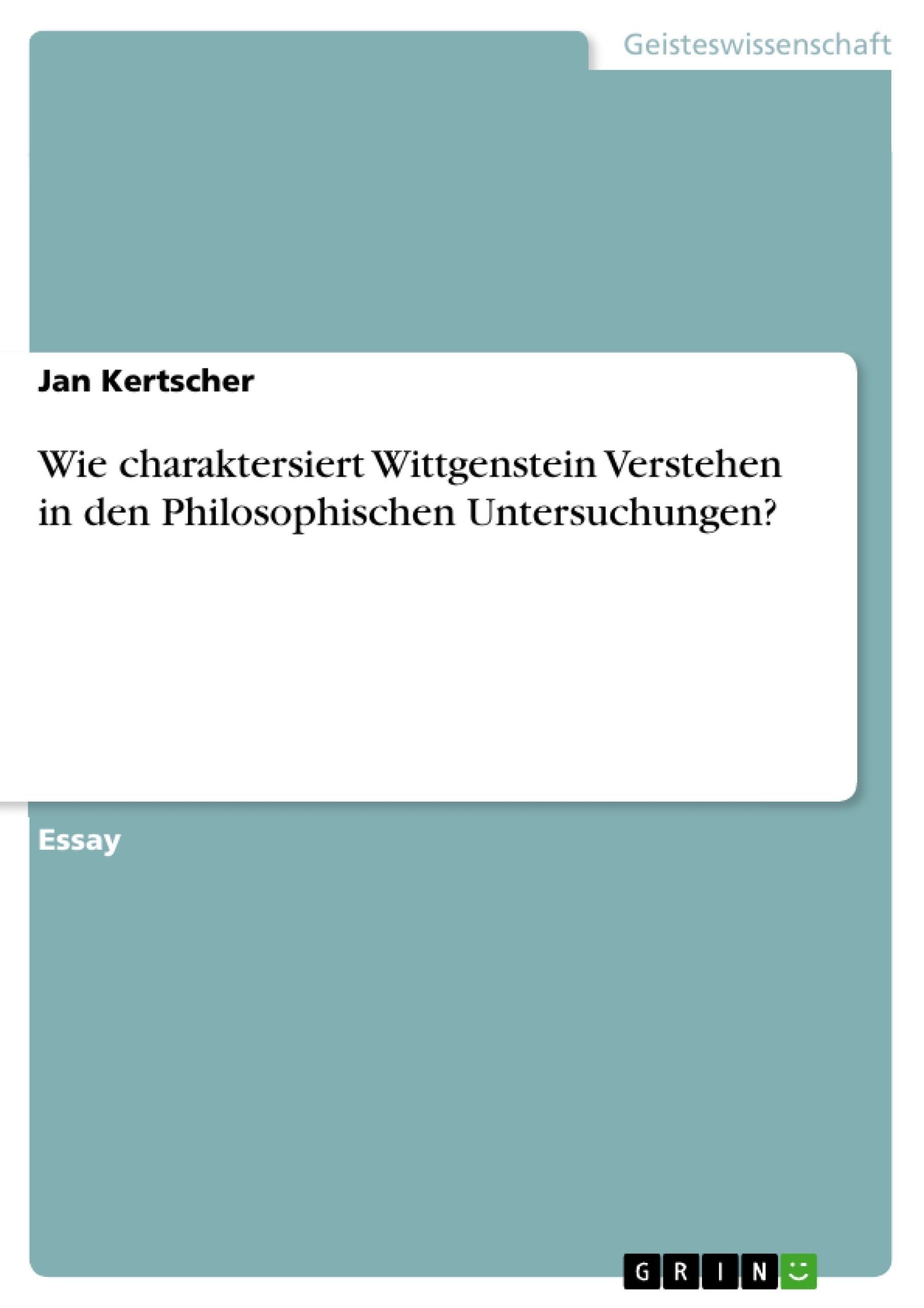Zuerst stellen sich folgende Fragen: Wieso bringt Wittgenstein das Regelfolgen mit
Verstehen in Beziehung? Was ist eine Regel und was bedeutet es, einer Regel zu folgen?
Nachfolgend möchte ich versuchen, die Ausführungen Ludwig Wittgensteins in der 6.
Vorlesung im Michaelistrimester 1934, mit mir erscheinenden Kernaussagen
zusammenfassen: „Bring mir etwas von dieser Farbe!“ wirft die Frage auf, falls z.B. ein
blaues Farbmuster gezeigt wurde, was wohl mit diesem Muster übereinstimmen könnte?
Wittgenstein führt einige Beispiele an: „Der Befehl ließe sich dadurch erfüllen, dass man
irgendeinen blauen Gegenstand bringt, oder dadurch, dass man etwas bringt, was hübsch
aussieht, wenn man es neben das Muster hält. Wir erwarten, dass jeder Begriff Fühler oder
Affinitäten aufweist, so dass er vorherbestimmt, was ihm entspricht.“1 Schlussendlich
kommt Wittgenstein zu der Auffassung, dass es eine „Regel der Verwendung des Wortes
„Übereinstimmung“2 gibt. Übereinstimmung des Farbmusters mit der Farbe des
Gegenstandes, wäre dann die Regel, die lautet: „Dies ist es, was ich „blau“ nenne. Es ist
eine Regel der Verwendung des Symbols. [„Das Symbol vertritt das von ihm
Repräsentierte sinnbildhaft und ermöglicht so erst ... die sinnliche Wahrnehmbarkeit
abstrakter Ideen oder geistiger Inhalte.“3 J.K.] [...]
1 Wittgenstein, Ludwig, Vorlesungen 1930-1935, (stw 865), Frankfurt a. M.; Suhrkamp, 1984, S. 254.
2 ebd.
3 Metzler-Philosophie-Lexikon, Stuttgart, Metzler-Verlag, 1999, S. 579.
Inhaltsverzeichnis
- Wie charakterisiert Wittgenstein Verstehen in den Philosophischen Untersuchungen?
- Zuerst stellen sich folgende Fragen: Wieso bringt Wittgenstein das Regelfolgen mit Verstehen in Beziehung? Was ist eine Regel und was bedeutet es, einer Regel zu folgen?
- Nachfolgend möchte ich versuchen, die Ausführungen Ludwig Wittgensteins in der 6. Vorlesung im Michaelistrimester 1934, mit mir zusammenfassen: „Bring mir etwas von dieser Farbe!\" wirft die Frage auf, falls z.B. ein blaues Farbmuster gezeigt wurde, was wohl mit diesem Muster übereinstimmen könnte?
- Das Entscheidende dieser Aussagen ist, dass es keine Verwendung gibt die dem allgemeinen Begriff implizit ist, so dass er jederzeit und an jedem Ort, eben für diese spezielle Verwendung in die Pflicht genommen werden könnte.
- Ins Auge fällt hier, die Überlegung Wittgensteins, bzgl. der Projektionsmethoden in §139 PU. Hier stellt Wittgenstein in Frage, dass es nicht möglich ist, ein Vorstellungsbild eines (allgemeinen) Begriffes, wie das von einem Würfel, einwandfrei geben zu können.
- Genauso verhält es sich mit den Regeln. Auch sie sind nicht, wie Wittgenstein meint, von irgendjemanden festgelegt und bilden somit keinen fortwährenden, dauerhaften Mechanismus.
- Das Regelfolgen wäre dann nichts anderes, als der, im voraus für den Begriff gesetzten Regel, den Anwendungshorizont zu geben.
- Aus Vorgenanntem lässt sich ermitteln, dass vorerst der Zusammenhang zwischen Verstehen und dem Regelfolgen m. E. in den von Wittgenstein angeführten Argumenten des vermeintlichen Opponenten zu finden ist.
- Der Opponent, der als Vertreter des philosophischen Common-Sense gesehen werden kann, wird durch Wittgensteins Argumente in die Enge geführt.
- Wie könnte also das bisher Gesagte sozusagen „dingfest(er)“ gemacht werden? Es bedürfte einer Klärung des Verstehens.
- Nämlich, dass die Anwendung der Regeln (Regeln sind, wie festgehalten, konstitutive Elemente von „Begriffsanwendungen“; wohlgemerkt sind sie dabei nicht in einem normativen Gebrauch!) ein Kriterium des Verständnisses bleibt.
- Ist nun Verstehen ausschließlich seelischer Vorgang? Wittgenstein würde verneinen.
- Falls es ,,seelische Vorgänge“ wären, so müsste zumindest das Erinnerungsvermögen, als Teil des Geistes, zu jeder Zeit an jedem Ort helfen.
- Es wäre für die alltägliche Auffassung normal, wenn das Vollendete in der Vergangenheit, das sozusagen „verstand“, Grund für irgendetwas in der Gegenwart auf Antwort drängende, hilfreich wäre.
- Im §179 PU meint Wittgenstein, dass es, bzgl. des Beispiels aus §151 PU nämlich keine solche begleitenden Erlebnisse gibt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert Wittgensteins Philosophie des Verstehens in seinen "Philosophischen Untersuchungen". Er untersucht die Beziehung zwischen dem Regelfolgen und dem Verstehen eines Begriffs, insbesondere im Kontext der sogenannten "Übereinstimmungstheorie".
- Die Rolle von Regeln und deren konstitutive Funktion für die Anwendung von Begriffen
- Die Kritik an der Vorstellung einer "unsichtbaren Hand" bei der Anwendung von Begriffen und Regeln
- Die Bedeutung von Projektionsmethoden und ihre Implikationen für die Verwendung von Begriffen
- Die Abgrenzung psychologischer Elemente von logischen Regeln in Bezug auf das Verstehen
- Die Abkehr von einer "Übereinstimmungstheorie" und die Heraushebung der Bedeutung von Umstände und deren Einfluss auf das Verstehen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text untersucht zunächst die Beziehung zwischen dem Regelfolgen und dem Verstehen eines Begriffs. Wittgenstein argumentiert, dass Regeln nicht nur die Anwendung von Begriffen bestimmen, sondern sie konstituieren. Er kritisiert die Vorstellung, dass es eine "unsichtbare Hand" gibt, die die Anwendung von Begriffen und Regeln steuert, und betont, dass die Anwendung von Regeln von Umständen und nicht von seelischen Vorgängen bestimmt wird. Der Text stellt fest, dass es keine feste Regel oder ein vorgegebenes Vorstellungsbild gibt, das die Anwendung eines Begriffs eindeutig festlegt. Stattdessen betont er die Bedeutung von Projektionsmethoden und ihre Auswirkungen auf die Verwendung von Begriffen.
Der Text untersucht außerdem die Trennung psychologischer Elemente von logischen Regeln. Wittgenstein argumentiert, dass psychologische Erkenntnisse keine logischen Regeln ersetzen können, da sie unterschiedliche Aspekte des Verstehens betreffen. Er kritisiert die Vorstellung, dass das Verstehen auf seelischen Vorgängen basiert, und argumentiert, dass das Verstehen in erster Linie durch Umstände und nicht durch Erinnerungen oder mentale Prozesse bestimmt wird. Der Text betont, dass das Verstehen keine rein mentale Angelegenheit ist, sondern in der Anwendung von Regeln in konkreten Situationen wurzelt.
Schlüsselwörter
Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Verstehen, Regel, Regelfolgen, Übereinstimmungstheorie, Begriff, Anwendung, Projektionsmethode, Umstände, psychologischer Zwang, seelische Vorgänge.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Verstehen und Regelfolgen bei Wittgenstein zusammen?
Wittgenstein argumentiert, dass Verstehen kein rein innerer seelischer Vorgang ist, sondern sich in der korrekten Anwendung von Regeln in der Praxis zeigt.
Ist Verstehen ein "seelischer Vorgang"?
Wittgenstein verneint dies in den Philosophischen Untersuchungen. Verstehen ist eher ein Können oder eine Beherrschung einer Technik als ein begleitendes Erlebnis.
Was bedeutet "Übereinstimmung" bei der Verwendung von Symbolen?
Übereinstimmung ist keine metaphysische Tatsache, sondern eine Regel der Verwendung eines Zeichens innerhalb einer Sprachgemeinschaft.
Was kritisiert Wittgenstein an der Vorstellung von Projektionsmethoden?
Er bezweifelt, dass ein Vorstellungsbild (wie das eines Würfels) die Anwendung eines Begriffs eindeutig festlegen kann, da das Bild selbst wieder verschieden gedeutet werden kann.
Welche Rolle spielen die Umstände für das Verstehen?
Das Verstehen wurzelt in den konkreten Umständen und dem Kontext der Anwendung, nicht in einem dauerhaften Mechanismus im Geist.
- Citar trabajo
- Jan Kertscher (Autor), 2003, Wie charaktersiert Wittgenstein Verstehen in den Philosophischen Untersuchungen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13973