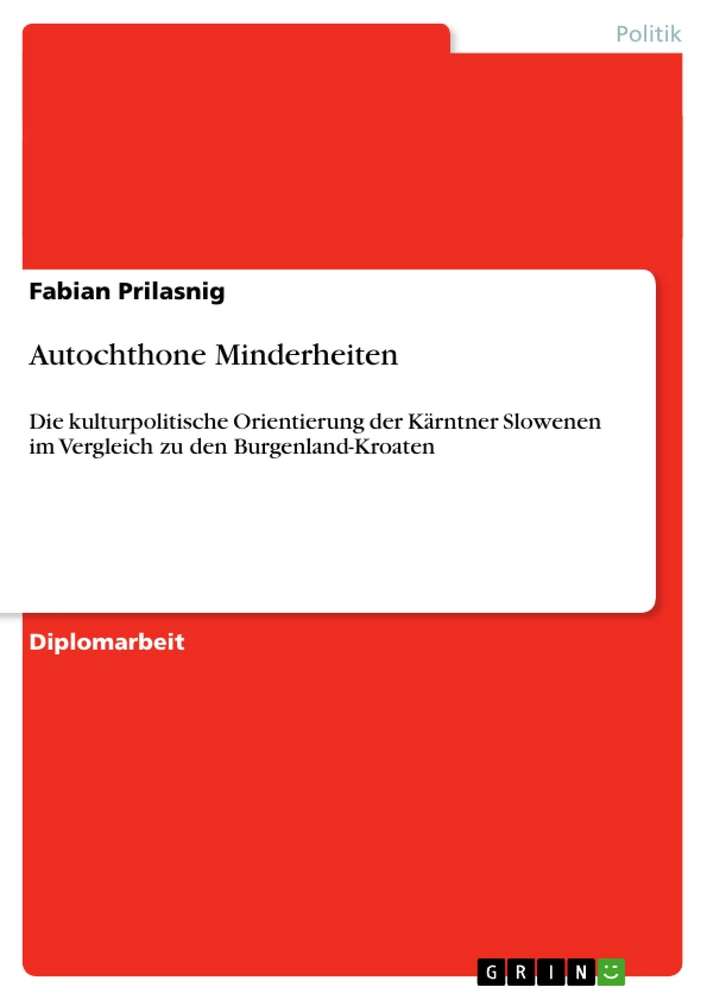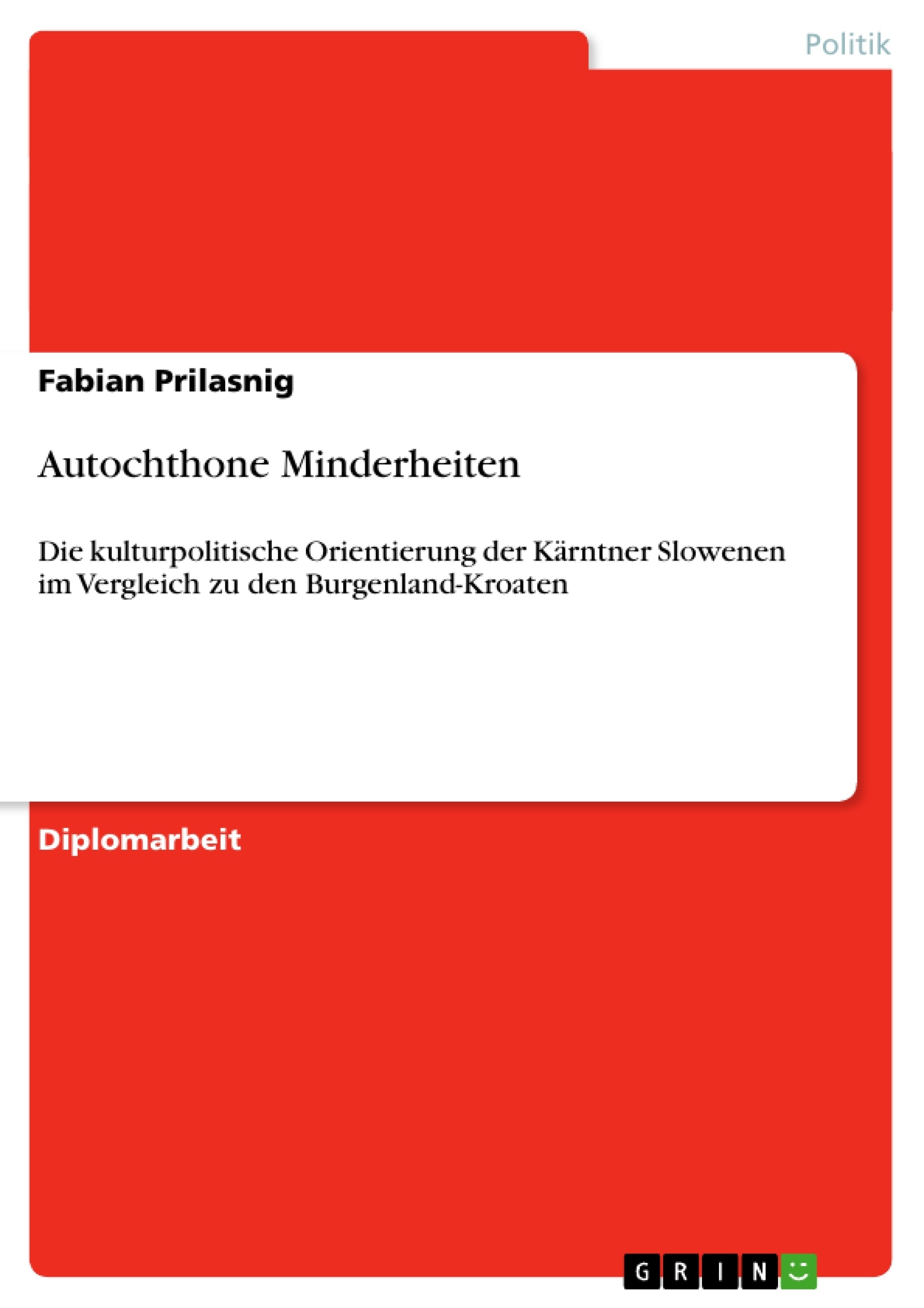Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist eine vergleichende Analyse der soziokulturellen und kulturpolitischen Situation der autochthonen Minderheiten in Kärnten und im Burgenland. Die ersten beiden Kapitel sind der Kulturgeschichte der Burgenland-Kroaten sowie der slowenischen Minderheiten mit dem Fokus auf die Kärntner Slowenen gewidmet. Im dritten Kapitel werden Minderheitenbestimmungen im Allgemeinen beschrieben. Im Speziellen wird auf Artikel 7 des Staatsvertrages vom Jahre 1955 und dessen Umsetzung in der Praxis eingegangen. Das vierte Kapitel stellt aus verschiedenen Sichtweisen die soziokulturelle und kulturpolitische Situation der slowenischen und der kroatischen Volksgruppe von der jüngsten Vergangenheit bis zur Gegenwart dar. Das Hauptaugenmerk wird auf die aktuelle kulturpolitische Orientierung beider Volksgruppen gelegt. Die vergleichende Interpretation zur kulturpolitischen Orientierung beider Volksgruppen basiert auf Fragebogenauswertungen und Interviews repräsentativer Personen verschiedener Kulturorganisationen.
Inhaltsverzeichnis
Abstract
0. Vorwort
1. Einleitung
2. Zur Geschichte und Entstehung der slowenischen Minderheiten
2.1 Exkurs
2.2 Von den Anfängen bis zum Zerfall der Donaumonarchie
2.3 Die Zeit nach dem Zerfall der Donaumonarchie
2.3.1 Vom Vielvölkerstaat zum Nationalstaat
2.3.2 Die Entstehung der Ersten Republik
2.3.3 Der Kärntner Abwehrkampf
2.4 Die Zwischenkriegszeit
2.4.1 Die Kärntner Slowenen in der Ersten Republik
2.4.2 Die Slowenen im SHS-Staat
2.4.3 Die Slowenen des Küstenlandes
2.5 Die Zeit unter nationalsozialistischer Herrschaft
2.5.1 Die Situation der Kärntner Slowenen
2.5.2 Die Situation in Slowenien
2.6 Die Nachkriegszeit
2.6.1 Die Kärntner Slowenen in der Zweiten Republik
2.6.2 Die Slowenen im kommunistischen Jugoslawien
2.6.3 Die Slowenen in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien
3. Zur Geschichte der Burgenland-Kroaten
3.1 Herkunft und Ansiedlung
3.1.1 Die Voraussetzungen und Ursachen der Auswanderung
3.1.2 Die Ansiedlung der Kroaten
3.2 Die Kroaten im burgenländisch-westungarischen Raum bis 1918
3.3 Die Kroaten im Burgenland von 1918 bis 1945
3.4 Die Kroaten im Burgenland nach dem Zweiten Weltkrieg
3.5 Die Burgenland-Kroaten in Ungarn
4. Zur Bedeutung des Staatsvertrages von 1955 für beide Minderheiten
4.1 Der Weg zum Staatsvertrag
4.2 Grundsätze über Minderheitenschutz
4.3 Der Artikel 7 des Staatsvertrages
4.4 Die Entwicklung nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages
4.4.1 Die Situation der Kärntner Slowenen
4.4.2 Die Situation der Burgenland-Kroaten
4.4.3 Das Volksgruppengesetz 1976
4.4.4 Darstellung des Schulwesens in Südkärnten
4.4.5 Darstellung des Schulwesens im Burgenland
5. Zur soziokulturellen und kulturpolitischen Situation beider Minderheiten
5.1 Zur Situation aus sprachwissenschaftlicher Sicht
5.1.1 Sprachrechtliche Lage
5.1.2 Soziolinguistische Lage
5.1.3 Wege zur Erhaltung der Sprache
5.2 Zur Situation aus kulturwissenschaftlicher Sicht
5.2.1 Kulturgeschichtlicher Hintergrund
5.2.2 Kulturelle Aktivitäten
5.3 Zur Situation aus literaturwissenschaftlicher Sicht
5.3.1 Literatur und Kunst der Kärntner Slowenen
5.3.2 Literatur und Kunst der Burgenland-Kroaten
5.4 Zur Situation aus kulturpolitischer Sicht
5.4.1 Aktuelle Situation
5.4.2 Fragebogenauswertung zur Situation in Kärnten
5.4.3 Fragebogenauswertung zur Situation im Burgenland
5.4.4 Interpretation zur kulturpolitischen Orientierung beider Volksgruppen
5.5 Zur Zukunft beider Volksgruppen
5.5.1 Die Assimilationstendenz der kroatischen Volksgruppe
5.5.2 Die Assimilationstendenz der slowenischen Volksgruppe
6. Zusammenfassung
7. Nachwort
8. Literaturverzeichnis
Abstract
Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist eine vergleichende Analyse der soziokulturellen und kulturpolitischen Situation der autochthonen Minderheiten in Kärnten und im Burgenland. Die ersten beiden Kapitel sind der Kulturgeschichte der Burgenland- Kroaten sowie der slowenischen Minderheiten mit dem Fokus auf die Kärntner Slowenen gewidmet. Im dritten Kapitel werden Minderheitenbestimmungen im Allgemeinen beschrieben. Im Speziellen wird auf Artikel 7 des Staatsvertrages vom Jahre 1955 und dessen Umsetzung in der Praxis eingegangen. Das vierte Kapitel stellt aus verschiedenen Sichtweisen die soziokulturelle und kulturpolitische Situation der slowenischen und der kroatischen Volksgruppe von der jüngsten Vergangenheit bis zur Gegenwart dar. Das Hauptaugenmerk wird auf die aktuelle kulturpolitische Orientierung beider Volksgruppen gelegt. Die vergleichende Interpretation zur kulturpolitischen Orientierung beider Volksgruppen basiert auf Fragebogenauswertungen und Interviews repräsentativer Personen verschiedener Kulturorganisationen.
V pričujoči diplomski nalogi se posvečam slovenski manjšini na Koroškem in hrvaški na Gradiščanskem.
V prvem poglavju povzemam zgodovino Slovencev od začetkov do danes. Obravnavam nastanek Karantanije, razvoj slovenske kulture za časa reformacije, protireformacije in razsvetljenstva ter prvo in tudi drugo svetovno vojno. Sledi pregled zgodovine gradiščanskih Hrvatov od naselitve na začetku 16. stoletja do danes. Navajam vzroke za naselitev na Gradiščanskem, razvoj hrvaške kulture v ogrskem kraljestvu, razpad avstro-ogrske monarhije ter prvo in tudi drugo svetovno vojno. V tretjem poglavju obravnavam avstrijsko drŽavno pogodbo iz leta 1955. Osredotočam se na člen 7, v katerem so zapisane pravice obeh avtohtonih manjšin v Avstriji. V četrtem poglavju opisujem trenutni poloŽaj obeh narodnih skupnosti z jezikoslovnega, kulturnega, literarnega in političnega vidika. Prav tako razmišljam o prihodnosti obeh manjšin.
Diplomsko nalogo zaključujem z opisom rabe slovenskega jezika na Koroškem in hrvaškega na Gradiščanskem ter obravnavam vprašanje soŽitja med manjšinskim in večinskim narodom.
0. Vorwort
Autochthone Minderheiten leben seit jeher an Ort und Stelle, d.h. sie sind eine in ihrem Siedlungsgebiet angestammte Volksgruppe, die hier schon seit Jahrhunderten ihre Existenzgrundlage hat wie z.B. die Kärntner Slowenen oder die Burgenland-Kroaten. Allochthone Minderheiten sind im Gegensatz dazu Volksgruppen, die sich aufgrund von Auswanderung in den letzten Jahrzehnten in einem bestimmten Gebiet angesiedelt haben wie z.B. die Kurden aus der Türkei, Bosnier/Kroaten/Serben aus dem ehemaligen Jugoslawien oder aktuell die Tschetschenen aus der russischen Föderation.
Die Sprache der Kärntner Slowenen nimmt wahrlich keinen derart geringen Funktionswert ein, wie es den Kärntnern noch immer vermittelt wird, sondern stellt für den österreichischen Staat und das Land Kärnten einen unschätzbaren Wert dar, nämlich die Brückenfunktion zwischen dem deutschsprachigen Teil und dem slawischen Teil Europas. Daher darf das Motto nur lauten, die slowenische Sprache am Leben zu erhalten, wie es auch der Journalist Mirko Bogataj in seinem neu erschienen Buch über die Kärntner Slowenen auf den Punkt bringt: ÄDenn durch sie lebt die Volksgruppe und ihre Kultur. Stirbt die Sprache, dann stirbt auch die Volksgruppe“ [Bogataj 2008, 431].
Während meines Aufenthaltes in Ljubljana, Sommer 2001, begann ich mich bewusst mit meinen slowenischen Wurzeln zu beschäftigen und Gedichte in slowenischer Sprache, die Sprache meiner Vorfahren, zu verfassen. Dabei entstand folgendes Gedicht mit dem Titel Življenje, das in seiner Ämelancholischen“ Art und Weise als ÄSymbol“ für den Kampf beider autochthonen Minderheiten für ihre im Staatsvertrag 1955 verbrieften Rechte gesehen werden kann. Es soll den Ähberlebenskampf“ (Življenje bedeutet Leben) sowohl der slowenischen Volksgruppe in Kärnten als auch der kroatischen im Burgenland charakterisieren:
Življenje je darilo narave,
zdi se mi, da ni nič narobe. Čas celi vse rane,
vedno je rešilna pot iz bolečine,
samo se ne sme obupati nad svojimi napakami, da se lahko Živi brez boli.
Življenje je kriŽev pot, zdi se mi kot samoten kot brez pomoči drugega človeka, samo si lahko da svetovati, ampak brez vsakršnih garancij, da bo pot Življenja znosnejša.
Pot Življenja je raznolična,
na kateri se spozna veliko različnih ljudi. Na vsakem vogalu čaka nova izkušnja, iz katere se lahko doseŽe veliko ugodnosti,
ki naj bi se jih pa izkoristilo,
da ne bi Življenje vodilo v samoobtoŽbo.
Pot Življenja je samotna,
po kateri vsak človek mora iti.
Veliko posebnosti se sreča na tej poti:
sovraštvo in ljubezen, ravnodušnost in strast, obup in veselje. Življenski nagon skrbi, da ne bo nihče naveličan Življenja, in rešitelj Življenja kliče do dna duše: ÄŽivljenje je trpljenje!“
ÄŽivljenje je odrekanje“, vzdihuje človeška duša, ki je iz treh delov sestavljena:
iz tega, ki čustvuje močno ganjeno zmede celega človeštva,
iz tistega, ki uboga strogo pamet posameznega človeka,
in iz onega, ki prikrije nevedno zavest vsakega človeka, ker ve, da vsak človek mora nezadrŽeno iti nasproti svoji usodi Življenja.
Ich möchte mich bei allen meinen Informanten bedanken, dass sie mir meine Fragen nach besten Gewissen zu beantworten und ihre Sichtweise zu vermitteln versucht haben. Ein Dankeschön darf ich auch dem Schreibcenter der Alpen-Adria Universität Klagenfurt übermitteln, wo ich mit meinen Fragen in Bezug auf wissenschaftliches Schreiben und stilistischer Gestaltung dieser Arbeit immer auf Äoffene Ohren“ gestoßen bin.
1. Einleitung
Am 10. Oktober jedes Jahres gedenkt man in Kärnten der Wiederkehr der Volksabstimmung vom Jahre 1920. Dieser Volksabstimmung sind fast zwei Jahre Besetzung durch serbische Verbände und kriegerische Auseinandersetzungen vorhergegangen. Sie wurde im Rahmen der Friedensverhandlungen von St. Germain für das gemischtsprachige Gebiet Unterkärntens unter dem Eindruck der Kämpfe und dem Besuch des späteren Abstimmungsgebietes durch die sog. Miles- Mission vereinbart. Diese Entscheidung war auch im Sinne des von Präsident Wilson zur Grundlage seiner Friedenspläne erhobenen Selbstbestimmungsrechtes der Völker. Ohne Abstimmung wurden das Mießtal und die Gemeinde Seeland/Jezersko an den SHS-Staat (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca) abgetreten und das zweisprachige Kanaltal an Italien. Im südöstlichen Kärnten wurden zwei Abstimmungszonen eingerichtet: In der Zone A (beinahe das gesamte gemischtsprachige Gebiet Südkärntens) wurde zuerst abgestimmt, und wäre das Ergebnis zugunsten des südslawischen Staates ausgefallen, wäre auch anschließend in der Zone B (Klagenfurt, Maria Saal, Pörtschach, Velden) abgestimmt worden [vgl. Pohl 2000, 7].
Diese Abstimmung am 10. Oktober war formal nicht zwischen deutsch und slowenisch, sondern zwischen Österreich und dem von Serbien dominierten SHS- Königreich, d.h. Erhaltung der Landeseinheit oder Teilung des Landes. Unter Berücksichtigung der Daten der Volkszählung 1910, bei der 69% der Bevölkerung Südkärntens Slowenisch und 31% Deutsch als Umgangssprache angegeben hatten, müssen neben den rund 31% Deutschsprachigen noch etwa 28% Slowenischsprachige für Österreich gestimmt haben. Das sind ungefähr 40% jener, die sich bei der Volkszählung 1910 zum sog. Slowenentum bekannt haben; d.h. fast jeder zweite. Das Volksabstimmungsergebnis war bei den Kärntner Slowenen1 somit ein Akt der Vernunft über die nationalen Leidenschaften, die im Laufe des Auseinanderbrechens der Monarchie Österreich-Ungarn entstanden. Für einen Teil der slowenischen Bevölkerung Südkärntens schien der Verbleib in einem ungeteilten Kärnten mit freiem Zugang zu den Wirtschaftszentren Klagenfurt und Villach attraktiver zu sein, als ein Randgebiet des unter serbischer Vorherrschaft stehenden südslawischen Staates zu werden [vgl. Pohl 2000, 8].
Auch bei den Slowenen südlich der Karawanken hielt sich die Begeisterung über die Gründung des SHS-Königreiches in Grenzen, da dieser neugebildete südslawische Staat unter serbischer Dominanz stand. Jedoch kann Ädie Frage, was wäre gewesen, wenn die befragte Bevölkerung zwischen Österreich, dem ‚deutschen Reststaat‘ der alten Monarchie, und einem unabhängigen ‚Freistaat Slowenien‘ (analog zur heutigen Republik Slowenien) zu entscheiden gehabt hätte, nicht eindeutig beantwortet werden. Aber auch den übrigen Slowenen war es nicht vergönnt, in einem Staat vereint zu sein: der Westen des slowenischen Sprachgebietes war an Italien gefallen (Resia-Tal, Görz, Nordistrien, Isonzotal, Hinterland von Triest)“ [Pohl 2000, 8].
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zur Ausbildung eines slowenisch- nationalen Bewusstseins und es entstand der Gedanke, alle slowenischen Länder im Rahmen der Monarchie verwaltungsmäßig zusammenzufassen, aber dies hätte eine Teilung des Landes Kärnten bedeutet, der sich selbst führende Politiker der Kärntner Slowenen widersetzten. Auch das Pflichtschulwesen mit slowenischer Unterrichtssprache wurde im Jahre 1869 neu organisiert und es bildeten sich unter den Kärntner Slowenen gegen Ende des 19. Jahrhunderts zwei Lager aus; ein nationales und ein deutschfreundliches. Die slowenischsprachige Minderheit war somit in zwei Lager gespalten, wobei das erstere am 10. Oktober für den SHS- Staat, das letztere für Österreich gestimmt haben dürfte. Die deutschfreundlichen Slowenen wurden als Windische bezeichnet, die seit den 1920er-Jahren seitens der Politik als eine eigene Volksgruppe eingestuft wurden. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht sind sie eindeutig Slowenen, die sich vor allem politisch nicht zum slowenischen Volkstum bekennen. Unterschiede zwischen beiden Lagern ergeben sich nur durch die Kenntnis der slowenischen Schriftsprache, die jenen Personen fehlt, die keinen Schulunterricht auf Slowenisch erhalten haben [vgl. Pohl 2000, 9]. Für die Burgenland-Kroaten hingegen war das wichtigste Ereignis der Nachkriegszeit die Unterzeichnung des Österreichischen Staatsvertrages am 15. Mai 1955 in Wien. Durch die Eingliederung des Burgenlandes in Österreich im Jahre 1921 und die dadurch bewirkte Umorientierung auf die neuen Verhältnisse dauerte es relativ lange, bis sich die kroatische Volksgruppe formierte und eine organisierte Tätigkeit für die Erhaltung und Entfaltung ihres Volkstums entwickelte.
In der ersten Jahreshälfte 1949 kam es bei der Friedenskonferenz in Paris zu einer Übereinstimmung der Siegermächte in der Minderheitenfrage, die durch entsprechende vorhergehende Erklärungen des Bundespräsidenten Dr. Renner und des Außenministers Dr. Gruber ermöglicht wurde. So meinte Renner, er könne im Sinne aller Österreicher erklären, dass die Verträge über den Minderheitenschutz und alle in ihm enthaltenen Rechte der Minderheiten den Österreichern heilig seien und auch bleiben würden. Bei der Debatte über die Ratifizierung des Staatsvertrages sagte der damalige Bundeskanzler Julius Raab im Parlament, dass man, wenn man den Staatsvertrag gut hieße, auch jeden einzelnen Artikel dieses Vertrages gutheißen und durchführen müsse, somit auch den Artikel 7 [vgl. Müller 1986, 348f].
In der Diskussion um den Artikel 7 des Österreichischen Staatsvertrages wird beinahe übersehen, dass wesentliche Grundsätze eines Volksgruppenrechtes und damit auch eines Minderheitenschutzes schon im Artikel 19 des österreichischen Staatsgrundgesetzes aus dem Jahre 1867 und in den Artikeln 62-69 des Friedensvertrages von St. Germain enthalten sind. Abschließend ergibt sich im Hinblick auf den nunmehr geltenden Artikel 7 des Staatsvertrages von 1955 die Frage, ob und in welchem Ausmaß die Bestimmungen des Friedenvertrages von St. Germain (Artikel 62-69) sowohl für die Burgenland-Kroaten als auch für die Kärntner Slowenen noch relevant und anwendbar sind, vor allem für jene Fragen, die im Artikel 7 nicht geregelt sind [vgl. Müller 1986, 345-348].
Die ersten beiden Kapitel geben einen Überblick der Kulturgeschichte beider autochthoner2 Minderheiten, der kroatischen im Burgenland sowie der slowenischen in Kärnten, wobei auch auf die autochthonen slowenischen Minderheiten in Italien eingegangen wird. Das dritte Kapitel geht auf den Artikel 7 des Staatsvertrages aus dem Jahre 1955 und deren Umsetzung in der Praxis ein. Das vierte Kapitel beleuchtet aus verschiedenen Blickwinkeln die soziokulturelle und kulturpolitische Situation sowohl der slowenischen als auch der kroatischen Volksgruppe von der jüngsten Vergangenheit bis zur Gegenwart. Die vergleichende Interpretation zur kulturpolitischen Orientierung basiert auf den Fragebogenauswertungen und Interviews repräsentativer Persönlichkeiten verschiedener Kulturorganisationen. Im Anhang sind die Fragebögen zur Situation Kärntens und des Burgenlandes aufgelistet und alle Informanten werden anonym genannt.
2. Zur Geschichte und Entstehung der slowenischen Minderheiten
2.1 Exkurs
Einleitend zur Geschichte der Slowenen wird ein Einblick in die Problematik der Verbindung zwischen Sprache und Volkstumszugehörigkeit (bzw. Nationalität) aus der kulturgeschichtlichen Entwicklung des sog. Slowenentums in Kärnten heraus zu geben versucht. Das friedliche Zusammenleben der Deutsch-Kärntner und der Slowenisch-Kärntner hatte in der Geschichte solange funktioniert, bis die Politik direkten Einfluss auf die Kultur und somit auf die Sprache auszuüben begann. Mit der Verknüpfung des Begriffes Nationalität und Sprache änderte sich die politische Situation in Kärnten schlagartig. Der Zwang, sich zur Nation zu bekennen, ging auf Kosten der Sprache, was sich durch einen drastischen Sprachwechsel zeigte. Die Sprache ist ein potentielles Erbgut, das nicht angeboren ist, sondern erlernt werden muss, und hat daher keine direkte Beziehung zum Volkstum, dem man aufgrund seiner Vorfahren angehört. Passend zu diesen sollen die folgenden Gedanken zum Nachdenken über die Geschichte, deren Ereignisse, Fakten und Auswirkungen auf die aktuelle sprachliche Situation in Kärnten anregen [Pohl 2000, 117]:
ÄNicht historische Bauwerke wie die Burg Hochosterwitz, Denkmäler wie der Herzogstuhl auf dem Zollfeld oder Ausgrabungen wie auf dem Magdalensberg sind unser ältestes kulturelles Erbe, sondern unsere Sprache, die wir von unserer Elterngeneration vermittelt bekommen haben und die wir unseren Nachkommen weitergeben, wie dies schon einige hundert Generationen vor uns getan haben. Die Fähigkeit mit ‚Sprache‘ umzugehen, zu kommunizieren, ist dem Menschen angeboren und gehört zu seinem biologischen Programm, trotzdem ist aber jede Einzelsprache im Kindesalter zu erlernen, sie ist kein genetisches, vielmehr soziokulturelles Erbe. Ein Teil dieses Vermögens in einem weiteren Sinne ist auch unsere Muttersprache und in einem größeren Zusammenhang die heutige südalpine Sprachlandschaft, die das Ergebnis einer mehr als zweitausendjährigen überblickbaren Entwicklung ist. Hier, in unserem Raum, hat es immer schon mehrere Sprachen (und nicht nur eine) gegeben.“
Laut historischen Fakten kamen gegen Ende der Völkerwanderungszeit die Vorfahren der heutigen Slowenen, die Alpenslawen, mit einer awarischen Oberschicht ins Land. Erste planmäßige Besiedelungen Kärntens, in dem schon seit dem ausgehenden 6. Jahrhundert Slawen ansässig waren, erfolgten seit dem 9. Jahrhundert durch die Bayern unter fränkischer Oberhoheit. Die bayrischen Siedler ließen sich vor allem in Gegenden nieder, die noch nicht besiedelt waren, was zu einem friedlichen Miteinander beider Volksstämme im Mittelalter geführt hat. Die bereits anwesenden Alpenslawen wurden nicht verdrängt, sondern sind nach und nach in der bayrischen Bevölkerung aufgegangen. In den südlichen Landesteilen ist das slowenische Element stark genug gewesen, die Oberhand zu behalten und die slowenische Sprache zu erhalten. Die deutsch-slowenische Sprachgrenze, wie sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieben worden ist, dürfte sich zu Beginn der Neuzeit herauskristallisiert haben [vgl. Pohl 2000, 120].
Auch bei der Volksabstimmung im Jahre 1920 war das sog. gemeinsame Kärntner Landesbewusstsein bei den Slowenischsprachigen immer noch stark ausgeprägt, haben doch ca. 40% derer, die bei der Volkszählung 1910 Slowenisch als Umgangssprache angegeben haben, für Österreich, also für die Einheit und gegen eine ethnographische Teilung Kärntens, gestimmt.
Zieht man die historisch bedingte Verwobenheit beider Volksgruppen in Kärnten in Betracht, stellt sich unweigerlich die Frage nach der Bedeutung des Begriffes Nationalität. Die Zugehörigkeit zum Volkstum und das damit einhergehende Nationalbewusstsein sollte ein offenes, nach seinen historisch-kulturellen Wurzeln gerichtetes Bekenntnis sein. Heutzutage scheint das Konzept der Kulturnation (die Nation wird über die Sprache definiert) nicht mehr zeitgemäß zu sein, obwohl die Sprachgemeinschaft nach wie vor ein starker Bezugspunkt ist. Unter bestimmten Bedingungen kann sie den Rahmen des Nationalbewusstseins liefern und somit konstitutiv für die Gründung eines Nationalstaates werden, wie wir es in letzter Zeit in Europa erlebt haben [vgl. Pohl 2000, 129f].
2.2 Von den Anfängen bis zum Zerfall der Donaumonarchie
In der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts besiedelten die slawischen Vorfahren der Slowenen den östlichen Teil der Ostalpen und deren südliche und östliche Randgebiete. Die Alpenslawen drangen in die neuen Gebiete unter der Oberhoheit der Awaren vor, wobei ihr Verhältnis zu ihnen sehr unterschiedlich war. ÄEs reichte von einer weitgehenden Selbständigkeit im Alpenraum nördlich des Karawankenkammes, die sich der Form eines Bündnisses näherte, bis zur schwer lastenden Unterdrückung im pannonischen Vorfeld und im Bereich der Einfallstraße von Pannonien nach Italien“ [Inzko 1988, 13].
Zu Beginn des 7. Jahrhunderts gründeten sie ein selbständiges Fürstentum, das sein politisches Zentrum (Karnburg) auf dem Kärntner Zollfeld in unmittelbarer Nähe des zerstörten Virunum hatte. Dieses Fürstentum, Karantanien genannt, war bis Mitte des 8. Jahrhunderts unabhängig.
Die weitere Entwicklung des Fürstentums Karantanien konnte sich Äwegen des starken Drucks des gesellschaftlich und kulturell höher entwickelten fränkischen Feudalsystems nicht mehr ausschließlich als Resultat eigenständiger sozialer Entwicklung vollziehen…Die gesellschaftlichen Verhältnisse wurden durch die allmähliche Durchsetzung des fränkischen Feudalsystems grundlegend um- und neugestaltet“ [Inzko 1986, 18]. Ab dem 8. Jahrhundert mit Bayern verbunden, musste es die fränkische Oberhoheit anerkennen, jedoch war es stets ein eigenes Herrschaftsgebiet, das immer wieder auch eigene Herzöge hatte. Karantanien war in den folgenden Jahrhunderten immer wieder territorialen Änderungen unterworfen, bevor es im Jahre 1335 an die Habsburger fiel, in deren Machtbereich es dann bis zum Jahre 1918 verblieb [vgl. Inzko 1986, 19].
Das Herzogtum Kärnten nahm innerhalb der Länder des Heiligen Römischen Reichs eine Sonderstellung ein, auf die sich die Landstände des sog. windischen Herzogtums beriefen, deren Anknüpfungspunkt die altertümliche Herzogseinsetzung bildete. Sie reichte bis in die Frühzeit Karantaniens zurück und lebte bis ins Spätmittelalter fort, und Äzwar in der bekannten Szene am Fürstenstein bei Karnburg, in der ‚ain windischer man‘, der Herzogbauer, den neuen Herzog in Anwesenheit des Volkes in ‚windischer rede‘ einem Prüfungsverfahren unterzog und ihm hernach die Herzogswürde übertrug“ [Inzko 1986, 21]. Das feudal-dynastische Gegenstück war der Herzogsstuhl, der sich auf dem Zollfeld (zwischen Karnburg und Maria Saal) befindet, auf dem vom Herzog die Lehen verteilt wurden. Die Einsetzungszeremonie erfolgte bis zum Jahr 1414 stets auf dem Fürstenstein. Aufgrund der christlichen Missionierung, bei der auch die Volkssprache herangezogen wurde, kamen die Slowenen um das Jahr 1000 zu ihren ersten schriftlichen Sprachdenkmälern, die sog. Freisinger Denkmäler (BriŽinski spomeniki), die aus drei liturgischen Texten bestanden. Danach tauchte erst am Ende des 14. Jahrhunderts wieder ein slowenisches Sprachdenkmal auf, die sog. Klagenfurter Handschrift (celovški rokopis), die drei Gebete enthielt und dem heutigen Slowenisch schon recht nahe stand [vgl. Inzko 1988, 21f].
Ab dem 15. Jahrhundert sprachen etwa zwei Drittel des Landes Deutsch und ein Drittel Slowenisch, wobei sich auch im slowenischen Landesteil die Herrscherschicht des Deutschen bediente. Damals kam es jedoch auf die Unterscheidung zwischen der deutschen und slowenischen Sprache nicht an, primär galt die Unterscheidung zwischen Herr und Untertan. ÄDen feudalen Schichten lag eine ‚nationale‘ Voreingenommenheit fern. Daher gab es seitens der Grund- und Gerichtsherrschaften und der ständischen Behörden auch keine ‚Germanisierungsabsicht‘. Allen erschien der bäuerliche Untertan ohne Rücksicht auf seine Sprache nur als Wirtschaftsfaktor und Herrschaftsobjekt wichtig“ [Inzko 1986, 24].
Die Reformation konnte im slowenischen Sprachgebiet erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Fuß fassen, wobei der Schwerpunkt der slowenisch protestantischen Bewegung in Krain lag. Durch die Schaffung der slowenischen Schriftsprache, die das Fundament eines eigenständigen Kulturlebens der Slowenen bildete und auf die sich später das slowenische nationale Erwachen stützen konnte, zeichnete sich diese Bewegung aus. So veröffentlichte PrimoŽ Trubar im Jahre 1550 das erste gedruckte slowenische Buch, im Jahre 1584 erschienen die slowenische Bibelübersetzung von Jurij Dalmatin sowie die von Adam Bohorič verfasste slowenische Grammatik. Fast ein Drittel der Druckkosten dieser slowenischen Bibelübersetzung wurde von den Landständen Kärntens übernommen und sie kauften noch ein Fünftel der Auflage für den Eigenbedarf an. Durch die gewaltsame Wiedereinführung des Katholizismus wurden die slowenischen kulturellen Bestrebungen stark eingeengt. Bauernaufstände und Reformation schufen die ersten Ansätze zur Ausbildung eines ethnischen Bewusstseins bei den Slowenen, die mit der Begründung einer eigenen schriftsprachlichen Tradition einen Platz im damaligen kulturellen Leben erlangen konnten und Meilensteine in der Entwicklung des slowenischen Volkes und somit auch der Kärntner Slowenen darstellten [vgl. Inzko 1988, 28-31].
In der ersten Phase des nationalen Erwachens, am Ende des 18. Jahrhunderts, war das slowenische Bürgertum kaum vorhanden und die einzige Intelligenzschicht der Kärntner Slowenen war die Geistlichkeit, die durch jenen Typus des slowenischen Landpfarrers repräsentiert wurde, der gleichzeitig Seelsorger, erster Lehrer und auch erster Ökonom des Dorfes war. Das nationale Erwachen hatte bis zum Jahre 1848 den Charakter einer kulturellen Bewegung und wurde anfangs von wenigen Personen getragen. In Krain waren es Marko Pohlin und der Kreis um Žiga Zois, z.B. Jurij Japelj, Anton TomaŽ Linhart, Valentin Vodnik oder Jernej Kopitar. Sie alle beschäftigten sich mit den normativen Vorarbeiten an der slowenischen Schriftsprache, mit der Erstellung von Grammatiken und Wörterbüchern sowie einer neuen Bibelübersetzung. Linhart war übrigens der Erste, der auf die bedeutende Rolle des slawischen Karantanien in der slowenischen Geschichte hinwies. In Kärnten ist vor allem der Prediger OŽbalt Gutsmann (1727-1790) zu nennen, dessen Deutsch-Windisches Wörterbuch ca. 40 Jahre lang das meistgebrauchte slowenische Wörterbuch blieb. Diese ersten Werke des slowenischen nationalen Erwachens in Kärnten fanden noch Mäzene im deutschen Adel. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der Pfarrer, Philologe, Dichter und Historiker Urban Jarnik (1784-1844), der auch Mitarbeiter in der 1811 gegründeten Zeitschrift Carinthia war, die den Kärntner Slowenen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts als Publikationsorgan offen stand, die bedeutendste slowenische Persönlichkeit in Kärnten. Das slowenische Nationalbewusstsein stand in keinem Widerspruch zum Kärntner Landesbewusstsein und das deutschsprachige Bürgertum war sich der Gemeinsamkeit mit den Slowenen bewusst, jedoch spätestens im Revolutionsjahr 1848 schlug die Gemeinsamkeit in Gegnerschaft um, als die slowenische Emanzipation in Kärnten eine politische Dimension erreichte und die gezielten Germanisierungsbestrebungen einen wesentlichen politischen Faktor darzustellen begannen [vgl. Inzko 1988, 33ff].
Während des Absolutismus der 1850er-Jahre konzentrierte sich die slowenische nationale Bewegung in Kärnten wieder auf die kulturelle Ebene, und Klagenfurt wurde für zwei Jahrzehnte sogar zum kulturellen Zentrum aller Slowenen. In dieser Zeit wurde auch der Hermagoras-Verlag gegründet und Anton JaneŽič (1828-1869) verfasste eine slowenische Sprachlehre und ein in mehreren Auflagen erschienenes slowenisches Wörterbuch [vgl. Inzko 1988, 40].
Das nationale Programm der Kärntner Slowenen wurde infolge der starren, unnachgiebigen und unduldsamen Haltung der Deutschnationalen zunehmend radikaler und mündete in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in die Idee des sog. Trialismus, nämlich die Forderung nach der Bildung einer eigenen südslawischen, staatlichen Einheit im Rahmen der Monarchie. Die Gegner der slowenischen nationalen Emanzipation in Kärnten formierten sich ab dem Jahre 1848 und wiesen alle slowenischen politischen Bemühungen zurück, sogar die slowenischen Bestrebungen für eine sprachliche Gleichberechtigung innerhalb der Landesgrenzen. Dabei spielte die 1872 eingeführte utraquistische Volksschule, in der der Gebrauch der slowenischen Sprache überwiegend nur als Mittel dazu diente, einen Übergang zum deutschsprachigen Unterricht zu ermöglichen, als Instrument der Germanisierung eine wesentliche Rolle. Der slowenischen politischen Partei in Kärnten gelang es nicht, die gesamte slowenisch sprechende Bevölkerung zu gewinnen, sondern nur etwa die Hälfte.
Der Erste Weltkrieg verschlimmerte die Lage der Kärntner Slowenen, da es zu gezielten Verfolgungen führender Kärntner Slowenen kam. So wurden neben slowenischen Geistlichen auch politische Vertreter wie z.B. der Reichsratsabgeordnete Franc Grafenauer verfolgt. Diese Verfolgungen bewirkten nur eine Radikalisierung der slowenischen Bewegung, sodass sie sich der Maideklarationsbewegung 1917 anschloss, die eine staatliche Vereinigung aller Slowenen, Kroaten und Serben der Monarchie unter dem Zepter der Habsburger forderte. Aufgrund der starren politischen Verhältnisse verlangte der slowenische Nationalrat für Kärnten am 17. Oktober 1918 die Eingliederung des slowenischen Sprachgebiets Kärntens in den zu gründenden Staat der Slowenen, Kroaten und Serben [vgl. Inzko 1988, 44].
2.3 Die Zeit nach dem Zerfall der Donaumonarchie
2.3.1 Vom Vielvölkerstaat zum Nationalstaat
Der Prozess im mittleren und südlichen Osteuropa, wo viele kleine Völker multinationalen Imperien angehörten, verlief anders als im restlichen Europa, wo sich die gesamte Bevölkerung unabhängig von Sprache und Nationalität mit ihrem Staat identifizierte (z.B. in der Schweiz) oder eine gemeinsame Sprache pflegte und in dessen Namen die Staatsbildung vor sich ging (z.B. in Italien oder Deutschland). Sie hatten ihre soziale Emanzipation erst in der Auseinandersetzung mit fremdnationalen Oberschichten zu erkämpfen, um zu einer Staatsnation werden zu können. In der Habsburger-Monarchie z.B. sind die slawischen Völker vor allem unter der Herrschaft von Deutschen und Ungarn gestanden. Daher wurde der Wunsch, im Rahmen ihrer besonders durch die Sprache abgegrenzten Gemeinschaft, nach politischer Selbstbestimmung innerhalb des Imperiums, dem sie angehörten, immer größer. ÄAls Merkmale, die dem einzelnen Bürger die Zugehörigkeit zur Nation klar machen sollten, galten vor allem die gemeinsame Sprache, die gemeinsame Kultur, das gemeinsame historische Schicksal, die Religion und andere verbindende Gemeinsamkeiten wie Sitten und Gebräuche“ [Inzko 1988, 47].
Der Zusammenbruch der Habsburgermonarchie brachte für das slowenische Volk bedeutende Veränderungen mit sich. Im November 1918 wurde zunächst der SHS- Staat gegründet, der alle Südslawen der ehemaligen Donaumonarchie umfassen sollte. Jedoch blieb etwa ein Drittel des slowenischen Volkes außerhalb der Grenzen des neuen südslawischen Staates, dem von den slowenischen Gebieten nur der Großteil Krains, die Untersteiermark und das Übermurgebiet (Prekmurje) angehörten. Das Küstenland und ein Teil Innerkrains fielen Italien zu, die Kärntner Slowenen verblieben bei Österreich und ein geringer Anteil an slowenischer Bevölkerung entlang des Flusses Raab kam zu Ungarn. Dieses agrarische Gebiet südlich von Szentgotthard wird als Porabje bezeichnet, wobei der dort gesprochene Dialekt sehr jenem im benachbarten Prekmurje ähnelt [vgl. Inzko 1988, 47].
Die geographische Lage der slowenischen Minderheiten3
Rückblickend kann heute festgestellt werden, dass der Nationalstaat nur ein Übergangsstadium vom feudal-dynastischen Staatsgebilde zu größeren politischen Einheiten der Zukunft darstellt. Heute wird der in seinen Grenzen abgeschlossene Nationalstaat von zwei Seiten her in Frage gestellt: Einerseits weichen nationale Ideologien übernationalen (Handel, Verkehr, Tourismus etc.), andererseits regionalen. Auf dem Weg zur Demokratisierung der Gesellschaft stellt der Nationalstaat zweifellos eine Notwendigkeit dar [vgl. Inzko 1988, 48].
2.3.2 Die Entstehung der Ersten Republik
Die Ereignisse des Ersten Weltkrieges hatten für ganz Mittel- und Osteuropa Äschicksalhafte und lang andauernde Folgen. Die Februarrevolution 1917 stürzte das Zarenregime in Rußland, und die Oktoberrevolution führte zur Gründung des ersten marxistisch-kommunistischen Staates der Welt. Im Deutschen Reich, das trotz territorialer Verluste im Kern unverändert geblieben war, wurde die Monarchie abgeschafft. Österreich-Ungarn zerfiel in die drei Nachfolgestaaten Tschechoslowakei, Österreich, Ungarn und die restlichen Gebiete wurden in bereits bestehende oder neu entstandene Nationalstaaten eingegliedert (Italien, Rumänien, SHS-Staat [Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen], Polen)“ [Inzko 1988, 49].
Aufgrund der unnachgiebigen Haltung der Wiener Regierung traten die Südslawen im Parlament gemeinsam mit den Tschechen und Slowaken in eine scharfe Opposition. Als nächster Schritt wurde ein gemeinsames nationales Forum für alle Südslawen der Monarchie geschaffen, das Narodno vijeće, welches sich als eine Nationalversammlung aller Slowenen, Kroaten und Serben in der Monarchie Österreich-Ungarn verstand. Schließlich gründete es am 29. Oktober 1918 den selbstständigen Staat der Slowenen, Kroaten und Serben, der das Gebiet der ehemaligen Monarchie umfasste, auf dem die Südslawen siedelten. Die ausschlaggebenden Entscheidungen über die zukünftige Staatenordnung in Europa aber lagen in den Händen der Entente (Militärbündnis zwischen dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Russland). ÄDie innere revolutionäre Entwicklung in den südslawischen Gebieten der zerfallenden Monarchie und die Gefahr, die der Vormarsch des italienischen Heeres in sich barg, beschleunigten schließlich die Vereinigung des Staates der Slowenen, Kroaten und Serben mit dem Königreich Serbien und dem Fürstentum Montenegro. Deshalb erfolgte am 1. Dezember 1918 übereilt die Gründung des zentralistisch orientierten ‚Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen‘ (SHS)“ [Inzko 1988, 53].
Die Republik Österreich entstand im Oktober 1918 aus den überwiegend deutschsprachigen Gebieten der Monarchie. Am 21. Oktober 1918 traten in Wien Ädie Vertreter der Bevölkerung des deutschen Sprachgebietes der Monarchie…zusammen und konstituierten sich unter Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht als ‚provisorische Nationalversammlung des selbständigen deutschösterreichischen Staates‘…Kaiser Karl verzichtete zwar nicht auf den Thron, gab aber am 11. November die Erklärung ab, auf die Teilnahme an den Staatsgeschäften zu verzichten und jede Entscheidung über die Staatsform anzuerkennen. Am nächsten Tag, dem 12. November 1918, proklamierte die provisorische Nationalversammlung für Deutschösterreich die demokratische Republik Deutschösterreich und erklärte den neuen Staat zum Bestandteil der Deutschen Republik“ [Inzko 1988, 53f].
Dieser Staat sollte somit als Übergangslösung bis zur endgültigen Eingliederung in einen gesamtdeutschen Staat dienen. Ihre endgültigen Grenzen erhielt die Republik Österreich am 10. September 1919 im Friedensvertrag von St. Germain. Der Artikel 88 des Vertrages von St. Germain erklärte die staatliche Selbständigkeit Österreichs für unabänderlich, außer der Völkerbund stimme einer Änderung zu. Ohne Einverständnis des Völkerbundes konnte somit ein Anschluss an Deutschland nicht vollzogen werden [vgl. Inzko 1988, 54f].
Auf dem Weg zur nationalen Selbstbestimmung ist der österreichische Staat nur der äußere Rahmen, in dem sich diese Selbstbestimmung vollziehen kann, aber er hat diese Nation nicht alleine geschaffen. ÄEs ist daher nur bedingt richtig, von einer österreichischen Staatsnation - im Gegensatz etwa zum Begriff der Sprachnation - zu reden, da der eigentliche integrierende Faktor vor 1945 nicht der Staat war, sondern der Wille, ihn zur Sicherung der nationalen Einheit wieder zu begründen. Die nationale Einheit steht somit zeitlich vor der Wiedererlangung der staatlichen Souveränität“ [Inzko 1988, 61]. Die österreichische Nation umfasst aber nicht nur deutschsprachige Bürger, sondern auch Bürger anderer Nationalitäten: die Slowenen in Kärnten und in der Steiermark (wenn auch nur in geringer Zahl), die Kroaten und Ungarn im Burgenland und die Tschechen und Slowaken in Wien. Als weitere ethnische Minderheiten in Österreich sind noch die Roma, Juden und verschiedene Zuwanderer (z.B. Kurden oder Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien) zu nennen. Diese Minderheiten dürfen das natürliche Recht wahrnehmen, ihre Eigenart sprachlicher und kultureller Natur sowie ihre eigenständigen politischen Traditionen zu pflegen, welches für die Slowenen und Kroaten im Staatsvertrag des Jahres 1955 verbrieft worden ist [vgl. Inzko 1988, 62f].
2.3.3 Der Kärntner Abwehrkampf
Nach der Entstehung der Republik Deutsch-Österreich und des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen standen die Kärntner Slowenen vor der Entscheidung über ihre staatliche Zugehörigkeit, entweder ihrer langjährigen Bindung an den deutschsprachigen Teil Kärntens entsprechend bei Österreich zu verbleiben oder sich aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit dem südslawischen Staat anzuschließen. Eine einvernehmliche Aufteilung des altösterreichischen Staatsgebietes wurde 1918 durch einander überschneidende Gebietsforderungen der Nachfolgestaaten verhindert, da die serbische Regierung in Belgrad Südkärnten aufgrund des ethnisch-nationalen Prinzips für den neuen südslawischen Staat beanspruchte. Um das umstrittene Gebiet kam es ab Dezember 1918 zu regionalen Grenzkämpfen, die schließlich mit der Besetzung Südkärntens, einschließlich der Landeshauptstadt Klagenfurt, durch serbische Truppen des SHS-Staates im Juli 1919 endeten. Auf der Friedenskonferenz in Paris im Mai 1919 wurde die Abhaltung einer Volksabstimmung über das umstrittene Gebiet beschlossen, die über die territoriale Zukunft Südkärntens entscheiden sollte [vgl. Inzko 1988, 64f].
Das Gebiet der Volksabstimmung in Kärnten4
Die Abstimmung sollte in zwei Zonen gesondert vorgenommen werden, wobei die Bewohner der Zone A (beinahe das gesamte gemischtsprachige Gebiet Südkärntens) zuerst über die künftige staatliche Zugehörigkeit befragt werden sollten. Im Falle einer Mehrheit für Österreich würde die Abstimmung in der Zone B entfallen und das Klagenfurter Becken ungeteilt zu Österreich kommen. Die korrekte Durchführung der am 10. Oktober 1920 erfolgten Volksabstimmung überwachte eine interalliierte Kommission, der englische, französische, italienische, österreichische und südslawische Vertreter angehörten. Das Abstimmungsergebnis mit einer klaren Mehrheit von ca. 59% für Österreich überraschte ein wenig, da in diesem Gebiet bei der Volkszählung 1910 noch etwa 70% der Bevölkerung Slowenisch als Umgangssprache angegeben hatten. Infolge der politischen und sozialökonomischen Entwicklung gehörte ein erheblicher Teil der Kärntner Slowenen nicht zu den nationalbewussten Mitgliedern der slowenischen Gemeinschaft und war eher geneigt, für die Beibehaltung der historischen Landeseinheit und für die weitere kulturelle, politische und vor allem ökonomische Verbindung mit den deutschsprachigen Kärntnern zu votieren. 5
Außerdem dürfte schließlich die Erklärung der provisorischen Kärntner Landesregierung vom 28. September 1920 einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Stimmverhalten der Kärntner Slowenen gehabt haben, in der versprochen wurde, den slowenischen Landsleuten ihre Äsprachliche und nationale Eigenart ‚jetzt und allezeit‘ zu wahren und dem ‚geistigen und wirtschaftlichen Aufblühen‘ dieselbe Fürsorge angedeihen zu lassen wie den deutschen Bewohnern des Landes“ [Inzko 1988, 69].
2.4 Die Zwischenkriegszeit
2.4.1 Die Kärntner Slowenen in der Ersten Republik
Nach der Volksabstimmung hatte sich die Lage der Kärntner Slowenen gegenüber jener in der Monarchie wesentlich verschlechtert, da die neuen nationalstaatlichen Grenzen die engen Verbindungen mit den Slowenen im neuen südslawischen Staat unterbrachen. Als ethnische Minderheit innerhalb eines überwiegend deutschsprachigen Staates war ihre Hauptaufmerksamkeit der Sicherung ihrer nationalen Existenz gewidmet, die wegen der führenden politischen Kräfte Österreichs gefährdet war.
Nach der Volksabstimmung wurde die, nach dem Ersten Weltkrieg kurz unterbrochene, Germanisierung wieder aufgenommen. Der Vertrag von St. Germain mit seinen Minderheitenschutzbestimmungen reichte keineswegs aus, um die Slowenen als Volksgruppe zu schützen. Im Vergleich mit dem Nationalitätenrecht in der Monarchie Österreich-Ungarn, in welcher zumindest alle Volksgruppen auf dem Papier gleichberechtigt waren, zeigte der Vertrag von St. Germain Nachteile wie z.B. das Fehlen von Garantien für den Bestand der Volksgruppen, da die ethnische Vereinheitlichung Österreichs nicht behindert werden sollte [vgl. Inzko 1988, 70f].
Viele begannen aufgrund des politischen Drucks, sich von der slowenischen nationalen Bewegung zu distanzieren und vollzogen somit unbewusst den ersten Schritt zur Aufgabe ihrer slowenischen Muttersprache und Eigenart. ÄSie beugten sich endgültig dem deutschnationalen Druck, weil sie sich und ihren Kindern die Nachteile der Zugehörigkeit zur slowenischen Volksgruppe ersparen wollten. Stets war die Beeinträchtigung des wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Lebens der Slowenen eine unabdingbare Voraussetzung für die Eindeutschung eines Teiles der Volksgruppe. Die Geschichte der Ersten Republik ist dafür ein Beispiel“ [Inzko 1988, 77f].
In den 1920er-Jahren wurde in wissenschaftlichen Kreisen die Theorie der sog. Windischen geboren, welche den Kärntner Slowenen ihre Nationalität aberkennen und deren Sprache zur Mischsprache degradieren wollte. Deutschnationale Wissenschaftler griffen den Begriff Windisch auf, um damit die, in ihrer überwiegenden Zahl angeblich deutschfreundlichen Kärntner Slowenen, zu bezeichnen, die nämlich allein den Ausgang der Volksabstimmung entschieden hätten. Von diesen wurden die sog. Nationalslowenen, die sich zu ihrer nationalen Eigenheit bekannten, scharf abgegrenzt und zu Feinden Kärntens erklärt. Somit war die Spaltung der slowenischen Volksgruppe in zwei Gruppen politisch bedingt und entsprach den deutschnationalen Interessen des Landes. Diese
pseudowissenschaftliche Theorie diente nun fortan als politisches Instrument der Eindeutschung, jedoch wurde die Existenz eines sog. windischen Mischvolkes von der Sprachwissenschaft immer in Abrede gestellt [vgl. Inzko 1988, 78-81]. Auf die Initiative der Sozialdemokraten hin wurde in den Jahren von 1925 bis 1930 über eine sog. Kulturautonomie für die Kärntner Slowenen verhandelt, jedoch behinderten die deutschnationalen Parteien die Verhandlungen mit allen möglichen Mitteln. Der im Landtag eingebrachte Gesetzesentwurf für eine mögliche kulturelle Autonomie der slowenischen Volksgruppe basierte auf dem Gedanken der kulturellen Selbstverwaltung. Die slowenische Volksgruppe sollte das Recht auf eigenständige und eigenverantwortliche Regelung ihrer kulturellen Angelegenheiten erhalten. Weil es aber auf dem Bekenntnisprinzip beruhte, scheiterten schließlich alle Verhandlungen [vgl. Inzko 1988, 92].
In den Jahren des autoritären Ständestaates (1934-1938) hofften die Kärntner Slowenen, eine Verbesserung ihrer kulturellen Lage im Lande zu erreichen. Sie nahmen an, dass der Ständestaat in der Lage sein werde, den in Kärnten herrschenden Deutschnationalismus einzudämmen und die Auswirkung seiner antislowenischen Politik rückgängig zu machen. Der Wunsch der Führung der Kärntner Slowenen, im Rahmen der ständestaatlichen Verfassung einen autonomen nationalen Organismus zu bilden, wurde jedoch nicht erfüllt. Auch die großen Hoffnungen in eine Reformierung des bestehenden zweisprachigen Schulwesens zugunsten der Minderheit konnten zum größten Teil nicht erfüllt werden, da die wohlwollenden Absichten der Bundesregierung in Wien, den Kärntner Slowenen in einigen wesentlichen Fragen wie z.B. der Schulfrage entgegenzukommen, politisch in Kärnten nicht durchzuführen waren [vgl. Inzko 1988, 96-100].
2.4.2 Die Slowenen im SHS-Staat
Nach dem Zerfall der Monarchie war das Hauptaugenmerk des slowenischen Volkes auf die Sicherung der territorialen und nationalen Einheit gegenüber den deutschen und italienischen Nachbarn gerichtet. Der Nationalrat (Narodni svet), der Mitte August 1918 in Ljubljana gegründet wurde, suchte daher Unterstützung in der Verbindung mit den Kroaten und Serben der Habsburgermonarchie. Anfang Oktober konstituierte sich in Zagreb der Nationalrat der Slowenen, Kroaten und Serben (Narodno vijeće) und am 28. Oktober 1918 wurde die Errichtung des neuen Staates proklamiert. Die siegreichen Alliierten waren nicht bereit, diesen Staat anzuerkennen, vor allem Italien stellte Gebietsansprüche. Aufgrund sozialer Spannungen und Nahrungsmittelknappheit erschien die möglichst rasche Vereinigung mit dem Königreich Serbien, das den Status einer Siegermacht hatte, wünschenswert.
Am 1. Dezember 1918 wurde durch den Prinzregenten Alexander, in Anwesenheit der Delegation des Narodno vijeće, die Errichtung des SHS-Staates verkündet. Jedoch gewann das serbische Bürgertum schon bald die politische und wirtschaftliche Übermacht und richtete den Staat nach seinen Interessen und Vorstellungen ein. Diese serbische Vormachtstellung wurde im Jahre 1921 mit der Vidovdan-Verfassung deutlich sichtbar, welche dem Königreich eine zentralistische innere Ordnung gab. So war z.B. das slowenische Territorium auf die Verwaltungsgebiete Ljubljana und Maribor aufgeteilt und von offizieller Seite galt die national-unitaristische Auffassung, die besagt, dass sowohl Serben und Kroaten als auch Slowenen nicht eigenständige Völker, sondern nur Stämme eines jugoslawischen Volkes seien [vgl. Inzko 1988, 113ff].
Der serbisch-kroatische Gegensatz, der durch die gesamte Zwischenkriegszeit hindurch das politische Leben in Jugoslawien stark behinderte, erreichte seinen Höhepunkt im Jahre 1928 mit Massendemonstrationen in ganz Kroatien. König Alexander löste nach gescheiterten Bemühungen, die Lage wieder zu beruhigen, das Parlament auf, setzte die Verfassung außer Kraft und übernahm mit einem diktatorischen Regime am 6. Januar 1929 selbst die ganze Macht im Staate, welcher nun den Namen Königreich Jugoslawien (Kraljevina Jugoslavija) bekam. Während der Königsdiktatur entstanden in Slowenien verschiedene politische Bewegungen mit der Forderung nach Autonomie, welche die Regierung zu unterdrücken, aber gleichzeitig die offenen nationalen und sozialen Fragen zu lösen versuchte. Diese Vorgehensweise konnte jedoch keine besonderen Erfolge erzielen. Nach der Ermordung des Königs Alexander im Jahre 1934 kam es zu Änderungen in der Außenpolitik. Die neue Regierung gab die traditionelle Anlehnung Jugoslawiens an Frankreich und die Verbindung mit der Tschechoslowakei und Rumänien in der kleinen Entente auf und näherte sich dem faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen Deutschland an [vgl. Inzko 1988, 119-122].
Die Zerstrittenheit und die unterschiedlichen Standpunkte in den christlichen Reihen bestärkten die Kommunisten in der Überzeugung, dass bei den Slowenen eine kommunistische Politik (sog. Volksfront-Politik) möglich wäre. Hinsichtlich der jugoslawischen Frage befürworteten sie den Föderalismus, damit die Äkulturelle und politische Eigenständigkeit aller Völker gesichert sei. Deshalb beschlossen sie auch die Errichtung nationaler kommunistischer Parteien, die einerseits die ethnische Verschiedenartigkeit zum Ausdruck bringen, andererseits aber eine übernationale Einheit bilden sollten. Der Gründungskongress der KP Sloweniens fand im April 1937…statt. Dabei wurde besonders hervorgehoben, daß es in einer Zeit des anwachsenden aggressiven und gefährlichen Faschismus gelte, den Streit in den Reihen der Demokraten zu vergessen und alle Kräfte für den Weiterbestand des slowenischen Volkes zu sammeln“ [Inzko 1988, 123f].
Die Verschärfung der weltpolitischen Lage steigerte noch die Spannungen und Gegensätze innerhalb des Königreichs Jugoslawien. Der Ende August 1939 geschlossene Hitler-Stalin-Pakt beeinträchtigte die Beziehungen zwischen den Kommunisten, den christlichen Sozialisten und anderen Gruppierungen, die bereit waren, in der Volksfront zusammenzuarbeiten, schwer. Zur Abwehr der deutschen Gefahr traten daher ideologische Gegensätze in den Hintergrund, sodass es zu einer Festigung der Volksfront kam [vgl. Inzko 1988, 125].
2.4.3 Die Slowenen des Küstenlandes
Das Gebiet Julisch-Venetien (Julijska krajina) wurde nach dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie von der italienischen Armee besetzt, obwohl die küstenländischen Slowenen gehofft hatten, dass auch für sie jenes Prinzip der Selbstbestimmung der Völker gelten werde, welches auf der Pariser Friedenskonferenz propagiert wurde. Gleich nach der italienischen Besetzung kam es zu politischen Verfolgungen, die vor allem die slowenische Intelligenz trafen. Vor der Unterdrückungspolitik der Behörden suchten daher viele Slowenen Schutz bei der kommunistischen Partei Italiens, von der sie als gleichberechtigte Partner anerkannt wurden. Das Schicksal der küstenländischen Slowenen wurde zu dieser Zeit auf internationale Ebene mit dem Abkommen von Rapallo (November 1920) entschieden. Darin legten Italien und das Königreich SHS nach langen und schwierigen diplomatischen Verhandlungen ihre gemeinsame Staatsgrenze fest. Das gesamte slowenische Küstenland mit Istrien und dem Gebiet um Görz kam zum Königreich Italien, ohne irgendwelche Schutzbestimmungen für die ca. 400.000 küstenländischen Slowenen vereinbart zu haben [vgl. Inzko 1988, 137ff].
In den folgenden Jahren wuchs parallel mit dem Erstarken der faschistischen Partei auch der Druck auf die Slowenen und im Jahre 1927 wurden alle noch verbliebenen slowenischen Organisationen und Schulen endgültig verboten. Unter diesen schwierigen Umständen entstand eine slowenische Terrorgruppe, die sich nach den Initialen der unterdrückten Städte und Gebiete Triest, Istrien, Görz und Rijeka TIGR nannte, und mit Gewaltaktionen in Erscheinung trat. Das faschistische Regime unterdrückte jedoch jegliche Opposition und betrieb eine gezielte Entnationalisierungspolitik, dem sich sogar die Kirche in den 1930er-Jahren unterwarf. Daher flüchteten viele Slowenen in einen kämpferischen Nationalismus oder in den Kommunismus, der seine Einstellung zur nationalen Frage grundlegend geändert hatte. Nun stand nicht nur die Lösung der sozialen Frage sondern auch das Recht auf Selbstbestimmung unterdrückter Nationalitäten im Vordergrund. Dadurch wurde die Voraussetzung für die Zusammenarbeit zwischen Kommunisten und nationaler Befreiungsbewegung geschaffen, die besonders in der Zeit vor dem Krieg wirksam war, als junge Leute beider Lager gemeinsam eine Reihe von Sabotageakten auf militärische Objekte organisierten. Daher begann sich die Partisanenbewegung unter den küstenländischen Slowenen schon im Sommer 1941 zu entwickeln, obwohl ein Großteil der wehrfähigen Männer in der italienischen Armee, in der Verbannung oder im Gefängnis war [vgl. Inzko 1988, 140ff].
2.5 Die Zeit unter nationalsozialistischer Herrschaft
2.5.1 Die Situation der Kärntner Slowenen
Die Lage der Kärntner Slowenen verschlechterte sich mit der Besetzung Österreichs durch die NS-Truppen im März 1938 und dessen Eingliederung in das Deutsche Reich entscheidend. Die Nationalsozialisten gingen bei der Germanisierung der slowenischen Volksgruppe systematisch vor, was deutlich aus der Volkszählung 1939 hervorging. Mit Hilfe der aus der Volkszählung erhaltenen Daten konnte man zur Liquidierung der Kärntner Slowenen schreiten, die sog. eindeutschungsfähigen Windischen sollten assimiliert und die sog. Nationalslowenen aus Südkärnten ausgesiedelt werden [vgl. Inzko 1988, 101ff].
Noch im Schuljahr 1938/39 wurde die utraquistische Schule abgeschafft und die slowenischsprachigen Lehrer wurden in rein deutschsprachige Gebiete versetzt. Zum Zwecke einer schnelleren Germanisierung dienten Kindergärten, in denen den Kindern noch vor dem Schuleintritt die deutsche Sprache vermittelt werden sollte. Eine gegen die slowenische Volksgruppe gerichtete Siedlungspolitik wurde in Kärnten schon seit den 1920er-Jahren durch den Kärntner Heimatdienst betrieben, jedoch als im Oktober 1939 das deutsch-italienische Abkommen über die Umsiedlung der Südtiroler geschlossen wurde, stand für die Kärntner Slowenen die Gefahr der Aussiedlung unmittelbar bevor. Der Plan dieses Abkommens war es, Kanaltaler und Grödnertaler aus Südtirol im gemischtsprachigen Grenzgebiet Kärntens anzusiedeln. Die Überlegungen der nationalsozialistischen Machthaber in Kärnten gingen noch darüber hinaus, indem sie bei einer zukünftigen Aufteilung Jugoslawiens auch die Angliederung des Mießtales und des Gebietes um Jesenice an Kärnten verlangten [vgl. Inzko 1988, 103f].
Nach der Okkupation Jugoslawiens 1941 durch die Truppen des Deutschen Reiches und seine Verbündeten wurde Slowenien zwischen Ungarn, Italien und dem Deutschen Reich aufgeteilt. Die Absicht der nationalsozialistischen Besatzungspolitik war eine volle Integration dieser Gebiete und die totale Germanisierung der dort lebenden slowenischen Bevölkerung. Ab nun wurde die Liquidierung des politischen und kulturellen Lebens der slowenischen Volksgruppe in Kärnten konsequent durchgeführt, sogar im kirchlichen Bereich wurde die slowenische Sprache verboten. Es wurde eine beträchtliche Anzahl slowenischer Priester von ihren Pfarren vertrieben und alle slowenischen Kulturvereine aufgelöst. ÄDer Großteil der slowenischen Genossenschaften wurde mit den deutschen verschmolzen, ihre Mitglieder wurden größtenteils ausgeschieden, die gewählten Funktionäre abgesetzt, und das Vermögen wurde eingezogen“ [Inzko 1988, 105]. Im April 1942 begann die Aussiedlungsaktion in Kärnten, von der an die 200 Familien betroffen waren. Die ausgesiedelten Familien wurden in Arbeitslager nach Deutschland transportiert, vielfach wurden Familien auseinander gerissen und die Männer zur Wehrmacht eingezogen. Der Widerstand gegen diese Gewaltmaßnahmen war zunächst gering, doch der Terror gegen die Zivilbevölkerung bewirkte allmählich einen verstärkten bewaffneten Widerstand, da die nationalsozialistische Terror-Politik auf die gänzliche Eliminierung der Volksgruppe abzielte [vgl. Inzko 1988, 106].
Der organisierte bewaffnete Widerstand setzte in Kärnten im Herbst 1942 voll ein und so kam es zu einer Reihe von bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den Partisaneneinheiten und SS-Einheiten. Um die Kärntner Partisaneneinheiten abzuwehren, war ein beträchtlicher militärischer Aufwand von Nöten, denn aufgrund der Aussiedlung, Verhaftung und Verschleppung von Verwandten und Nachbarn hatten die Partisanen einen starken Zulauf. So zogen es z.B. Fronturlauber vor, die Seiten zu wechseln und nun gegen Hitler-Deutschland zu kämpfen. Die Kapitulation Italiens bewirkte einen beachtlichen Aufschwung für die Partisanenbewegung in Kärnten und sie bekam im März 1944 eine einheitliche militärische Führung. Zwischen Frühjahr und Herbst 1944 erreichten die Aktivitäten der Partisanen durch die Erweiterung des Einsatzbereiches auf Gebiete nördlich der Drau (sogar bis zur Saualpe) ihren Höhepunkt. Es kam nun zu Kontakten zwischen slowenischen und österreichischen Widerstandsbewegungen und im Jahre 1944 formierte sich das erste österreichische Bataillon innerhalb der Volksbefreiungsarmee Jugoslawiens, dem später noch vier weitere folgen sollten [vgl. Inzko 1988, 110ff].
2.5.2 Die Situation in Slowenien
Die Besetzung Jugoslawiens durch Deutschland und Italien bedeuteten sicherlich die vier schwersten Jahre in der Geschichte des slowenischen Volkes. Die faschistischen kroatischen Ustaši bekamen von Hitler und Mussolini den sog. Unabhängigen Staat Kroatien (Nezavisna drŽava Hrvatska) zugestanden, der Großteil Serbiens wurde einer deutschen Militärverwaltung unterstellt und der Rest Jugoslawiens unter die Nachbarstaaten aufgeteilt. Das slowenische Territorium wurde dreigeteilt: Das Deutsche Reich bekam Oberkrain, das dem Gau Kärnten angegliedert wurde, und die Untersteiermark, die dem Gau Steiermark angeschlossen wurde, Italien die Provinz Laibach, bestehend aus Unterkrain und Innerkrain, und Ungarn das Übermurgebiet. Von deutscher Seite aus wurde sofort durch breit angelegte Aussiedlungsaktionen mit der radikalen Germanisierung begonnen, während die Italiener weniger brutal vorgingen. Als Reaktion darauf gründeten die ehemals in der Volksfront vereinigten slowenischen politischen Kräfte die Befreiungsfront (Osvobodilna fronta), deren Führung bald die Kommunisten übernahmen und die bereits über ein gut funktionierendes Organisationsnetz im politischen Untergrund verfügten [vgl. Inzko 1988, 127].
Die Aufteilung Sloweniens 19416
Der bewaffnete Widerstand der Befreiungsfront gegen die Besatzungsmächte setzte erst ein, als mit dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion im Juni 1941 der Hitler-Stalin-Pakt gegenstandslos geworden war. Auf die Guerillataktik der Partisanen reagierten die Besatzungstruppen mit Erschießungen der Zivilbevölkerung. Die slowenische Befreiungsfront präsentierte bereits zum Jahreswechsel 1941/42 ihr ausgearbeitetes Programm, in dem gesagt wurde, dass Äder Kampf gegen die Besatzer gleichzeitig der Kampf für die Vereinigung aller Slowenen sei. Angestrebt werde die Vereinigung und Eintracht aller Völker Jugoslawiens auf der Grundlage des Rechtes jeder Nation auf Selbstbestimmung…und es wurde auch schon angekündigt, daß die Befreiungsfront nach der Befreiung auf slowenischem Gebiet die Macht übernehmen und eine Volksdemokratie einrichten werde. Damit war bereits ausgesprochen, daß gleichzeitig mit der nationalen Befreiung auch ein grundlegender Wandel des politischen Systems erfolgen sollte“ [Inzko 1988, 128].
Zu Beginn des Jahres 1943 war das Übergewicht der Kommunisten in der Befreiungsfront derart spürbar, dass die anderen Gründungsgruppen künftig auf eigene politische Vertretungen verzichteten. Nicht nur die Sowjetunion, auch die westlichen Alliierten begannen nun die Befreiungsfront aufgrund ihres erfolgreichen Widerstandes gegen die Besatzer zu unterstützen. Die Absicht der kommunistisch dominierten Befreiungsfront, das Gesellschaftssystem grundlegend zu ändern, hatte die Formierung slowenischer antikommunistischer Kräfte zur Folge. Vor allem die Heimwehr (Domobranci) verstärkte ihren Kampf gegen die Befreiungsfront und Äkollaborierte, zum Teil freiwillig, zum Teil durch den Gang der Ereignisse dazu gedrängt, mit den Okkupanten. Damit eskalierte der nationale Befreiungskampf zum Bürgerkrieg mit allen seinen Schrecken für die Bevölkerung“ [Inzko 1988, 130].
Nach der Kapitulation Italiens im September 1943 nahm die Partisanenbewegung den Charakter einer gesamtslowenischen Erhebung an. Die Partisanen erbeuteten von den abziehenden italienischen Truppen umfangreiches Kriegsmaterial und richteten in den befreiten Gebieten ein eigenes Verwaltungssystem ein, das nach der totalen Befreiung Sloweniens im Jahr 1945 auf das gesamte slowenische Staatsgebiet übertragen wurde. Die slowenischen Verbände forderten nämlich nicht nur das Küstenland und Istrien, sondern auch Triest für das zukünftige kommunistische Jugoslawien. Obwohl die jugoslawische Armee Anfang Mai 1945 die Stadt befreite, musste sie sich schon nach wenigen Wochen auf Verlangen der westlichen Alliierten zurückziehen. Es begannen lange und verwickelte Verhandlungen um die zukünftigen Grenzziehungen, wobei die italienisch- jugoslawische Grenze erst im Jahre 1977 mit dem Abkommen von Osimo festgelegt wurde [vgl. Inzko 1988, 142f].
2.6 Die Nachkriegszeit
2.6.1 Die Kärntner Slowenen in der Zweiten Republik
Das Bundesland Kärnten wurde von britischem und jugoslawischem Militär besetzt, jedoch zog die jugoslawische Regierung auf Verlangen der Briten ihre Militäreinheiten aus Kärnten zurück, unter Protest und ohne auf ihre Gebietsansprüche verzichten zu wollen. Endgültig normalisierten sich die politischen Verhältnisse im Lande nach den, gleichzeitig mit den Nationalratswahlen abgehaltenen, Landtagswahlen, wobei sich daraus eine klare Dominanz der sozialdemokratischen Partei ergab. Als damalige einzige politische Vertretung der Kärntner Slowenen wurde die Befreiungsfront (Osvobodilna fronta) für Slowenisch- Kärnten gegründet, die aus dem Volksbefreiungskampf hervorgegangen war [vgl. Inzko 1988, 160ff].
Die Minderheitenpolitik der Kärntner Landesregierung war im Jahre 1945 volksgruppenfreundlich ausgerichtet. Es herrschte damals Übereinstimmung darüber, dass ein näher zu umgrenzendes Gebiet Kärntens dauernd als zweisprachig angesehen werden sollte, daher war die Zusammenarbeit von Landesregierung und der Befreiungsfront in den ersten Monaten erfolgreich. Ein gutes Beispiel dafür war die Schulsprachenverordnung, die alle Schüler eines klar umgrenzten Gebietes zur Erlernung beider Landessprachen anhielt, weil sowohl die deutsche als auch die slowenische Sprache in der Grundschule gleichberechtigt waren. ÄDie Schulverordnung umfasste mit ihren 107 zweisprachigen Schulen das gesamte von Slowenen bewohnte Gebiet Kärntens. Die slowenische Volksgruppe versteht den Geltungsbereich der Schulsprachenverordnung bis heute als jenen Teil Kärntens, der im Bereich der Gesetzgebung und Verwaltung als zweisprachig zu behandeln ist“ [Inzko 1988, 165].
Die Befreiungsfront verlangte jedoch stets die Angliederung Südkärntens an Jugoslawien, da ihr die Zukunft der Kärntner Slowenen nach den Erfahrungen der nationalsozialistischen Zeit als Volksgruppe langfristig nur durch eine Vereinigung mit Jugoslawien gewährleistet zu sein schien. Die britische Militärverwaltung als zuständige regionale Instanz der alliierten Besatzungsmächte untersagte daher der Befreiungsfront eine Kandidatur bei der Wahl zum österreichischen Nationalrat im November 1945, weil sich diese nicht vorbehaltlos zu Österreich bekannte. Somit war vorerst die einzige politische Vertretung der slowenischen Volksgruppe aus der Politik des Landes ausgeschaltet worden [vgl. Inzko 1988, 166f].
Die Kärntner Landespolitik versuchte mit der Gründung des Bundes österreichischer Slowenen (Zveza avstrijskih Slovencev) den Aufbau einer neuen Minderheitenorganisation, welche als eine den Interessen der Landesverwaltung dienende Einrichtung gedacht war, mit der Zielsetzung, den Kontakt der slowenischen Volksgruppe mit Jugoslawien zu unterbinden. Dieser neuerliche Versuch einer Spaltung der Minderheit in einen politisch eigenständigen und einen politisch abhängigen Teil scheiterte, aber das nationalpolitische Leben der Kärntner Slowenen erfuhr eine Differenzierung in zwei ideologische Richtungen, die sich
[...]
1 In weiterer Folge wird stets die männliche grammatikalische Form verwendet, die sowohl für männliche als auch weibliche Personen steht.
2 Der Begriff autochthon bedeutet bodenständig, angestammt bzw. an Ort und Stelle entstanden. Eine Volksgruppe wird als autochthon bezeichnet, wenn sie über eine ausreichend lange Zeit in demselben Gebiet siedelt.
3 Inzko 1988, 137.
4 Inzko 1988, 64.
5 Für nähere Informationen siehe: Fräss-Ehrenfeld 2000, Geschichte Kärntens 1918-1920.
6 Inzko 1988, 128.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen autochthonen und allochthonen Minderheiten?
Autochthone Minderheiten sind angestammte Volksgruppen, die seit Jahrhunderten in einem Gebiet leben (z.B. Kärntner Slowenen). Allochthone Minderheiten sind durch Zuwanderung in neuerer Zeit entstanden.
Welche Bedeutung hat Artikel 7 des Staatsvertrages von 1955?
Artikel 7 garantiert den slowenischen und kroatischen Minderheiten in Österreich spezifische Rechte, wie die Verwendung ihrer Sprache im Schulwesen und in der amtlichen Kommunikation.
Wie unterscheidet sich die Situation im Burgenland von der in Kärnten?
Die Arbeit vergleicht die soziokulturelle Lage beider Gruppen. Während die Burgenland-Kroaten oft eine starke Assimilationstendenz zeigen, ist die Geschichte der Kärntner Slowenen stärker von politischen Konflikten geprägt.
Welche Rolle spielt das Schulwesen für den Erhalt der Minderheitensprachen?
Ein funktionierendes zweisprachiges Schulwesen ist essenziell. Die Arbeit stellt die Unterschiede in der Umsetzung des Schulwesens zwischen Südkärnten und dem Burgenland detailliert dar.
Was war der „Kärntner Abwehrkampf“?
Es handelt sich um kriegerische Auseinandersetzungen nach dem Ersten Weltkrieg (1918-1920) um die Grenzziehung in Kärnten, die das Verhältnis zwischen den Volksgruppen bis heute beeinflussen.
Warum ist die Sprache für die Identität der Volksgruppen so wichtig?
Die Sprache ist der Träger der Kultur. Wie im Text betont wird: „Stirbt die Sprache, dann stirbt auch die Volksgruppe.“ Sie dient zudem als Brücke zwischen dem deutschsprachigen und dem slawischen Europa.
- Quote paper
- DI Mag Fabian Prilasnig (Author), 2009, Autochthone Minderheiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139451