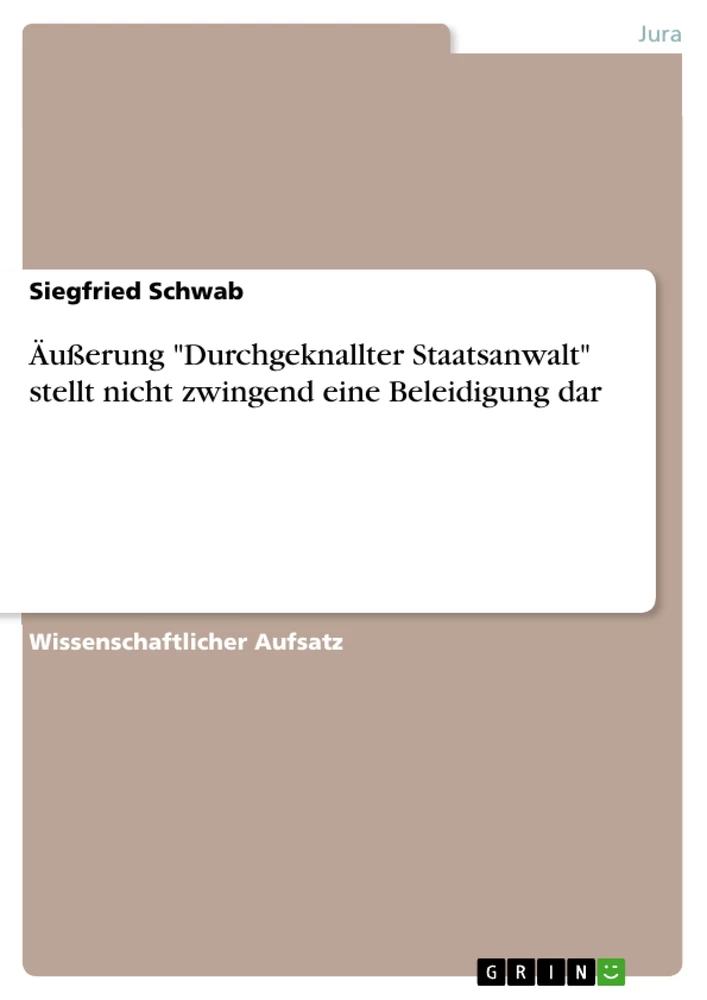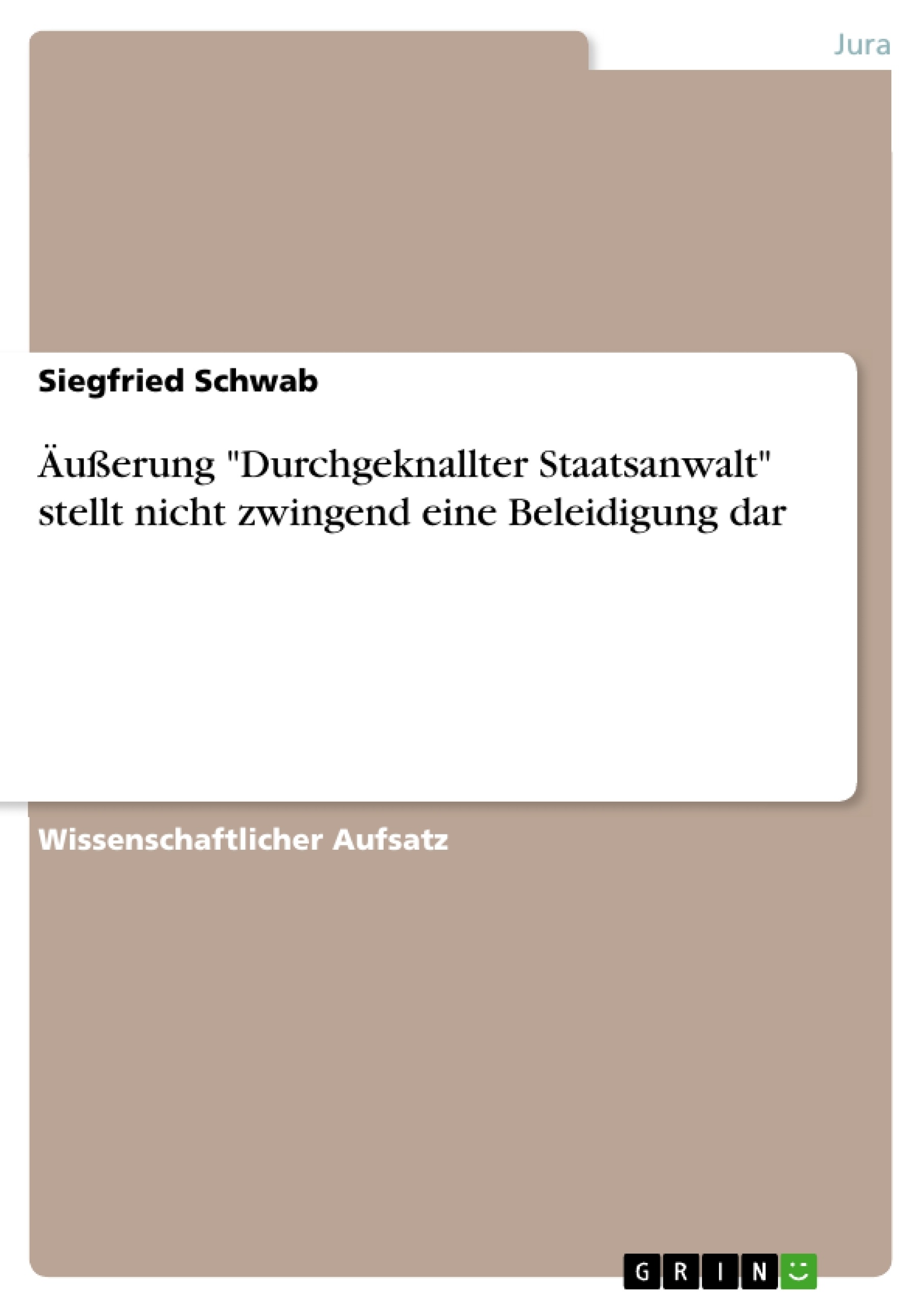Die Verfassungsbeschwerde dient als subjektiv-öffentliches Verfahrensrecht dem Individualrechtsschutz des Bürgers gegen Grundrechtsverletzungen und sichert damit die unmittelbare Geltung der Grundrechte gem. Art. 1 Abs. 3 GG gegenüber den drei Staatsgewalten. Die Verfassungsbeschwerde ist ein subsidiärer und außerordentlicher Rechtsbehelf. Sie füllt eine Lücke im Rechtsschutzsystem, das traditionell nur der Kontrolle der Exekutive dient.
Äußerung "Durchgeknallter Staatsanwalt" stellt nicht zwingend eine Beleidigung dar*
Der Beschwerdeführer ist Journalist[1], Verleger, Publizist und Mitherausgeber einer großen deutschen Zeitung. Im. Juni 2003 strahlte der Fernsehsender "n-tv" die Sendung "Talk in Berlin" aus, an der sich der Beschwerdeführer als Diskussionsteilnehmer beteiligte. Die Sendung befasste sich mit dem seinerzeit in den Medien viel beachteten Ermittlungsverfahren gegen den damaligen Vizepräsidenten des Zentralrates der Juden, Rechtsanwalt und Moderator Dr. F., der in den Verdacht des unerlaubten Umgangs mit Betäubungsmitteln geraten war. Im Rahmen der Sendung äußerte der Beschwerdeführer unter anderem:
"Und ich bin ganz sicher, dass dieser staatsanwaltliche, man muss wirklich sagen: Skandal eines ganz offenkundig, ich sag`s ganz offen, durchgeknallten Staatsanwaltes, der hier in Berlin einen außerordentlich schlechten Ruf hat, der vor einem Jahr vom Dienst suspendiert worden ist, der zum ersten Mal überhaupt wieder tätig wird. Dieser Skandal wird
zweifellos dazu führen, dass sich die hiesige Justizbehörde und die ihr zugeordnete Staatsanwaltschaft fragen muss, ob man auf diese Art und Weise gegen Privatpersonen vorgehen kann."
Das Amtsgericht Tiergarten verurteilte den Beschwerdeführer wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 300,00 €. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Bezeichnung als „durchgeknallt“ umgangssprachlich in dem Sinne von „verrückt“ oder „durchgedreht“ verstanden werde. Hierin liege aber eine Schmähkritik, die allein auf die Diffamierung des Betroffenen ziele und deshalb generell unzulässig sei. Die Revision gegen das Urteil verwarf das Kammergericht auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft ohne weitere Begründung.
Die Verfassungsbeschwerde[2] wird gemäß § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG zur Entscheidung angenommen, weil dies zur Durchsetzung der Grundrechte des Beschwerdeführers angezeigt ist.[3] Sie ist zulässig und offensichtlich begründet. Die angegriffenen Entscheidungen verletzen den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG.
Die inkriminierte Äußerung des Beschwerdeführers fällt in den Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit gibt jedem das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Meinungen sind durch die subjektive Einstellung des sich Äußernden gekennzeichnet. Sie enthalten sein Urteil über Sachverhalte, Ideen oder auch Personen. [4] Für sie ist das Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens kennzeichnend.[5] Die inkriminierte Äußerung stellt, ungeachtet ihres möglichen ehrverletzenden Gehalts, ein solches Werturteil dar. Dass eine Aussage polemisch oder verletzend formuliert ist, entzieht sie nicht schon dem Schutzbereich des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG.[6]
[...]
* Mit Erläuterungen von Prof. Dr. Dr. Siegfried Schwab, Mag. rer. publ. unter Mitarbeit von Diplom-Betriebswirtin (DH) Silke Schwab.
[1] BVerfG, Beschluss vom 12.5.2009 – 1 BvR 2272/04. Nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG fallen neben Werturteilen auch Tatsachenbehauptungen in den Schutzbereich von Art. 5 Abs. 1
S. 1 GG, soweit sie Dritten zur Meinungsbildung dienen können, BVerfGE 61, 1 (8) = NJW 1983, 1415; 90, 241 (247) = NJW 1994. 1779. Das ist besonders dann wichtig, wenn es um die Beweisbarkeit von tatsächlichen Äußerungen geht. Zur Schmähkritik vgl. Bölke, NJW 2004, 2352; Hufen, JuS 2003, 910, Anm. zu BVerfG [1. Kammer des Ersten Senats], NJW 2003, 1109 - Die Kategorie der Schmähkritik ist ausschließlich bei Wertungen anwendbar. Die Einordnung einer Äußerung als Werturteil oder als Tatsachen-behauptung ist für die rechtliche Beurteilung von Eingriffen in das Grundrecht auf Meinungsfreiheit von weichenstellender Bedeutung, vgl. BVerfGE 61, 1 [7f.] = NJW 1983, 1415; BVerfGE 99, 185 [196f.] = NJW 1999, 1322. Führt eine Tatsachenbehauptung zu einer Rechtsverletzung, hängt die rechtliche Bewertung vom Wahrheitsgehalt der Äußerung ab (vgl. BVerfGE 97, 391 [403f.] = NJW 1998, 2889; BVerfGE 99, 185 [201] = NJW 1999, 1233). Bewusst unwahre Tatsachenäußerungen genießen den Grundrechtsschutz überhaupt nicht (vgl. BVerfGE 54, 208 [219]. Ist die Wahrheit nicht erwiesen, wird die Rechtmäßigkeit der Beeinträchtigung eines anderen Rechtsguts davon beeinflusst, ob besondere Anforderungen, etwa an die Sorgfalt der Recherche, beachtet worden sind. Werturteile sind demgegenüber keinem Wahrheitsbeweis zugänglich. Sie sind grundsätzlich frei und können nur unter besonderen Umständen beschränkt werden, so wenn sie sich als Schmähkritik darstellen (vgl. BVerfGE 85, 1 [16f.] = NJW 1992, 1439). Die Veranlassung einer Presseveröffentlichung unterliegt dem Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG. Diese Norm schützt Äußerungen in ihrer Verbreitungs- und in ihrer Wirkungsdimension (vgl. BVerfGE 7, 198 [210] = NJW 1958, 257; BVerfGE 97, 391 [398] = NJW 1998, 2889). Vom Schutz umfasst ist das Recht des Äußernden, die Modalitäten einer Äußerung und damit das Verbreitungsmedium frei zu bestimmen (vgl. BVerfGE 54, 129 [138f.] OLG Köln, NJW 2009, 697.
[2] Die Verfassungsbeschwerde dient als subjektiv-öffentliches Verfahrensrecht dem Individualrechtsschutz des Bürgers gegen Grundrechtsverletzungen und sichert damit die unmittelbare Geltung der Grundrechte gem. Art. 1 Abs. 3 GG gegenüber den drei Staatsgewalten. Die Verfassungsbeschwerde ist ein subsidiärer und außerordentlicher Rechtsbehelf, BVerfGE 18, 325, der nicht zum garantierten Rechtsweg nach Art. 19 Abs. 4 GG gehört, BVerfGE 79, 367. Sie füllt eine Lücke im Rechtsschutzsystem, das traditionell, vgl. Endres, in BeckscherOnlineKommt, Art. 19 Abs. 4 GG, RN 51 ff, nur der Kontrolle der Exekutive dient, Umbach/Clemens/Clemens GG Art 93 RN 63. Sie ist nicht kontradiktorisch, BVerfGE 79, 367f, und nicht auf abstrakte Klärung einzelner Rechtsfragen ausgerichtet. Sie besitzt keinen Suspensiveffekt, Morgenthaler, in BeckscherOnlineKommt, Art. 93GG, RN 49. Da die Verfassungsbeschwerde auf eine nachträgliche Überprüfung der Grundrechtsrelevanz einer Maßnahme gerichtet ist, unterstützt der Erlass einer einstweiligen Anordnung die subjektiv-rechtliche Effizienz der Verfassungsbeschwerde bei irreparablen Grundrechtsverletzungen, Zuck, Das Recht der Verfassungsbeschwerde, 2006. Für Verfassungsbeschwerden ist nach § 93a Abs 1 BVerfGG die Annahme zur Entscheidung erforderlich, Morgenthaler, a.a.O., RN 53.
Eine Verfassungsbeschwerde kann nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, § 90 Abs. BVerfGG jedermann erheben, der Träger es Grundrechts ist auf dessen Verletzung er sich beruft. Die Verfassungsbeschwerde ist dem individuellen Grundrechtsschutz vorbehalten, Bethge, in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, § 90 BVerfGG, RN 34. Das Verfahrensrecht folgt der Grundrechtsberechtigung, Sturm, in Sachs, a.a.O., RN 82; die grundrechtliche Berechtigung natürlicher Personen ist der verfassungsrechtliche Regelfall, Sachs, vor Art. 2 GG, RN 70. In BVerfGE 45, 63 (74 f.) hat das BVerfG die Bedeutung der subjektiven Funktion klargestellt: „Diese doppelte Rechtsschutzfunktion kann das BVerfG aber nicht schlechthin wahrnehmen. Die Verfassungsbeschwerde ist nur dann gegeben, wenn die als verletzt bezeichnete Norm des objektiven Verfassungsrechts zugleich ein – im Katalog des Artikel 93 Absatz 1 Nr. 4 a aufgeführtes – subjektives Recht verbürgt. Die Rüge, ein subjektives Verfassungsrecht sei verletzt, ist Voraussetzung jeder Verfassungs-beschwerde. Eine Verfassungsbeschwerde, die lediglich die fehlerhafte Anwendung objektiven Verfassungsrechts rügt, ist – bereits aus diesem Grund – unzulässig.“ Das Recht der Verfassungsbeschwerde ist an die behauptete Verletzung von Grundrechten geknüpft, Schumann, Verfassungs- und Menschenrechtsbeschwerde gegen richterliche Entschei-dungen, 1963, S. 101; BVerfGE 45, 63 (74 f.).damit aber an den Begriff des subjektiven öffentlichen Rechts. Über diese Anknüpfung am deutlichsten, dass die Verfassungs-beschwerde eine subjektive Funktion hat.
Beschwerdegegenstand sind alle rechtlich relevanten Akte der an das GG gebundenen öffentlichen Gewalt, d. h. der gesetzgebenden, vollziehenden und rechtsprechenden Gewalt. Konkret überwiegend Gerichtsentscheidungen und Rechtssätze. Der Beschwerdeführer muss geltend machen, er werde vom Beschwerdegegenstand in seinen im GG verankerten Grundrechten verletzt. Auf die Verletzung landesverfassungsrechtlicher Regelungen, europäischen Gemeinschaftsrechts und objektiver Verfassungsnormen kann sich der Beschwerdeführer nicht berufen.
Ein Rechtsschutzbedürfnis besteht bei Vorliegen eines Rechtsgrundes. Dieser muss die Verfassungsbeschwerde als geeignetes, erforderliches und zumutbares verfassungs-prozessuales Rechtsschutzmittel für das Rechtsschutzbegehren des Beschwerdeführers ausweisen. Geeignet ist die Verfassungsbeschwerde nur, wenn der gedachte Erfolg der Verfassungsbeschwerde zum Erfolg des Rechtsschutzbegehrens des Beschwerdeführers führen würde, Zuck, Das Recht der Verfassungsbeschwerde, RN 714. Erforderlich ist sie, wenn kein anderes, den Weg zum BVerfG sparendes Rechtsschutzmittel zur Verfügung steht. Nur dann, wenn der Beschwerdeführer selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen ist, besteht ein Rechtsschutzbedürfnis für eine Verfassungsbeschwerde.
Die behauptete Grundrechtsverletzung muss im Zeitpunkt der Erhebung der Verfassungsbeschwerde tatsächlich vorliegen. Eine mögliche künftige Beeinträchtigung reicht nicht. Bei erledigten staatlichen Maßnahmen ist eine gegenwärtige Beschwer zu bejahen, wenn eine ernstliche Wiederholungsgefahr besteht. Der Rechtsweg muss gem. § 90 Abs. 2 BverfGG erschöpft sein, Sturm, Art. 94 GG, RN 15ff. Die wesentliche Funktion des Subsidiaritätsprinzips besteht in der Entlastung des BVerfG. Ihm soll nur geprüftes und rechtlich gewürdigtes Tatsachenmaterial vorgelegt werden, Sturm, Art. 94 GG, RN 16. "Substantiierung und Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde.", Lübbe-Wolff, EuGRZ 2004, 669 - Zu effizienter Rechtsschutzgewährung gehört eine effiziente Arbeitsteilung zwischen Rechtsschutzsuchendem und Gericht und, im Fall der Verfassungs-gerichtsbarkeit, eine effiziente Arbeitsteilung zwischen dieser und der Fachgerichtsbarkeit. § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG stellt klar, dass der Rechtsweg vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde erschöpft sein muss. Eine zunächst unzulässige Verfassungs-beschwerde kann nicht durch nachträgliche Rechtswegerschöpfung zulässig gemacht werden, BVerfGE 94, 166 (214); zustimmend Bethge, in Maunz, u. a., § 90 BverfGG, RN 396. Wurde ein eröffneter Rechtsweg bei Erhebung der Verfassungsbeschwerde noch nicht einmal beschritten, so ist die Verfassungsbeschwerde unzulässig.
Rechtsweg sind die gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten ein zuständiges Gericht anzurufen. In Verwaltungsrechtsangelegenheiten zwingt das Gebot der vorherigen Rechtswegerschöpfung nach § 90 Abs. 2 S. 1 BVerfGG angesichts des breit ausgebauten Verwaltungsrechtsschutzes dazu, zunächst die Rechtsbehelfe der VwGO auszuschöpfen. Auch der subsidiäre Rechtsweg des Art. 19 Abs. 4 S. 2 GG, das Normkontrollverfahren nach § 47 VwGO und die Mittel vorläufigen Rechtsschutzes gehören dazu, Pestalozza, Verfassungsprozessrecht, § 12 RN 46; Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, RN 525 ff.; Warmke und Posser, Die Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde, jeweils 1993. Der Rechtsweg ist erschöpft, wenn alle zulässigen Rechtsbehelfe form- und fristgerecht eingelegt wurden. Als zusätzliche und ungeschriebene Anforderung an die Zulässigkeit muss der Betroffene ferner alle zur Verfügung stehenden, ihm zumutbaren verfahrensrechtlichen Möglichkeiten ergreifen, um eine Korrektur der Verfassungsverletzung zu erreichen, BVerfGE 63, 78f; Sturm, RN 20. Dazu rechnen etwa formlos Rechtsbehelfe wie Gegenvorstellungen, Buchheister. Verfassungsbeschwerde und Gegenvorstellung, NVwZ 2000, 1356ff - Der dem Gebot der Rechtswegerschöpfung zugrundeliegende bzw. - je nach Betrachtungsweise – es überlagernde, Posser, Die Subsidiarität der Verfassungs-beschwerde, 1993, S. 385 f., Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde verpflichtet den Beschwerdeführer unter anderem dazu, über die bloße Rechtsweg-erschöpfung hinaus alle weiteren in Betracht kommenden Möglichkeiten zu nutzen, um die in Rede stehende Grundrechtsverletzung vor den Fachgerichten zu verhindern oder zu beseitigen, solange derartige Bemühungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Verfahrensordnung und Rechtsprechungspraxis nicht von vornherein aussichtslos erscheinen (formelle Subsidiarität), BVerfGE 86, 15 (22) = NJW 1992, 1676. Die Gegenvorstellung zählt mangels gesetzlicher Ausgestaltung nicht zum Rechtsweg im engeren Sinne; ein Beschwerdeführer kann deshalb auf die Möglichkeit eines solchen formlosen Rechtsbehelfs nur dann verwiesen werden, wenn insoweit der Aspekt der formellen Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde eingreift. Das BVerfG hat sich bisher darauf beschränkt, unter Auseinandersetzung mit der jeweiligen fachgerichtlichen Rechtsprechung zur Frage der Abänderbarkeit unanfechtbarer Entscheidungen darauf hinzuweisen, dass eine Selbstkontrolle der Fachgerichte in Fällen groben prozessualen Unrechts von Verfassungs- wegen nahe liege, dass aber der Beschwerdeführer angesichts der insoweit nicht gesicherten oder die Möglichkeit einer solchen Selbstkontrolle sogar verneinenden Rechtsprechung der Fachgerichte gegenwärtig nicht auf den Rechtsbehelf der Gegenvorstellung verwiesen werden könne, BVerfGE 63, 77 (79) = NJW 1983, 1900 Geht es um die Beseitigung groben prozessualen Unrechts, ist es danach grundsätzlich zumutbar, Abhilfe zunächst durch Einlegung auch eines außerordentlichen Rechtsbehelfs im fachgerichtlichen Verfahren zu suchen. Die Monatsfrist zur Einlegung der Verfassungsbeschwerde wird durch eine auf einen solchen Rechtsbehelf hin ergehende Entscheidung neu in Lauf gesetzt“, BVerfG, NJW 1997, 46 (47). Wenn mit der Verfassungsbeschwerde ein unmittelbarer Grundrechtseingriff durch eine Rechtsnorm geltend gemacht wird und effektiver Rechtsschutz nicht gewährt wurde, BVerfGE 113, 362, oder das Abwarten des Betroffenseins unzumutbar ist, BVerfGE 115, 137ff, ist eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar zulässig.
Form und Inhalt der Verfassungsbeschwerde
Die Verfassungsbeschwerde ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Die Begründung muss mindestens folgende Angaben enthalten (§ 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG):
Der Hoheitsakt (gerichtliche Entscheidung, Verwaltungsakt, Gesetz), gegen den sich die Verfassungsbeschwerde richtet, muss genau bezeichnet werden (bei gerichtlichen Entscheidungen und Verwaltungsakten sollen Datum, Aktenzeichen und Tag der Verkündung bzw. des Zugangs angegeben werden). Das Grundrecht oder grundrechtsähnliche Recht, das durch den beanstandeten Hoheitsakt verletzt sein soll, muss benannt oder jedenfalls seinem Rechtsinhalt nach bezeichnet werden. Es ist darzulegen, worin im Einzelnen die Grundrechtsverletzung erblickt wird. Hierzu sind auch die mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Gerichtsentscheidungen, Bescheide usw. in Ausfertigung, Abschrift oder Fotokopie vorzulegen. Zumindest muss ihr Inhalt aus der Beschwerdeschrift ersichtlich sein.
Die Verfassungsbeschwerde gegen Entscheidungen der Gerichte und Behörden ist nur innerhalb eines Monats zulässig. Auch die Begründung muss innerhalb dieser Frist eingereicht werden (§ 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). Konnte der Beschwerdeführer die Frist ohne Verschulden nicht einhalten, so kann binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt und die Verfassungsbeschwerde nachgeholt werden. Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind glaubhaft zu machen. Das Verschulden eines Verfahrensbevollmächtigten bei der Fristversäumung steht dem Verschulden des Beschwerdeführers gleich (§ 93 Abs. 2 BVerfGG), Graßhof, in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Bethge, BVerfGG, § 93 b BVerfGG, RN 31.
[3] Nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz (§ 1 Abs. 1) ist das Bundesverfassungs-gericht ein unabhängiger Gerichtshof des Bundes, also Rechtsprechungsorgan, gleichzeitig aber ein neben den „übrigen Verfassungsorganen des Bundes“ selbständiges Verfassungsorgan des Bundes, Maunz, in Maunz/Dürig, Art. 94 GG, RN 1. Seine Entscheidungen sind gerichtliche Rechtserkenntnisse, nicht politische Willensakte. Das BVerfG sichert den Vorrang der Verfassung und gewährleistet die Aktualität des Verfassungsrechts. Die Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit ist die komplementäre Garantie zu Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 1 Abs. 3 GG. Zum formellen Verfassungsrecht in diesem Sinne gehören sämtliche Bestandteile des geschriebenen Verfassungsrechts, auch das „soft constitutional law“ der Präambel, BVerfGE 36, 1 (17); Isensee , HStR I, 1987, § 13 RN 4 mit Fn. 1; Häberle , Festschrift für Johannes Broermann, 1982, S. 211 ff.; Dreier , in: Dreier (Hrsg.), GG, Bd. I, 1996, Präambel RN 8 ff. Als formelles Verfassungsrecht gelten darüber hinaus auch die rechtlichen Ableitungen des Bundesverfassungsgericht aus den Grundrechten als offenen Normen, Lerche , Festschrift zum 50 jährigen Bestehen des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, 1997, S. 82. Als materielles Verfassungsrecht wird in erster Linie neben dem Grundgesetz bestehendes (also praeterkonstitutionelles) Recht auf der formalen Ranghöhe des Grundgesetzesrechts genannt; darüber hinaus wird darunter auch einfaches (also subkonstitutionelles) Recht verstanden, das das in Teilen defizitäre Grundgesetz ergänzt (Parteienrecht, Parlaments-Wahlrecht, Abgeordneten- und Ministerrecht), Dazu Isensee , HStR I, 1987, § 13 RN 140 ff.; Bartlsperger , HStR IV, 1990, § 96 RN 13; kritisch Hesse , in: Benda/Maihofer/Vogel, Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl. 1994, § 1 RN 3 mit Fußnote 4. Das BVerfG als Hüter der Verfassung, krit. Pieroth, Art. 93 RN 3, hat auf zulässigen Antrag die verfassungsrechtlichen Normen verbindlich auszulegen. Es soll durch seine Tätigkeit darauf hinwirken, dass die Staatsgewalt die formellen und materiell-rechtlichen Grenzen ihrer Tätigkeit beachtet und die obersten verfassungsrechtlichen Rechtswerte verwirklicht. Die Aufgabe der „schöpferischen Rechtsfindung“, BVerfGE 34, 287f, schließt die Verfassungsfortbildung ein, BVerfGE 74, 350f; Sturm, in Sachs, Art. 93 RN 5. Das BVerfG hat allerdings kein Auslegungsmonopol, BVerfG, 2, 131- Die Verfassungskonkretisierung ist auch Aufgabe der anderen Verfassungsorgane. Das BVerfG ist keine Superrevisionsinstanz; es hat aber unter Anwendung der verfassungsrechtlichen Vorschriften Kassationsbefugnis, Robbers, Für ein neues Verhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht und Fachgerichtsbarkeit, NJW 1998, 935ff - das BVerfG hat zwar die Gestaltung des Verfahrens, die Feststellung und Würdigung des Tatbestandes, die Auslegung des einfachen Rechts und seine Anwendung auf den einzelnen Fall als alleinige Sache der dafür allgemein zuständigen Gerichte bezeichnet. Damit sind aber keine Bereichsausnahmen gegenüber dem Verfassungsrecht gemeint; Judicial self-restraint ist eher eine richterliche Tugend während der Kompetenzausübung als eine taugliche Formel zur Kompetenzabgrenzung. Gemeinhin überspielt sie die Bindung des BVerfG an Verfassung und einfaches Recht. Das Gericht ist der Gesetzesbindung, nicht der Selbstbindung unterworfen. Berkmann, DVBl 1996, 1028ff. Die Fachgerichte sind für die Auslegung des einfachen Rechts zuständig. Die Gestaltung des Verfahrens, die Feststellung und Würdigung des Tatbestandes und die Auslegung der Gesetze und deren Anwendung auf den Einzelfall ist den Fachgerichten zugewiesen. Das BVerfG prüft allerdings, ob Grundrechte verletzt sind und besonders krass dem Gerechtigkeitsgefühl (willkürlich) widersprechen, vgl. BVerfGE 42, 72f; BVerfG, NVwZ 2006, 450 - Dabei ist bei der verfassungsgerichtlichen Prüfung von Urteilen der Fachgerichte zu berücksichtigen, dass die Auslegung des Gesetzes und seine Anwendung auf den einzelnen Fall Sache der dafür zuständigen Gerichte ist und sich einer Nachprüfung durch das BVerfG grundsätzlich entziehen. Ihm obliegt lediglich die Kontrolle, ob die Gerichte bei der Anwendung des so genannten einfachen Rechts Verfassungsrecht verletzt haben, vgl. BVerfGE 18, 85 [92f.] = NJW 1964, 1715. Richtet sich eine Verfassungsbeschwerde gegen eine höchstrichterliche Entscheidung, die eine Änderung der bisherigen Rechtsprechung vornimmt, ist das BVerfG darauf beschränkt zu prüfen, ob richterliche Willkür vorliegt (vgl. BVerfG [3. Kammer des Ersten Senats] , NVwZ 2005, 81 = NJW 2005, 409 L = SozR 4-8570 § 5 Nr. 4). Willkürlich ist ein Richterspruch nur, wenn er unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar ist und sich daher der Schluss aufdrängt, dass er auf sachfremden Erwägungen beruht (vgl. BVerfGE 89, 1 [13f.] = NJW 1993, 2035). Dabei setzt das BVerfG die Eingriffsintensität in Relation zur verfassungsgerichtlichen Überprüfung; je nachhaltiger die Belastung, desto weit reichender die Kontrolle, BVerfGE 42, 149. Das BVerfG hat in seiner Maastricht-Entscheidung (NJW 1993, 3047 = EuZW 1993, 667) hervorgehoben, dass es seine Rechtsprechung in Kooperation mit dem EUGH ausübt. Gleichzeitig hat es sich die Kompetenz vorbehalten, „ausbrechende“ Rechtsakte der Gemeinschaft für in Deutschland unverbindlich zu erklären. Anders als für die deutschen Fachgerichte sind für das BVerfG die Gemeinschaftsgrundrechte ebenso wie das übrige Gemeinschaftsrecht kein Kontrollmaßstab. Der Prüfungsumfang der Fachgerichte erstreckt sich auf die gesamte Rechtsordnung, zu der auch das europäische Gemeinschaftsrecht gehört, Papier, Die Zeit, vom 3. Juli 2008, S. 8.
[4] Vgl. BVerfGE 33, 1 <14>; 93, 266 <289>.
[5] Vgl. BVerfGE 7, 198 <210>; 61, 1 <8>; 85, 1 <14>; 90, 241 <247>.
[6] Vgl. BVerfGE 54, 129 <138 f.>; 61, 1 <7 f.>; 93, 266 <289>; BVerfGK 8, 89 <96>. Das Grundrecht aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG unterliegt gesetzlichen Schranken, Art. 5 Abs. 2 GG. Zu diesen gehört § 823 Abs. 1 BGB (vgl. BVerfGE 82, 272 [280] = NJW 1991, 95; BVerfGE 97, 125 [148] = NJW 1998, 1381). Auslegung und Anwendung von Vorschriften des einfachen Rechts sind grundsätzlich Angelegenheit der Fachgerichte, die dabei das Grundrecht der Meinungsfreiheit zu berücksichtigen haben (vgl. BVerfGE 7, 198 [205ff.] = NJW 1958, 257; BVerfGE 101, 361 [388] = NJW 2000, 1021). Ein Grundrechtsverstoß, den das BVerfG zu korrigieren hat, liegt insbesondere dann vor, wenn das Zivilgericht den grundrechtlichen Einfluss bei der Deutung der Äußerung, bei ihrer rechtlichen Einordnung oder bei der Herstellung des Ausgleichs zwischen den Rechtsgütern überhaupt nicht berücksichtigt oder unzutreffend eingeschätzt hat und die Entscheidung auf der Verkennung des Grundrechtseinflusses beruht (vgl. BVerfGE 97, 391 [401] = NJW 1998, 2889). Der Begriff der Schmähung wird in der zivil- und verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung mit Rücksicht auf das Grundrecht der Meinungsäußerung eng verstanden. Wertungen sind grundsätzlich frei von Bindungen. Auch eine überzogene, polemische oder gar ausfällige Kritik reicht für sich genommen nicht aus, um eine Beschränkung zu rechtfertigen. Anders liegt es aber, wenn bei der Äußerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht (vgl. BGHZ 45, 296 [306ff.] = NJW 1966, 1617; BVerfGE 93, 266 [294, 303] = NJW 1995, 3303.
- Quote paper
- Prof. Dr. Dr. Assessor jur., Mag. rer. publ. Siegfried Schwab (Author), 2009, Äußerung "Durchgeknallter Staatsanwalt" stellt nicht zwingend eine Beleidigung dar, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139342