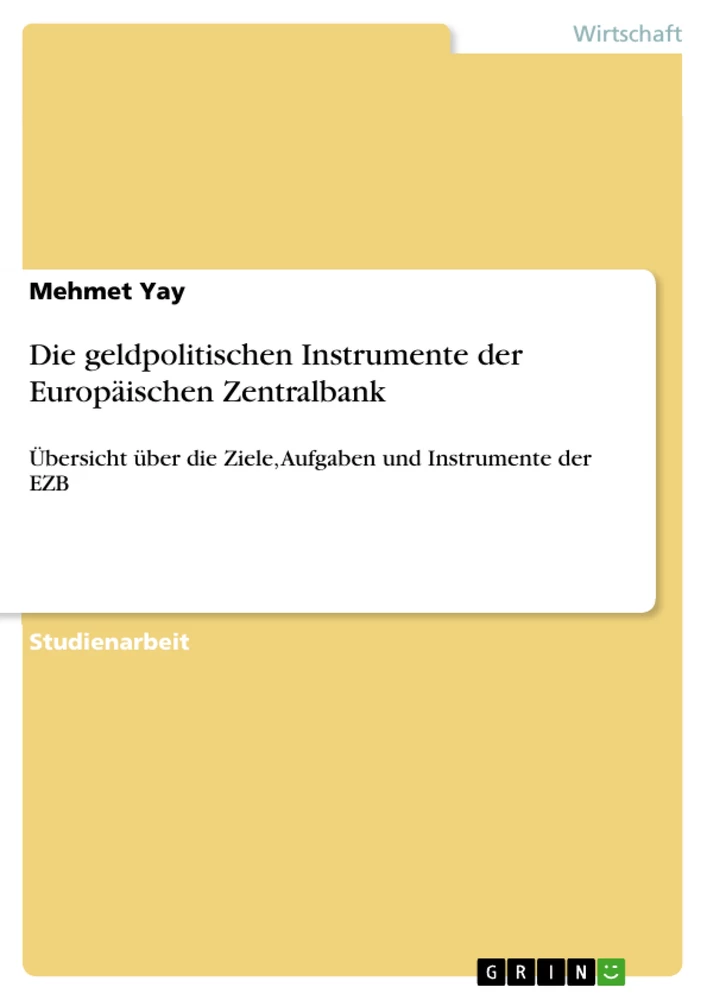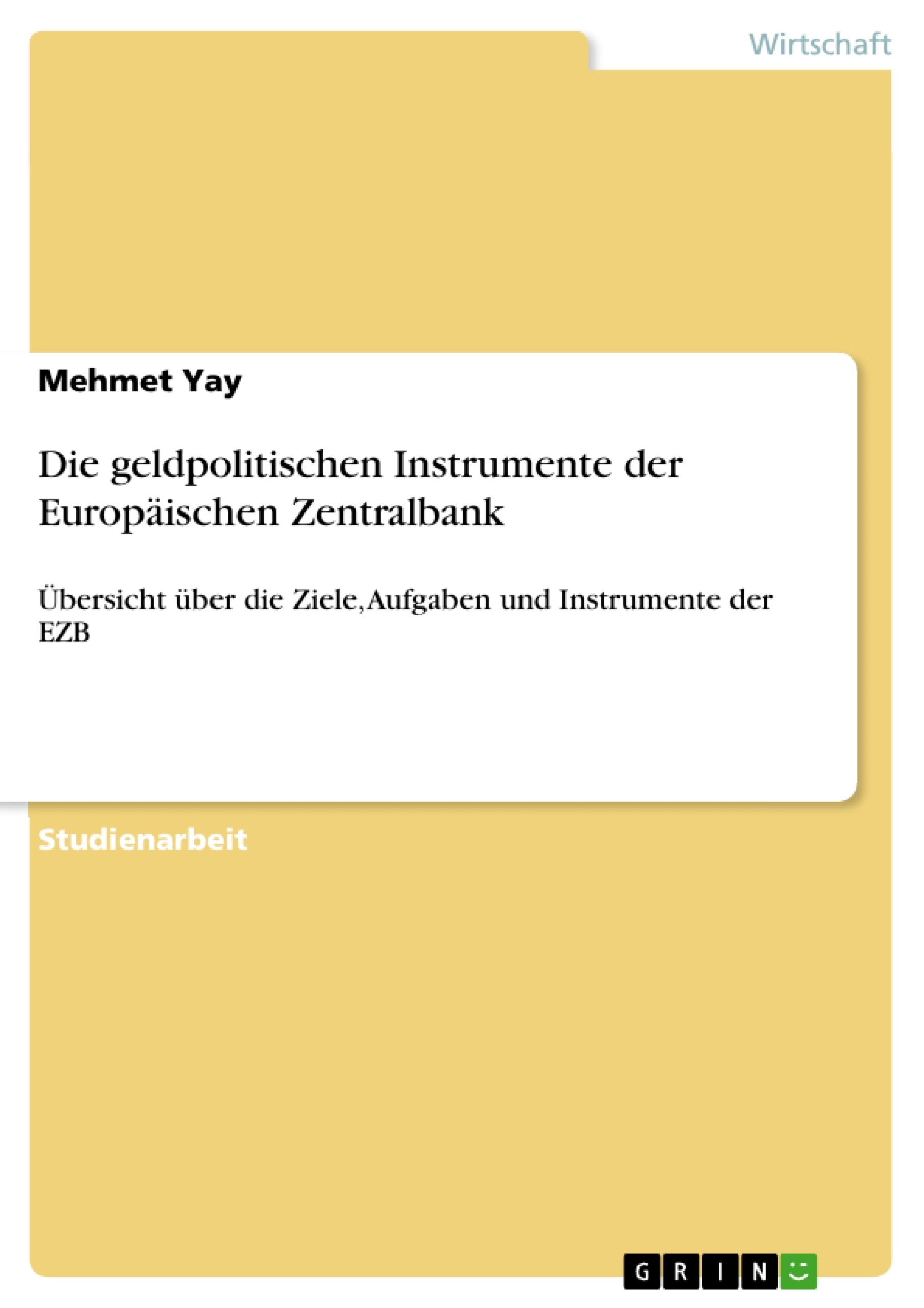Am Anfang des 19. Jahrhunderts regierte in Deutschland ein „Münzwirrwarr“, das ganz wesentlich die ökonomische Expansion in Deutschland behinderte. Zwei Entwicklungen sollten nun langfristig zur Lösung des Problems beitragen: die allmähliche Verbreitung von Papiergeld und die Versuche zur Kontrolle des Geldumlaufs durch eine Zentralnotenbank.
Bis diese Entwicklungen jedoch zu einem zufrieden stellenden Ergebnis führten, musste man sich noch im bestehenden Münzgeldsystem behelfen. Dies gelang durch eine Vereinheitlichung der verschiedenen Münzsysteme seit 1837/38 im Zollverein. Daraus entwickelte sich ein relativ einheitliches Münz-Währungsgebiet, auf der Basis des Silberstandards mit festen Wechselkursen zwischen den beiden Hauptwährungen Taler und Gulden.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es kaum Banknoten, noch dominierten Gold und Silbermünzen als Zahlungsmittel neben dem Staatspapiergeld. Erst mit der Gründung der Preußischen Bank 1846 erlangte die Banknote gegenüber dem Staatspapiergeld endgültig den Vorrang. Zuvor dienten diese „Tresorscheine“ als Hilfsmittel für die Händler und sollten die Expansion der Wirtschaft fördern.
Die Preußische Bank, eine private Aktiengesellschaft mit Staatsbeteiligung, war der staatlichen Kontrolle unterworfen. Sie emittierte etwa zwei Drittel des gesamten Notenumlaufs, was sie zum führenden Institut machte. Davor waren bereits Private Notenbanken unter Staatskontrolle in Bayern und Sachsen entstanden. Dadurch kam es verstärkt zur Gründung von „Zettelbanken“, die dazu beitrugen, dass sich Papiergeld neben Münzen als allgemeines Zahlungsmittel in Deutschland durchsetzte.
Mit der Münzreform um 1870 und der Schaffung der Reichsbank gelang es einen homogenen Münzumlauf in Deutschland zu schaffen. Die Reichsbank etablierte sich zunehmend zur dominierenden Zentralnotenbank und erhielt im Laufe der Zeit zusätzliche Kompetenzen. Daneben entwickelte sie sich auch zum Reservehalter des außerordentlich stark expandierenden Systems privater Geschäftsbanken. In dieser Funktion schaffte die Reichsbank durchaus moderne Elemente in der Geldpolitik, wie z.B. den geschickten Einsatz der Variationen des Diskontsatzes oder des Handels mit Staatspapieren am offenen Markt.
Mit der Errichtung der Reichsbank und der späteren Deutschen Bundesbank war es gelungen, das Geld besser zu steuern, wie auch die Preise zu stabilisieren. Die Deutsche Bundesbank hat hierbei stilbildend für die Ausbildung einer Stabilitätskultur in Europa...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziele und Aufgaben der EZB
- Organisation und Struktur der EZB
- Beschlussorgane und Ihre Aufgaben
- Zentralbankunabhängigkeit
- Geldpolitische Steuerungsinstrumente der EZB
- Offenmarktgeschäfte
- Tenderverfahren
- Transaktionsarten
- Arten von Offenmarktgeschäften
- Hauptrefinanzierungsgeschäfte
- Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte
- Feinsteuerungsoperationen
- Strukturelle Operationen
- Ständige Fazilitäten
- Spitzenrefinanzierungsfazilität
- Einlagenfazilität
- Mindestreserven
- Festlegung und Haltung von Mindestreserven
- Funktionen von Mindestreserven
- Offenmarktgeschäfte
- Zusammenfassung
- Die aktuelle Geldpolitik der EZB
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die geldpolitischen Instrumente der Europäischen Zentralbank (EZB). Das Hauptziel ist es, ein umfassendes Verständnis der EZB's Rolle in der Sicherung der Preisstabilität und der Unterstützung der Wirtschaftspolitik der EU zu vermitteln. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Instrumente, die der EZB zur Verfügung stehen, um ihre Ziele zu erreichen.
- Die Ziele und Aufgaben der EZB
- Die Organisation und Struktur der EZB
- Die geldpolitischen Steuerungsinstrumente der EZB (Offenmarktgeschäfte, Ständige Fazilitäten, Mindestreserven)
- Die historische Entwicklung der Geldpolitik in Deutschland als Vorbild für die EZB
- Die aktuelle Geldpolitik der EZB (ohne detaillierte Schlussfolgerungen)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert den historischen Kontext der Geldpolitik in Deutschland, beginnend mit dem "Münzwirrwarr" des 19. Jahrhunderts und der allmählichen Entwicklung hin zu einem einheitlichen Währungssystem durch die Gründung der Preußischen Bank und später der Reichsbank. Der Text betont die Bedeutung der Reichsbank als Vorbild für die EZB und ihren Beitrag zur Stabilitätskultur in Europa. Die Entstehung der Europäischen Währungsunion wird kurz angerissen, wobei der Fokus auf dem Bedürfnis nach europäischer Wechselkursstabilität liegt. Der Artikel 106 EG-Vertrag, der die ausschließliche Befugnis der EZB zur Ausgabe von Banknoten beschreibt, wird zitiert.
Ziele und Aufgaben der EZB: Dieses Kapitel definiert das primäre Ziel der EZB als die Gewährleistung der Preisniveaustabilität und ihre sekundäre Aufgabe, die Wirtschaftspolitik der EU mit dem Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus und dauerhaften Wachstums zu unterstützen. Es listet die grundlegenden Aufgaben der EZB auf, wie die Festlegung und Durchführung der Geldpolitik, die Förderung des Zahlungsverkehrs, die Verwaltung der Währungsreserven und die Devisengeschäfte. Zusätzliche Aufgaben wie die Genehmigung der Ausgabe von Euro-Banknoten und die Aufsicht über Kreditinstitute werden ebenfalls erwähnt.
Organisation und Struktur der EZB: Der Abschnitt beschreibt die Beschlussorgane des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB): den EZB-Rat, das Direktorium und den Erweiterten Rat. Die Zusammensetzung und die jeweiligen Aufgaben dieser Organe werden detailliert erläutert. Es wird implizit auf die Bedeutung der Zentralbankunabhängigkeit eingegangen, jedoch ohne konkrete Ausführungen.
Geldpolitische Steuerungsinstrumente der EZB: Dieses Kapitel stellt die verschiedenen geldpolitischen Instrumente der EZB vor. Es analysiert die Offenmarktgeschäfte (Hauptrefinanzierungsgeschäfte, längerfristige Refinanzierungsgeschäfte, Feinsteuerungsoperationen, strukturelle Operationen), die ständigen Fazilitäten (Spitzenrefinanzierungsfazilität und Einlagenfazilität) sowie die Mindestreserven und ihre Funktionen. Die verschiedenen Mechanismen und ihre Auswirkungen auf die Geldmenge werden implizit angesprochen, ohne jedoch in Details einzugehen.
Schlüsselwörter
Europäische Zentralbank (EZB), Geldpolitik, Preisniveaustabilität, Offenmarktgeschäfte, Ständige Fazilitäten, Mindestreserven, Zentralbankunabhängigkeit, Wirtschaftspolitik, Euro, Devisengeschäfte, Reichsbank, Deutsche Bundesbank, Währungsunion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Geldpolitische Instrumente der Europäischen Zentralbank (EZB)
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über die geldpolitischen Instrumente der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der EZB's Rolle in der Sicherung der Preisstabilität und der Unterstützung der Wirtschaftspolitik der EU, unter Berücksichtigung verschiedener geldpolitischer Instrumente.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (mit historischem Kontext der Geldpolitik in Deutschland), Ziele und Aufgaben der EZB, Organisation und Struktur der EZB (inkl. Beschlussorgane), Geldpolitische Steuerungsinstrumente der EZB (Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten, Mindestreserven), Zusammenfassung und die aktuelle Geldpolitik der EZB (ohne detaillierte Schlussfolgerungen).
Welche geldpolitischen Instrumente der EZB werden behandelt?
Die Hausarbeit analysiert detailliert die folgenden geldpolitischen Instrumente: Offenmarktgeschäfte (Hauptrefinanzierungsgeschäfte, längerfristige Refinanzierungsgeschäfte, Feinsteuerungsoperationen, strukturelle Operationen), ständige Fazilitäten (Spitzenrefinanzierungsfazilität und Einlagenfazilität) sowie Mindestreserven. Die Funktionsweise und die Auswirkungen dieser Instrumente auf die Geldmenge werden erläutert, jedoch ohne tiefgreifende Detailanalysen.
Welche Rolle spielt die historische Entwicklung der Geldpolitik in Deutschland?
Die Einleitung der Hausarbeit skizziert den historischen Kontext der Geldpolitik in Deutschland, beginnend mit dem "Münzwirrwarr" des 19. Jahrhunderts bis zur Reichsbank. Die Reichsbank wird als wichtiges Vorbild für die EZB und ihren Beitrag zur Stabilitätskultur in Europa hervorgehoben. Dieser historische Rückblick dient als Grundlage für das Verständnis der heutigen EZB und ihrer Aufgaben.
Was sind die Ziele und Aufgaben der EZB laut der Hausarbeit?
Das primäre Ziel der EZB ist laut der Hausarbeit die Gewährleistung der Preisniveaustabilität. Sekundär unterstützt sie die Wirtschaftspolitik der EU mit dem Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus und dauerhaften Wachstums. Zu ihren Aufgaben gehören die Festlegung und Durchführung der Geldpolitik, die Förderung des Zahlungsverkehrs, die Verwaltung der Währungsreserven und Devisengeschäfte sowie die Aufsicht über Kreditinstitute.
Wie ist die EZB organisiert und strukturiert?
Die Hausarbeit beschreibt die Beschlussorgane des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB): den EZB-Rat, das Direktorium und den Erweiterten Rat. Die Zusammensetzung und Aufgaben dieser Organe werden detailliert erläutert. Die Bedeutung der Zentralbankunabhängigkeit wird implizit angesprochen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Europäische Zentralbank (EZB), Geldpolitik, Preisniveaustabilität, Offenmarktgeschäfte, Ständige Fazilitäten, Mindestreserven, Zentralbankunabhängigkeit, Wirtschaftspolitik, Euro, Devisengeschäfte, Reichsbank, Deutsche Bundesbank, Währungsunion.
- Quote paper
- Mehmet Yay (Author), 2006, Die geldpolitischen Instrumente der Europäischen Zentralbank, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139253