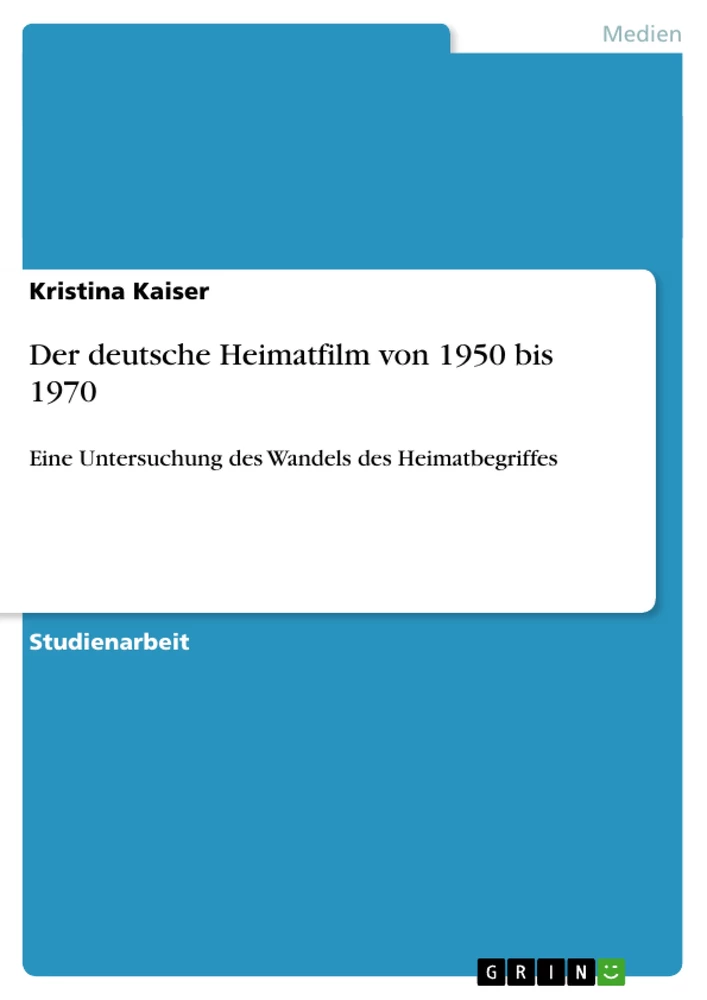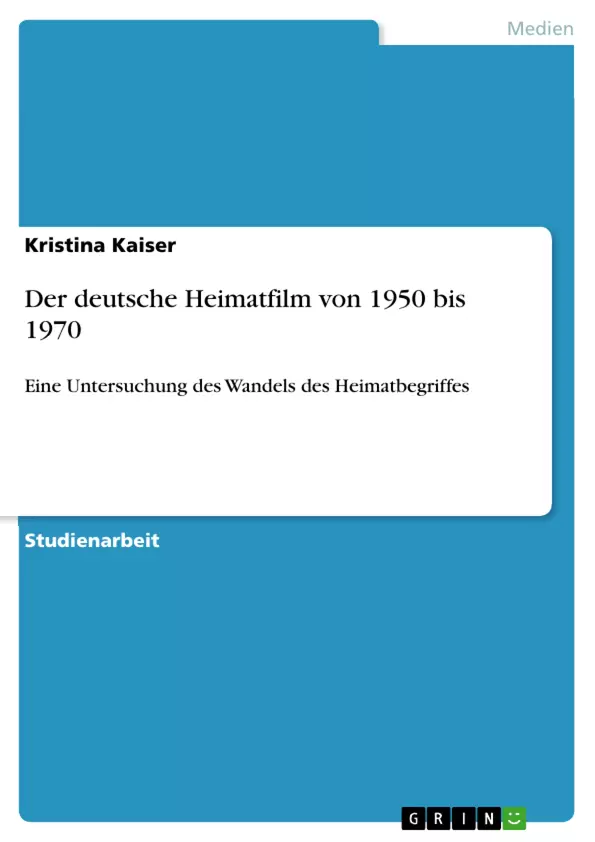Denkt man an Heimatfilme, denkt man an Idylle, beeindruckenden Berglandschaften, Alpenglühen, Kuhglocken und kleine Dörfer. Man assoziiert seichte Handlungsstränge und imposante Naturaufnahmen von Schwarzwald, Heide und den Alpen. Geschichten um wahre Freundschaft und Liebe, Dirndl- und Zopftragende Mädchen, sowie Wilderer und Förster mit bayerischem oder österreichischem Dialekt.
Deutschsprachige Heimatfilme sind Filme, die meist eine heile Welt darstellen. Es geht um Freundschaft Liebe Familie und um das Leben in der dörflichen Gemeinschaft. Die Handlung der Filme spielt meist in Bergen Österreichs Bayerns oder der Schweiz und ist klar und durchschaubar. Doch macht allein dies den Charakter der Gattung aus? Und warum war gerade der Heimatfilm beim deutschen Publikum einmal ein so extrem beliebtes und erfolgreiches Genre, das heute offiziell so konsequent abgelehnt wird?
Es gibt wohl kaum jemanden, der von sich sagen kann, dass er nicht schon einmal zwischen unbedachtem Sarkasmus und verstecktem Wohlgefallen, die als trivial und banal verschrienen Heimatfilme angesehen hat. Für manch einen mag es nur schwer zu verstehen sein, wie dieses Genre in den Nachkriegsjahren einen solch großen Zuspruch beim Publikum erfahren konnte und diesen teilweise auch heute noch hat, denkt man nur an die konstant hohen Einschaltquoten auch bei wiederholter Ausstrahlung im Fernsehen.
Der Heimatfilm gilt als die einzige genuine Genre-Hervorbringung des deutschen Films überhaupt - mit all seinen negativen Konnotationen: Deutschtum, Blut und Boden und Kitsch. Der Heimatfilm war für die Bundesdeutsche Nachkriegszeit das, was der Western für Amerika war, nämlich das Filmgenre par excellence. In der Zeit zwischen 1947 und 1960 machten Heimatfilme ca. ein Viertel aller Filme aus.
Dagegen sind die kritischen Heimatfilme, die Ende der sechziger Jahre entstanden sind, heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Junge Regisseure wie Volker Schlöndorff, Peter Fleischmann und Rainer Werner Fassbinder zeigten eine andere Sicht auf die Heimat, als es bisher üblich war. Ein neuer Realismus hielt Einzug in das Genre...
Ziel dieser Arbeit soll es sein, den bundesdeutschen Heimatfilm der fünfziger mit dem der sechziger Jahre sowohl inhaltlich, als auch stilistisch zu vergleichen und auch die gesellschaftspolitischen Hintergründe zu beleuchten. Im Speziellen sollen die grundsätzlichen Unterschiede der Interpretation des Heimatbegriffes herausgearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist eigentlich Heimat?
- 3. Das Genre Heimatfilm - Definition
- 4. Die Wurzeln des Genres
- 5. Der traditionelle Heimatfilm der Nachkriegszeit
- 5.1 Die gesellschaftspolitische Lage nach 1945
- 5.2 Heile Welt und Alpenglühen
- 5.3 Der Heimatbegriff im Heimatfilm der Fünfzigerjahre
- 5.4 Bedeutung und Erfolg
- 6. Der kritische Heimatfilm
- 6.1 Die gesellschaftspolitische Lage am Ende der Sechzigerjahre
- 6.2 Sozialkritik im Heimatfilm - Terror des Idylls
- 6.3 Die Umkehrung des Heimatbegriffes
- 7. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist ein inhaltlicher und stilistischer Vergleich der bundesdeutschen Heimatfilme der 1950er und 1960er Jahre, unter Berücksichtigung der gesellschaftspolitischen Hintergründe. Im Fokus steht die unterschiedliche Interpretation des Heimatbegriffs in beiden Epochen. Die Arbeit beginnt mit einer Annäherung an den Begriff "Heimat" und einem historischen Überblick über die Entwicklung des Genres.
- Entwicklung des Heimatfilmgenres von den Nachkriegsjahren bis in die 1960er Jahre.
- Wandel des Heimatbegriffs im Laufe der Zeit und seine Reflexion im Film.
- Gesellschaftspolitische Einflüsse auf die Darstellung von Heimat im Film.
- Unterschiede zwischen traditionellen und kritischen Heimatfilmen.
- Bedeutung und Erfolg des Heimatfilms als Genre.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des deutschen Heimatfilms ein und stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor: Wie hat sich der Heimatbegriff im Laufe der Zeit verändert, und warum war der Heimatfilm in der Nachkriegszeit so erfolgreich, während er heute oft kritisch betrachtet wird? Die Einleitung etabliert den Gegensatz zwischen der idyllischen Vorstellung von Heimatfilmen und der komplexeren Realität, die in späteren kritischen Werken reflektiert wird.
2. Was ist eigentlich Heimat?: Dieses Kapitel analysiert den vielschichtigen Begriff "Heimat" selbst. Es werden verschiedene Definitionen aus Lexika und wissenschaftlichen Arbeiten herangezogen, um die räumliche und emotionale Dimension des Begriffs herauszuarbeiten. Die Diskussion umfasst die Verbindung von Heimat mit einem Ort, Gefühlen, Erinnerungen und der Rolle der Sozialisation. Das Kapitel beleuchtet die Ambivalenzen und Ideologisierungen, die mit dem Begriff verbunden sind, und legt den Grundstein für die spätere Analyse der filmischen Darstellungen.
3. Das Genre Heimatfilm - Definition: Dieses Kapitel befasst sich mit den Schwierigkeiten, eine präzise Definition für das Genre "Heimatfilm" zu finden. Es wird die Sichtweise von Wolfgang Kaschuba präsentiert, der den Heimatfilm als ein Konglomerat verschiedener Genres sieht, welches eine genaue Abgrenzung erschwert. Die Kapitel diskutiert unterschiedliche Definitionsversuche aus Wörterbüchern und Enzyklopädien und stellt die Einzigartigkeit des Genres im Kontext der deutschen Filmgeschichte heraus.
5. Der traditionelle Heimatfilm der Nachkriegszeit: Der fünfte Kapitel beschreibt den traditionellen Heimatfilm der Nachkriegszeit. Es beleuchtet die gesellschaftspolitische Lage, die zur Entstehung dieses Genres beigetragen hat. Es werden die typischen Merkmale des traditionellen Heimatfilms, wie die Darstellung einer idealisierten „Heilen Welt“, die Fokussierung auf Natur, Freundschaft und Familie, sowie die Verwendung regionaler Dialekte analysiert. Die Bedeutung und der Erfolg dieses Genres in der Nachkriegsgesellschaft werden ebenfalls untersucht.
6. Der kritische Heimatfilm: Dieses Kapitel behandelt den Wandel des Heimatfilms in den 1960er Jahren. Es analysiert die gesellschaftspolitische Lage, die zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Genre und dem Heimatbegriff führte. Die Kapitel erörtert die Sozialkritik und den „Terror des Idylls“, wie er in den Filmen dieser Zeit dargestellt wird, sowie die Umkehrung des traditionellen Heimatbegriffes. Die neuen realistischen Darstellungen im Gegensatz zum traditionellen Heimatfilm werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Heimatfilm, Heimatbegriff, Nachkriegsdeutschland, Sozialkritik, Idylle, Genredefinition, Tradition, Wandel, Realismus, Gesellschaftspolitik, Filmgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum deutschen Heimatfilm
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert und vergleicht bundesdeutsche Heimatfilme der 1950er und 1960er Jahre. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und dem Wandel des Heimatbegriffs in diesen beiden Jahrzehnten, unter Berücksichtigung der jeweiligen gesellschaftspolitischen Hintergründe. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine Auseinandersetzung mit dem Begriff „Heimat“, eine Genredefinition des Heimatfilms, die Analyse des traditionellen Heimatfilms der Nachkriegszeit und des kritischen Heimatfilms der 1960er Jahre, sowie ein Resümee.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Entwicklung des Heimatfilmgenres, den Wandel des Heimatbegriffs im Laufe der Zeit und seine filmische Reflexion, die gesellschaftspolitischen Einflüsse auf die Darstellung von Heimat im Film, die Unterschiede zwischen traditionellen und kritischen Heimatfilmen, sowie die Bedeutung und den Erfolg des Heimatfilms als Genre.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung und einer Erörterung des Begriffs „Heimat“. Es folgt eine Kapitel zur Genredefinition des Heimatfilms, gefolgt von Kapiteln, die sich mit dem traditionellen Heimatfilm der Nachkriegszeit und dem kritischen Heimatfilm der 1960er Jahre auseinandersetzen. Die Arbeit schließt mit einem Resümee ab. Jedes Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung.
Was ist das Ziel dieser Arbeit?
Das Ziel dieser Arbeit ist ein inhaltlicher und stilistischer Vergleich der bundesdeutschen Heimatfilme der 1950er und 1960er Jahre. Im Mittelpunkt steht die unterschiedliche Interpretation des Heimatbegriffs in beiden Epochen, unter Berücksichtigung der jeweiligen gesellschaftspolitischen Lage.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heimatfilm, Heimatbegriff, Nachkriegsdeutschland, Sozialkritik, Idylle, Genredefinition, Tradition, Wandel, Realismus, Gesellschaftspolitik, Filmgeschichte.
Wie wird der Begriff „Heimat“ in der Arbeit behandelt?
Der Begriff „Heimat“ wird in der Arbeit vielschichtig analysiert. Es werden verschiedene Definitionen aus Lexika und wissenschaftlichen Arbeiten herangezogen, um die räumliche und emotionale Dimension des Begriffs herauszuarbeiten. Die Ambivalenzen und Ideologisierungen, die mit dem Begriff verbunden sind, werden beleuchtet.
Wie unterscheidet sich der traditionelle vom kritischen Heimatfilm?
Der traditionelle Heimatfilm der Nachkriegszeit zeichnet sich durch die Darstellung einer idealisierten „Heilen Welt“ aus, mit Fokus auf Natur, Freundschaft und Familie. Der kritische Heimatfilm der 1960er Jahre hingegen reflektiert die gesellschaftliche Realität und übt Sozialkritik am Idyll des traditionellen Heimatfilms. Es findet eine Umkehrung des traditionellen Heimatbegriffs statt.
Welche gesellschaftspolitischen Faktoren beeinflussen die Heimatfilme?
Die gesellschaftspolitische Lage nach 1945 (Nachkriegszeit) und am Ende der 1960er Jahre beeinflusst die Darstellung von Heimat in den Filmen maßgeblich. Der traditionelle Heimatfilm diente als Flucht vor der Realität, während der kritische Heimatfilm diese Realität aufgreift und kritisch hinterfragt.
Wie wird der Heimatfilm in dieser Arbeit definiert?
Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeiten, eine präzise Definition für das Genre „Heimatfilm“ zu finden, und präsentiert unterschiedliche Definitionsversuche aus Wörterbüchern und Enzyklopädien. Es wird die Sichtweise von Wolfgang Kaschuba präsentiert, der den Heimatfilm als ein Konglomerat verschiedener Genres sieht.
- Arbeit zitieren
- Kristina Kaiser (Autor:in), 2009, Der deutsche Heimatfilm von 1950 bis 1970, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139181