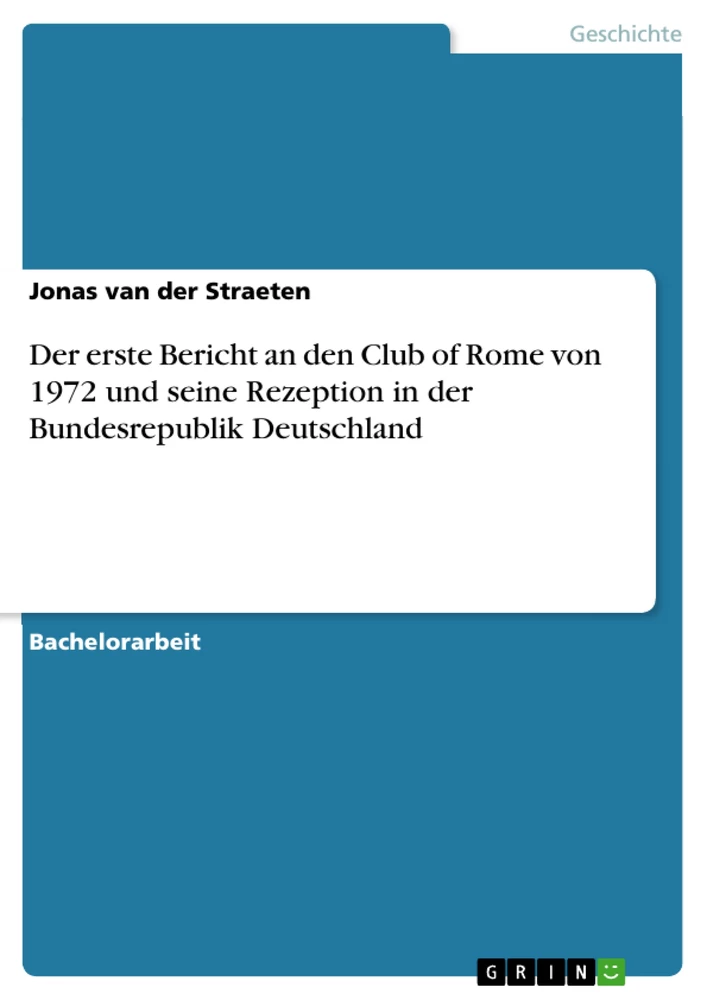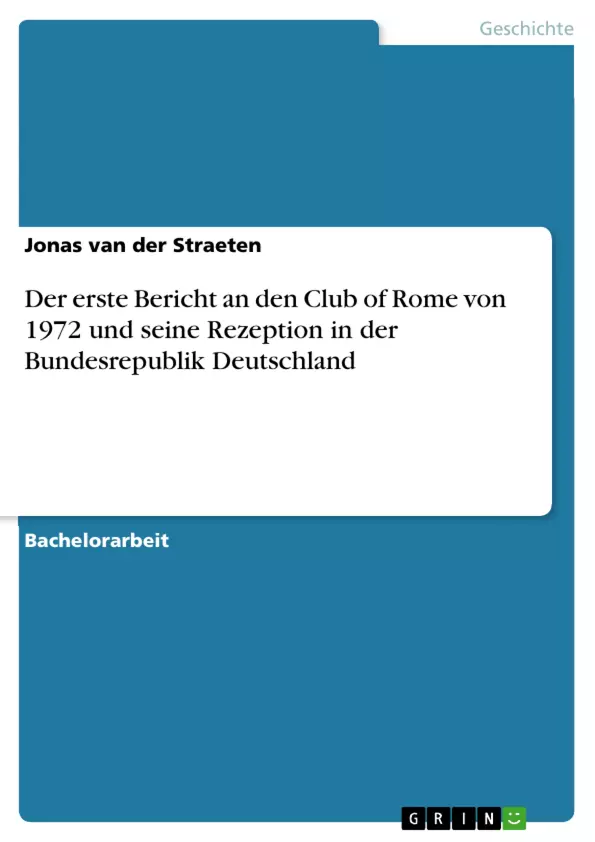„ ‚Die Grenzen des Wachstums‘ hieß jenes Buch, das wie mit einem Paukenschlag die siebziger Jahre einleitete."1 Was sich wie ein Zitat aus einem geschichtswissenschaftlichen Text zur Periodisierung der 1970er Jahre liest, ist tatsächlich aus einem Zeitungsartikel der Welt vom Januar 1975 entnommen – bereits der zeitgenössische Autor maß dem dünnen Taschenbuch offenbar historische Bedeutung zu. Schon als dieser erste „Bericht an den Club of Rome zur Lage der Menschheit“ 1972 auf dem Markt erschienen war, hatte der renommierte Zukunftsforscher Robert Jungk darin „eines der seltenen Dokumente, die den Lauf der menschlichen Geschichte verändern“, vermutet.2 Ging es doch darin um nicht weniger als die Zukunft der Menschheit. Im Auftrag des Club of Rome, einem Kreis von Unternehmern, Wissenschaftlern und Ökonomen um den Industriellen Aurelio Peccei, hatte ein Team von Forschern vom Massachusetts Institute of Technology anhand eines computergestützten „Weltmodells“ versucht, diese zu berechnen – und war zu besorgniserregenden Ergebnissen gelangt: „Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht.“3 Es drohe ein zivilisatorischer Zusammenbruch innerhalb weniger Generationen. Die Menschheit sei also unmittelbar dabei, sich ihr eigenes Grab zu schaufeln – so lautete die alarmierende und leicht verständliche Botschaft der Grenzen des Wachstums. Diese Botschaft kam an: Das Buch wurde mit Abstand zum erfolgreichsten seiner Art, die der Umwelthistoriker Kai F. Hünemörder einem „umweltapokalyptische(n) Genre“ zuordnet.4 Bis heute wurde es in mehr als 37 Sprachen übersetzt und über zwölf Millionen Mal verkauft.5 1973 wurde der Club of Rome für die Grenzen des Wachstums gar mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung und Vorbetrachtung
- I.A. Einleitung
- I.A.1. Ein Buch und seine Geschichte
- I.A.2. Ein „falscher Öko-Alarm“?
- I.A.3. Struktur und Vorgehensweise der Arbeit
- I.B. Zeitgeschichtliche Einordnung und methodische Vorbetrachtungen
- I.B.1. Die Grenzen des Wachstums als Teil des „1970er Syndroms“?
- I.B.2. Methodische Vorbetrachtungen
- II. Die Entstehungsgeschichte der Grenzen des Wachstums - Akteure und Inhalte
- II.A. Aurelio Peccei, der Club of Rome und ihre Botschaft
- II.A.1. Aurelio Peccei - vom Manager der Großindustrie zum Gründer des Club of Rome
- II.A.2. Der Club of Rome: Formierung und intellektueller Standpunkt
- II.A.3. Wie verbreitet man eine Botschaft (1)? Der Weg zu den Weltmodellen
- II.A.4. Zwischenfazit: Motive, Selbstverständnis und Interessen des Club of Rome
- II.B. Der Grenzen des Wachstums-Bericht
- II.B.1. Das Forschungsprojekt am MIT
- II.B.2. Form und Inhalt der Grenzen des Wachstums
- II.B.3. Wie verbreitet man eine Botschaft (2)? Das Marketing für den Bericht
- II.B.4. Zwischenfazit: Der publizistische Erfolg der Studie: „A happy accident?“
- III. Die Rezeption des Grenzen des Wachstums-Berichtes in den deutschen Massenmedien
- III.A. Die publizistische „Vorbereitung“ auf die Grenzen des Wachstums
- III.B. Die erste Phase der Rezeption
- III.B.1. Der Weltuntergang in den deutschen Medien - ein Panorama
- III.B.2. Von der Umwelt- zur Wachstumsdebatte
- III.C. Die zweite Phase der Rezeption
- III.C.1. Die Debatte um die Grenzen des Wachstums in der Wissenschaft
- III.C.2. Wissenschaft contra „Nullwachstum“ – ein medientauglicher Streit
- III.D. Die dritte Phase der Rezeption
- III.D.1. Alte Illusionen und neue Perspektiven
- III.D.2. Vom Paukenschlag zum Trommelwirbel: Der zweite Bericht an den Club of Rome
- IV. Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehungsgeschichte des ersten Berichts an den Club of Rome, „Die Grenzen des Wachstums“, von 1972 und dessen Rezeption in der Bundesrepublik Deutschland. Ziel ist es, das gesellschaftliche Echo auf den Bericht zu erklären und dessen Aussagekraft für das Verständnis der damaligen Zeit zu beleuchten.
- Die Entstehungsgeschichte des Berichts „Die Grenzen des Wachstums“ und die Rolle des Club of Rome.
- Der Inhalt und die Methodik des Berichts sowie seine publizistische Strategie.
- Die Rezeption des Berichts in den deutschen Medien in verschiedenen Phasen.
- Die Kontroversen und Debatten, die der Bericht auslöste.
- Die Bedeutung des Berichts für das Verständnis der 1970er Jahre.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung und Vorbetrachtung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, indem es den Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ als historisch bedeutendes Dokument darstellt und die Frage nach seinem außergewöhnlichen gesellschaftlichen Echo aufwirft. Es wird die Diskussion um den wissenschaftlichen Wert des Berichts angesprochen und die methodische Vorgehensweise der Arbeit erläutert, die eine chronologische Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte und Rezeption des Berichts vorsieht. Der Begriff des "falschen Öko-Alarms" wird kritisch beleuchtet und relativiert.
II. Die Entstehungsgeschichte der Grenzen des Wachstums - Akteure und Inhalte: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Entstehung des Berichts. Es portraitiert Aurelio Peccei und den Club of Rome, untersucht deren Motive, Selbstverständnis und Interessen und beleuchtet den Entstehungsprozess des Weltmodells am MIT. Der Fokus liegt auf den Akteuren, ihren Intentionen und der Entwicklung der Botschaft des Berichts bis hin zu dessen Veröffentlichung und Marketingstrategie. Das Kapitel analysiert die Faktoren, die zum außergewöhnlichen Erfolg des Berichts beigetragen haben.
III. Die Rezeption des Grenzen des Wachstums-Berichtes in den deutschen Massenmedien: Dieses Kapitel analysiert die breit gefächerte Rezeption des Berichts in den deutschen Medien. Es unterteilt die Rezeption in drei Phasen und beschreibt detailliert die Reaktionen in der Presse, den wissenschaftlichen Diskurs und die sich entwickelnde öffentliche Debatte. Das Kapitel untersucht die unterschiedlichen Interpretationen des Berichts, die Kontroversen um seine Aussagen und den langfristigen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung von Umwelt- und Wachstumsthemen.
Schlüsselwörter
Die Grenzen des Wachstums, Club of Rome, Aurelio Peccei, Umweltdebatte, Wachstumskritik, Medienrezeption, 1970er Jahre, Ökologische Krise, Zukunftsforschung, Weltmodell.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Grenzen des Wachstums"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehungsgeschichte des ersten Berichts an den Club of Rome, "Die Grenzen des Wachstums" (1972), und dessen Rezeption in der Bundesrepublik Deutschland. Ziel ist es, das gesellschaftliche Echo auf den Bericht zu erklären und dessen Aussagekraft für das Verständnis der damaligen Zeit zu beleuchten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Entstehungsgeschichte des Berichts und die Rolle des Club of Rome; den Inhalt und die Methodik des Berichts sowie seine publizistische Strategie; die Rezeption des Berichts in den deutschen Medien in verschiedenen Phasen; die Kontroversen und Debatten, die der Bericht auslöste; und die Bedeutung des Berichts für das Verständnis der 1970er Jahre.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung und Vorbetrachtung; Die Entstehungsgeschichte der Grenzen des Wachstums - Akteure und Inhalte; Die Rezeption des Grenzen des Wachstums-Berichtes in den deutschen Massenmedien; und Schlussbetrachtung und Ausblick. Jedes Kapitel ist in Unterkapitel unterteilt, die die einzelnen Aspekte des Themas detailliert behandeln.
Wer waren die Akteure hinter dem Bericht "Die Grenzen des Wachstums"?
Ein zentraler Akteur ist Aurelio Peccei, der Gründer des Club of Rome. Die Arbeit untersucht den Club of Rome, seine Motive, sein Selbstverständnis und seine Interessen, sowie den Entstehungsprozess des Weltmodells am MIT, welches die Grundlage des Berichts bildet.
Wie wurde der Bericht "Die Grenzen des Wachstums" in den deutschen Medien rezipiert?
Die Arbeit analysiert die Rezeption des Berichts in drei Phasen: die publizistische Vorbereitung, die erste Phase mit der anfänglichen Panikmache, die zweite Phase mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, und die dritte Phase mit der langfristigen Wirkung und neuen Perspektiven. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen, Kontroversen und den langfristigen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung von Umwelt- und Wachstumsthemen.
Welche Methodik wurde in dieser Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine chronologische Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte und Rezeption des Berichts. Sie analysiert die Medienberichterstattung und wissenschaftlichen Debatten, um das gesellschaftliche Echo auf den Bericht zu verstehen und dessen Aussagekraft für die 1970er Jahre zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Die Grenzen des Wachstums, Club of Rome, Aurelio Peccei, Umweltdebatte, Wachstumskritik, Medienrezeption, 1970er Jahre, Ökologische Krise, Zukunftsforschung, Weltmodell.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die Bedeutung des Berichts "Die Grenzen des Wachstums" für das Verständnis der gesellschaftlichen und politischen Debatten der 1970er Jahre und seinen nachhaltigen Einfluss auf die Umwelt- und Wachstumsdiskussion.
- Citation du texte
- Jonas van der Straeten (Auteur), 2009, Der erste Bericht an den Club of Rome von 1972 und seine Rezeption in der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138871