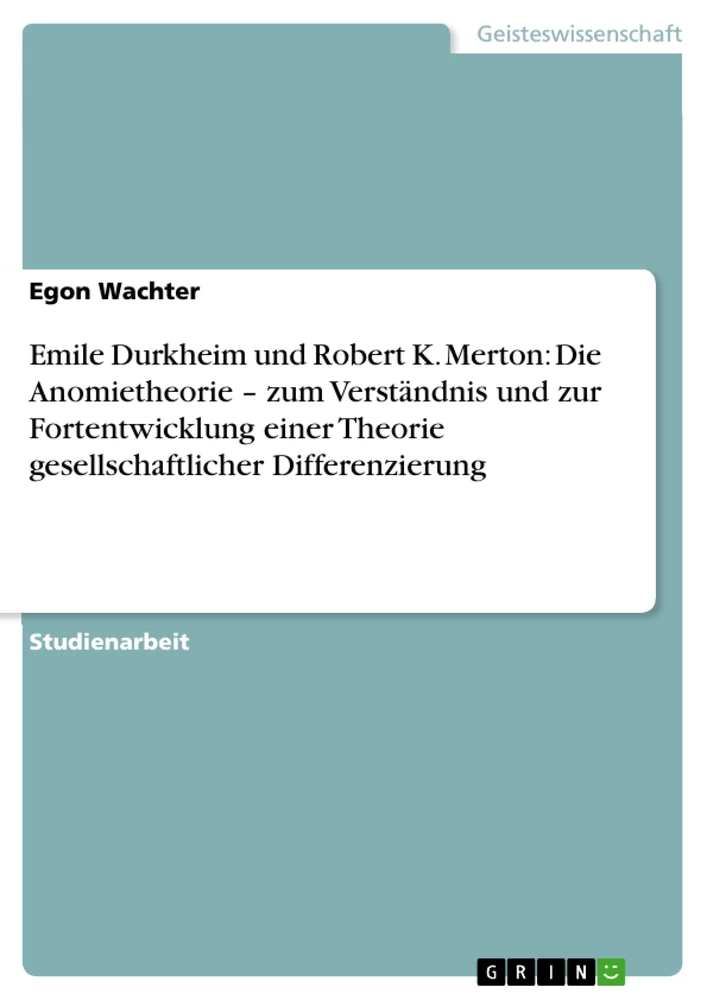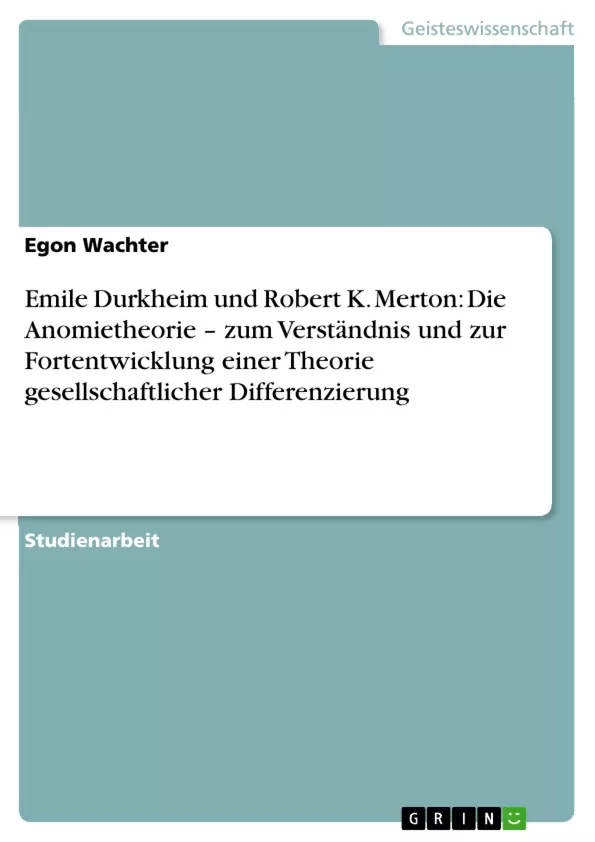Emile Durkheim gilt als Wegbereiter der Anomietheorie. Er betrachtete die „gesellschaftliche Arbeitsteilung“ und die Entwicklung der Selbstmordrate in seiner Zeit des Frühindustrialismus und beschrieb in diesem Zusammenhang krankhafte gesellschaftliche Störungen, die er als „anomische“ Zustände bezeichnete.
Auch Robert K. Merton erforschte Problemstellungen gesellschaftlicher Entwicklungen „seiner“ amerikanischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts unter anomietheoretischen Betrachtungen, mit einem besonderen Blick auf „abweichendes Verhalten“. Entwickelte damit Merton die „Anomietheorie Durkheims“ fort? Dieser Frage wird im Rahmen der Hausarbeit nachgegangen.
Die leitenden Fragestellungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Welches theoretische Verständnis verbindet Durkheim mit dem Begriff der „Anomie“? In wieweit geht Merton mit seinem Verständnis über Durkheim hinaus?
Im Wege einer Literaturauswertung werden beide Verständnisse zunächst getrennt dargelegt und dann mit Blick auf zentrale Kategorien wie zum Beispiel „Bedürfnisse und Ziele“, „Mittel und Wege“ und „Normen“ miteinander verglichen. Dabei zeigt sich unter anderem, dass bei beiden Soziologen Probleme aus der Diskrepanz zwischen Zielen und Mitteln entstehen. Betrachtungsunterschiede bestehen insofern, als Durkheim die Entstehung von Bedürfnissen bzw. die Schieflage in der Mittelverteilung in der Natur erblickt (insofern anlagebedingt), während nach Merton die Gesellschaft diese Ungleichverteilungen und Problemstellungen erzeugt. Merton betont die Bedeutung der Kultur. Beide betrachten die normativen Bewertungen als eine sich verändernde Größe. Nach Durkheim kann bzw. muss das Verständnis des normativ Erlaubten neu gelernt werden, wenn sich das Verhältnis aus Mitteln und Bedürfnissen plötzlich drastisch ändert (infolge der wirtschaftlichen Entwicklung), bei Merton kann es in Abhängigkeit von anderen Merkmalen zu einem Zusammenbruch der Normen kommen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Anomietheorie nach Emile Durkheim
2.1 „Einfache“ und „höhere“ Gesellschaften
2.2 Pathologische Erscheinungen der Arbeitsteilung
2.2.1 Anomische Arbeitsteilung
2.2.2 Erzwungene Arbeitsteilung
2.3 Der Selbstmord als Indikator für Anomie
2.3.1 Anomischer Selbstmord
2.3.2 Abgrenzung zu weiteren Selbstmordtypen
3. Die Anomietheorie nach Robert K. Merton
3.1 Theoretische Grundpositionen
3.2 Das Anomiekonzept
3.3 Das erweiterte Anomiekonzept
3.4 Arten individueller Anpassung
3.5 Anomieverständnis im Kontext der amerikanischen Gesellschaft
4. Verständnis und Fortentwicklung der Anomietheorie
4.1 Zusammenfassende Betrachtung
4.2 Vergleich zentraler Kategorien
4.2.1 Bedürfnisse und Ziele
4.2.2 Mittel und Wege
4.2.3 Normen
4.2.4 Gleichgewicht zwischen Bedürfnissen und Mitteln
4.2.5 Eine Theorie für Kollektive oder Individuen?
4.3 Fazit
5. Zusammenfassung
Quellenverzeichnis
1. Einleitung
„Emile Durkheim hat mit seiner Anomietheorie eine Krisensemantik vorgelegt, die zu zeigen versucht, dass Gesellschaften „krank“ machen können. (…) Die bisherigen Versuche, Durkheims Aussagen empirisch zu überprüfen, haben nur uneindeutige oder widersprüchliche Ergebnisse gebracht, (…) was wir vorwiegend darauf zurückführen, dass diese Forschungen Durkheims Ansatz nicht angemessen abbilden“ (Mehlkop; Graeff 2006, S. 56). Das Zitat zeigt, dass die Befassung mit dem „soziologischen Klassiker“ Emile Durkheim auch im 21. Jahrhundert noch aktuell ist. Die beiden Forscher interessiert hier, welche konkreten Aussagen von Durkheim stammen und wie dessen Erkenntnisse abgebildet werden können. Ersterem möchte ich in meiner Hausarbeit nachgehen und danach fragen, was Durkheim unter dem Begriff „Anomie“ versteht. Die zweite Frage nach den Möglichkeiten der empirischen Überprüfung soll hier nicht thematisiert werden.
„Anomie stammt vom gr. „a-´nomos“ und kennzeichnet somit einen Zustand der „Gesetzlosigkeit“ bzw. die Untergrabung der Wirksamkeit von Normen“ (Schäfers 2003, S. 16). Durkheim gilt als Wegbereiter der Anomietheorie. Er betrachtete die „gesellschaftliche Arbeitsteilung“ und die Entwicklung der Selbstmordrate in seiner Zeit des Frühindustrialismus und beschrieb in diesem Zusammenhang krankhafte gesellschaftliche Störungen, die er als „anomische“ Zustände bezeichnete. Auch Robert K. Merton erforschte Problemstellungen gesellschaftlicher Entwicklungen „seiner“ amerikanischen Gesellschaft unter anomietheoretischen Betrachtungen, allerdings mit Blick auf „abweichendes Verhalten“. Entwickelte damit Merton die „Anomietheorie Durkheims“ fort? Dieser Frage soll im Rahmen der Hausarbeit nachgegangen werden.
Es interessiert aber auch, was Durkheim und Merton unter dem Begriff der „Anomie“ verstehen und ob sie in diesem Zusammenhang eine einheitliche Definition etablierten. Hierzu ist beabsichtigt, im Wege einer Literaturauswertung beide Verständnisse zunächst getrennt darzulegen und dann zu vergleichen, ausgerichtet auf die folgenden zentralen Fragestellungen:
Welches theoretische Verständnis entwickelte Durkheim mit dem Begriff der „Anomie“? In wieweit geht Merton mit seinem Verständnis über Durkheim hinaus?
2. Die Anomietheorie nach Emile Durkheim
Emile Durkheim (1858 -1917) wird hineingeboren in eine Zeit schneller und nachhaltiger Veränderungen der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Diese gesellschaftliche Entwicklung als Übergang von der europäischen Agrar- zur Industriegesellschaft, die schon Ausgang des 18. Jahrhunderts mit der industriellen Revolution einsetzte und sich verstärkt im 19. Jahrhundert auswirkte, charakterisiert sich einerseits durch eine zunehmende Technologisierung und Produktivitätssteigerung, andererseits durch Ausbeutung von Arbeitskraft und Massenelend. Mit Blick auf die gesellschaftliche Arbeitsteilung stellt Emile Durkheim die Frage nach der Art der Integration moderner Gesellschaften. Dabei vergleicht er die Charakteristika vormoderner und moderner Gesellschaften in Bezug auf deren Differenzierungsprinzip, gleichzeitig auf der Suche nach dem dazugehörigen Integrationsprinzip und formuliert „mit seiner Zuordnung von Differenzierungs- und Integrationsprinzip ein zentrales Erkenntnisinteresse dieser Theorieperspektive“ (Schimank 2007, S. 31). Zum Integrationsprinzip, also zur Frage, was eine Gesellschaft zusammenhält, bietet Durkheim anomietheoretische Betrachtungen auf makrosoziologischer Ebene an.
Für das Verständnis, das Durkheim mit dem Begriff der Anomie entwickelte, bietet es sich an, zunächst dessen Unterscheidungen zwischen „einfachen“, segmentären Gesellschaften und „höheren“ Gesellschaften in Bezug auf das jeweilige Differenzierungs- und Integrationsprinzip zu beleuchten, um später die von ihm beschriebenen anomischen Störungen innerhalb moderner Gesellschaften einordnen zu können.
2.1 „Einfache“ und „höhere“ Gesellschaften
„Wenn man versuchte, sich den Idealtyp einer Gesellschaft vorzustellen, deren Zusammenhalt ausschließlich aus Ähnlichkeiten hervorgegangen wäre, dann würde man sie als eine absolut homogene Masse begreifen müssen, deren Teile sich untereinander nicht unterschieden, und die folglich keine Ordnung aufwiesen“ (Durkheim, 2008, S. 229). So beschreibt Durkheim „das wahrhaft soziale Protoplasma, der Keim, aus dem alle sozialen Typen hervorgegangen wären“ und schlägt vor, ein solcherart charakterisiertes „Aggregat Horde zu nennen“ (ebd.).
Eine Horde, sofern sie nicht länger unabhängig ist, weil sie ein Element einer erweiterten Gruppe darstellt, nennt er Klan. Völker, die aus der Assoziation zwischen Klanen gebildet sind, bezeichnet Durkheim als „segmentäre Gesellschaften“ (vgl. ebd., S. 230). Bei diesen Gesellschaften handelt es sich „um eine mehr oder weniger organisierte Gesamtheit von Glaubensüberzeugungen und Gefühlen, die allen Mitgliedern der Gruppe gemeinsam sind“ (ebd., S. 181). Ihnen weist Durkheim als Integrationsprinzip die „mechanische Solidarität“ zu und vergleicht diesen Typ im Wege einer physikalischen Analogie mit Molekülen, die sich ohne Eigenwillen, nur übergeordneten Gesetzen folgend, bewegen. Mit der „mechanischen Solidarität“ korrespondiert die Rechtsform des repressiven Rechts. Ein Verbrechen ist ein Angriff gegen das Kollektivbewusstsein und damit gegen das gemeinsame Wert- und Regelsystem, keinesfalls dem hierfür verantwortlichen Individuum alleine zuzuschreiben. Strafe hat hier Sühnecharakter (vgl. ebd., S. 491).
Dies verhält sich bei „höheren Gesellschaften“ ganz anders. Sie sind groß und umfangreich, funktional differenziert, bestehen aus einem System von verschiedenen Organen, die je eigene Sonderrollen ausüben und gleichen damit hochgradig differenzierten Organismen (deshalb „organische Solidarität“) (vgl. ebd., S. 237, 492). Vergleichbar dem menschlichen Körper nehmen alle Organe besondere Funktionen wahr, sind insofern unersetzbar, aber auch hochgradig abhängig vom Funktionieren der anderen Organe.
Was solche „höheren“ Gesellschaften von „einfachen“ Gesellschaften unterscheidet, ist das Ausmaß an „gesellschaftlicher Arbeitsteilung“. „Überspitzt kann man sagen, dass die Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Segmenten der „einfachen“ Gesellschaften gleich Null war. Alle taten genau das gleiche: sich um den jeweils eigenen Fortbestand zu kümmern“ (Schimank 2007, S. 31). In „höheren“ Gesellschaften hingegen gehen die Individuen immer spezialisierteren Teiltätigkeiten nach, worin der Ausgangspunkt für die Entwicklung unterschiedlicher Persönlichkeiten liegt. Ein alle Akteure verbindendes Kollektivbewusstsein, wie wir es in „einfachen“ Gesellschaften vorfinden, weicht jetzt einer „Vielzahl funktionsspezifischer Wert- und Normkodizes“, wobei der Zusammenhang von Arbeitsteilung, Solidarität und insbesondere der Moral in höheren Gesellschaften für Durkheim feststeht: „Dadurch, dass die Arbeitsteilung zur Hauptquelle der sozialen Solidarität wird, wird sie gleichzeitig zur Basis moralischer Ordnung“ (Durkheim 2008, S. 493). Zur Frage der Integrationskraft moderner Gesellschaften positioniert sich Durkheim an dieser Stelle klar in einer optimistischen Denktradition. Er tritt allen Ängsten gegenüber, die befürchten, dass moderne Gesellschaften integrationsunfähig sein könnten und behauptet, dass die gesellschaftliche Arbeitsteilung in der Lage ist, Integration aus sich selbst heraus zu schaffen. Dauerhafte Leistungsabhängigkeiten sichern schließlich den Zusammenhalt, denn wer auf die Leistungen anderer angewiesen ist, muss auch auf deren Interessen Rücksicht nehmen (vgl. Schimank, 2007, S. 33f.). „In einer solchen nicht altruistischen, sondern durch einen rationalen Egoismus nahe gelegten, wechselseitigen Rücksichtnahme auf die Interessen der Gegenüber ist das zentrale Integrationsmuster moderner Gesellschaften zu sehen“ (ebd., S. 34).
Damit lässt sich zusammenfassen: In der gesellschaftlichen Arbeitsteilung erkennt Emile Durkheim das zentrale Differenzierungsprinzip moderner Gesellschaften im Rahmen des von ihm angestellten Vergleichs mit „einfachen“, segmentären Gesellschaften. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung ist aber auch Hauptquelle der sozialen Solidarität und damit das zentrale Integrationsprinzip einer „höheren“ Gesellschaft. Auf den (durchaus sehr bedeutenden) Umstand, dass er damit eine kulturalistische Antwort auf die Frage nach gesellschaftlicher Solidarität ablehnt, soll hier nicht näher eingegangen werden. Was im Folgenden interessiert, ist die Frage, welche Erscheinungen in arbeitsteilig-komplexen Gesellschaften dazu führen können, dass hierdurch die Integrationskraft in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden könnte.
2.2 Pathologische Erscheinungen der Arbeitsteilung
Durkheim studiert die Arbeitsteilung nicht nur als „normales“ Phänomen. Er untersucht auch, was die Arbeitsteilung von ihrer „natürlichen Richtung“ ablenken kann und gerade nicht zur sozialen Solidarität führt. Dabei geht er davon aus, dass es sich bei den pathologischen Erscheinungen um Ausnahmefälle handelt (vgl. Durkheim 2008, S. 421).
Emile Durkheim hat verschiedene Varianten eines Anomiekonzepts vorgelegt und das in seinem Werk „Über soziale Arbeitsteilung“ dargelegte Konzept in zwei „Anomie-Varianten“ eingeteilt „(a) als mangelhafte Koordinaten arbeitsteilig operierenden „Organe“, z.B. in Form eines Konflikts zwischen „Kapital“ und „Arbeit“; (b) als „erzwungene Arbeitsteilung“, die es den Menschen nicht erlaubt, in der Arbeit ihre natürlichen Talente zu entwickeln und ihre Fähigkeiten auszuschöpfen – eine Form von Entfremdung und mangelnder Chancengleichheit“ (Thome/Birkel 2007, S. 36). Es handelt sich bei diesen Varianten um eine „strukturell“ induzierte Anomie.
2.2.1 Anomische Arbeitsteilung
Die Beziehung zwischen Arbeit und Kapital verändert sich im Laufe der Entwicklung (vgl. ebd., S. 421 ff.). Während der Arbeiter im Mittelalter noch gleichrangig dem Meister gegenübersteht und sich nach seiner Lehre in vielen Gewerben ebenfalls niederlassen kann, befindet sich vom 15. Jahrhundert an die Berufskörperschaft im ausschließlichen Besitz der Meister, die allein über alle Belange entscheiden. Die Trennung zwischen Meistern und Gesellen verschärft sich im 17. Jahrhundert mit dem Auftauchen der großen Industrie und der Arbeiter trennt sich vollständig vom Arbeitgeber. Mit der Spezialisierung nehmen Unzufriedenheit und Revolten zu, Solidarität wird verhindert. Ein anderes Beispiel des gleichen Phänomens stellt die Aufteilung der (Gesamt-)Wissenschaft in spezialisierte (Teil-)Wissenschaften dar, wodurch ein solidarisches Ganzes verloren geht, weil sich die Wissenschaftler nur noch ihrer Spezialforschung verpflichtet sehen und den gemeinsamen Zweck aus den Augen verlieren. Arbeitsteilung würde also gemäß ihrer Natur eher einen auflösenden Einfluss ausüben, wenn sich die Funktionen zusätzlich spezialisieren. Comte schlägt als Lösung vor, einem unabhängigem Organ, dem Staat oder der Regierung, die Aufgabe zu übertragen, die Einheit zu bewahren. Für die Wissenschaft sollte nach seiner Vorstellung die Philosophie diese Aufgabe übernehmen, indem sie den Geist der Einzelwissenschaften erkennt, der zusammenhanglosen Entstehung von Einzelwissenschaften entgegenwirkt und damit die gefahrlose Weiterentwicklung der Arbeitsteilung sichert (vgl. ebd., S. 426 ff.).
Durkheim verweist auf den durchaus begrenzten Einfluss- und Wirkungsbereich der Regierung, weil sie zum Beispiel nicht jeden Augenblick in wirtschaftliche Abläufe eingreifen kann, weil die Vielfalt der Teilfragen nur der kennt, der „mitten drin steht“. Auch die Philosophie wird unfähiger, die Einheit der Wissenschaft zu sichern, weil es dem menschlichen Geist immer unmöglicher wird, die unendliche Vielfalt der Phänomene, Gesetze und Hypothesen zu kennen, die es zusammen zu fassen gilt (vgl. ebd., S. 428ff.). Zur Wahrung der Einheit sieht Durkheim hier den „spontanen Konsensus“ in der Lage: „Was aber die Einheit der organisierten Gesellschaften wie eines jeden Organismus ausmacht, ist der spontane Konsens der Parteien, die innere Solidarität, die nicht nur genauso unentbehrlich wie die Regelwirkung der höheren Zentren, sondern deren notwendige Bedingung ist (…). Man spricht von der Notwendigkeit, daß das Ganze auf die Teile reagiere, aber dazu muß diese Gesamtheit erst existieren, d.h. die Teile müssen schon untereinander solidarisch sein, damit das Ganze sich seiner selbst bewusst wird und als solches reagiert“ (ebd., S. 429). Und damit sich diese organische Solidarität entwickeln kann, bedarf es nicht nur aufeinander angewiesener Organe, sondern es muss auch die Art und Weise, wie sie zusammenwirken, durch Regeln geklärt werden. Im normalen Zustand ergeben sich die Regeln aus der Arbeitsteilung selbst. Diese Regeln entwickeln sich langsam zu einem dauerhaft beständigen Regelwerk. Und genau hier erkennt Durkheim einen Problempunkt: „Nun existiert in all den oben beschriebenen Fällen diese Regelung entweder gar nicht, oder sie steht nicht in Einklang mit dem Entwicklungsgrad der Arbeitsteilung“ (ebd., S. 435). Dann aber kann die Arbeitsteilung keine Solidarität erzeugen „ (…) weil die Beziehungen der Organe nicht geregelt sind, weil sie in einem Zustand der Anomie verharren“ (ebd., S. 437).
Die Frage ist aber nun, wie es zu diesem Zustand der Anomie kommt. Dies ist der Fall, wenn Organe keinen hinreichenden und genügend langen Kontakt miteinander haben. Wenn z.B. die Industrie für einen nicht mehr überschaubaren Markt produziert, weil sich dieser zu stark vergrößert hat, besteht zwischen Industrie und Verbraucher kein genügender Kontakt mehr. In der Folge entstehen Wirtschaftskrisen. Wenn die industrielle Entwicklung die Beziehungen zwischen den Fabrikanten und den Arbeitern verändert, finden letztere neue Lebensbedingungen vor, die sie wegen des zu raschen Wandels noch nicht ordnen konnten.
2.2.2 Erzwungene Arbeitsteilung
Bei der „erzwungenen“ Arbeitsteilung sind nicht fehlende Regeln, sondern falsche oder als ungerecht empfundene Regeln die Ursache des Übels. Arbeitsteilung kann nur dann Solidarität erzeugen, wenn jeder eine Aufgabe bekommt, die ihm auch liegt, also seinen Talenten entspricht. Solidarität entsteht nicht, wenn Individuen gewaltsam in bestimmte Funktionen hineingezwungen werden, dann über- oder unterfordert sind und unzufrieden werden (vgl. ebd., S. 444f.). Spontane Arbeitsteilung kann dies verhindern. Sie setzt nämlich voraus, „daß die Individuen nicht gewaltsam in bestimmte Funktionen gezwungen werden, sondern auch, daß überhaupt kein Hindernis, welcher Natur auch immer, sie daran hindert, innerhalb der sozialen Ordnung den Platz einzunehmen, der ihren Fähigkeiten entspricht. (…) Die Arbeit teilt sich nur dann spontan, wenn die Gesellschaft so beschaffen ist, daß die sozialen Ungleichheiten die natürlichen Ungleichheiten genau ausdrücken.“ (ebd., S. 446). Allerdings erkennt Durkheim, dass es derart vollkommene Spontaneität in keiner Gesellschaft gibt und sie ein theoretisches Ideal darstellt.
Neben diesen Varianten einer „strukturell“ induzierten Anomie hat Durkheim bei der Betrachtung des Selbstmords als Indikator für Anomie auch eine „prozessual“ induzierte Anomievorstellung entwickelt (vgl. Thome/Birkel 2007, S. 36), die im Folgenden näher dargestellt wird.
2.3 Der Selbstmord als Indikator für Anomie
Durkheim betrachtet den Selbstmord nicht individualpsychologisch, sondern richtet den Fokus auf die Gesamtheit der Selbstmorde in einer Gesellschaft. Die Gesamtzahl stellt für ihn nicht die Summe voneinander unabhängiger Einzelfälle dar, sondern eine Tatsache sui generis, mit einer eigenen Natur von sozialer Bedeutung (vgl. Durkheim 2008a, S. 30). Er definiert Selbstmord als „jeden Todesfall, der direkt oder indirekt auf eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die vom Opfer selbst begangen wurde, wobei es das Ergebnis seines Verhaltens im voraus kannte.“ (ebd., S. 27). Damit schließt er Todesfälle wie Verbrechen oder Unglücksfälle aus seiner Betrachtung aus. Durkheim stellt fest, dass die von ihm untersuchten Gesellschaften ihre jeweils eigenen Selbstmordraten (Anzahl der Selbstmorde bezogen auf die Zahl der Gesamtbevölkerung) aufweisen und dass diese Raten nicht nur während langer Zeit konstant sind, sondern dass selbst im Vergleich mit Sterblichkeitsraten die Selbstmordraten weniger schwanken. Die Selbstmordrate schwankt zwar bei Betrachtung langer Zeiträume auch, stabilisiert sich danach aber wieder und schwankt dann im Weiteren wiederum nur in engen Grenzen (vgl. ebd., S. 32). Da Durkheim keine Abhängigkeiten des Selbstmords von der organisch-psychischen Verfassung der Individuen oder der Beschaffenheit ihrer physischen Umwelt erkennt, folgert er, dass der Selbstmord soziale Ursachen haben muss und eine Kollektiverscheinung darstellt (vgl. ebd., S. 153).
2.3.1 Anomischer Selbstmord
„Niemand kann sich wohlfühlen, ja überhaupt nur leben, wenn seine Bedürfnisse nicht mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln einigermaßen im Einklang stehen (…). Ein Bedürfnis aber, das nur unter Leiden befriedigt werden kann, wird kaum neu entstehen. Ein Drang, der niemals befriedigt wird, muß schließlich verkümmern, und da der Drang zu leben sich notwendig aus allen anderen Bedürfnissen ergibt, muss auch er schwächer werden, wenn die anderen nachlassen“ (ebd., S. 279). Die Bedürfnisse des Menschen und die verfügbaren Mittel zu ihrer Befriedigung müssen also im Gleichgewicht stehen. Wann aber ist dieses Gleichgewicht gestört?
Dies ist der Fall, wenn die Mittel für die bisher legitimer Weise angestrebten Ziele zu knapp werden oder wenn Menschen das Maß verlieren, erkennen zu können, was ihnen realistischer und legitimer Weise zusteht. Wenn sie sich und ihre Fähigkeiten nicht mehr richtig einschätzen können. „In diesem Sinne erleiden sie einen Identitätsverlust per Entgrenzung; es fehlt an normativer und kognitiver Orientierung: ein Mangel, der die “Leidenschaften“ (wieder) ansteigen lässt und die Neigung sowohl zur Selbsttötung als auch zur Anwendung von Gewalt gegen andere erhöht“ (Thome/Birkel 2007, S. 36).
Die Regulierung dieses Gleichgewichts erfolgt grundsätzlich durch die Gesellschaft, sie hat insofern eine moralische Autorität. Wenn nun in der Gesellschaft Störungen auftreten, zum Beispiel durch wirtschaftliche Krisen, aber auch durch wirtschaftliches Wachstum als einer plötzlichen Veränderung, dann ist die Gesellschaft zeitweise nicht mehr fähig, diese Autorität auszuüben, die Selbstmordrate steigt an. Zu Zeiten von Wirtschaftskrisen müssen also die Menschen erst lernen, ihre Ansprüche, die ihnen die Gesellschaft zuvor zugebilligt hat, herunterzuschrauben. Das gleiche gilt aber auch bei einem plötzlichen Anwachsen von Macht und Reichtum. Da sich die Lebensbedingungen verändern, gilt das vorherige Bedürfnismodell nicht mehr. Die Menschen wissen nicht mehr, was möglich ist und was nicht, welche Ansprüche und Erwartungen erlaubt sind bzw. welche über das gebotene Maß hinausschießen. Mit dem Wohlstand steigen auch Bedürfnisse, Begehrlichkeiten werden geweckt, wenn Teile der Gesellschaft sich plötzlich wirtschaftlich besser stellen. Dann verlieren althergebrachte Regeln ihre Autorität (vgl. Durkheim 2008a, S. 288f.).
Bis hierher konzipiert Durkheim Regelungsdefizite als vorübergehende Erscheinung, die im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung immer wieder auftreten, aber auch immer wieder verschwinden und stellt insofern fest, dass Krisen zwar einen Einfluss auf die Selbstmordrate haben können, damit aber deren regelmäßige und konstante Rolle bei der Erklärung des Phänomens noch nicht geklärt ist. Hierfür wäre ein anomischer Dauerzustand erforderlich. Und genau diesen sieht Durkheim in der Welt des Handels und der Industrie (vgl. ebd., S. 290). Durkheim erkennt, dass die Entwicklung der Industrie und die „fast unendliche Ausdehnung des Absatzmarktes“ Begierden entfesseln. Der Warenproduzent kann jetzt erwarten, „die ganze Welt zum Kunden zu haben, wie sollten vor diesen grenzenlosen Perspektiven seine Begierden sich wie früher zügeln lassen? Daher die fieberhafte Betriebsamkeit in diesem Sektor der Gesellschaft, die sich auf alle übrigen ausgedehnt hat. Daher ist Krise und Anomie zum Dauerzustand und sozusagen normal geworden“ (ebd., S. 292). „In diesem Prozess (ist) die Regierung von einer Regelinstanz des wirtschaftlichen Lebens zu dessen Instrument und Diener geworden“ (vgl. ebd., S. 291).
[...]
- Citar trabajo
- Egon Wachter (Autor), 2009, Emile Durkheim und Robert K. Merton: Die Anomietheorie – zum Verständnis und zur Fortentwicklung einer Theorie gesellschaftlicher Differenzierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138793