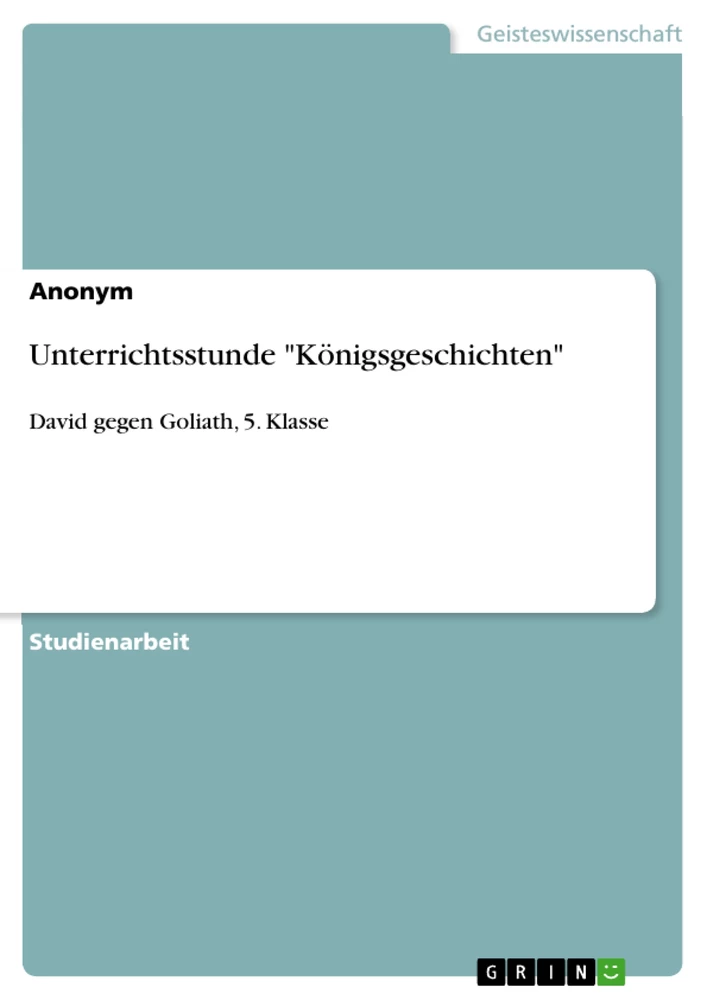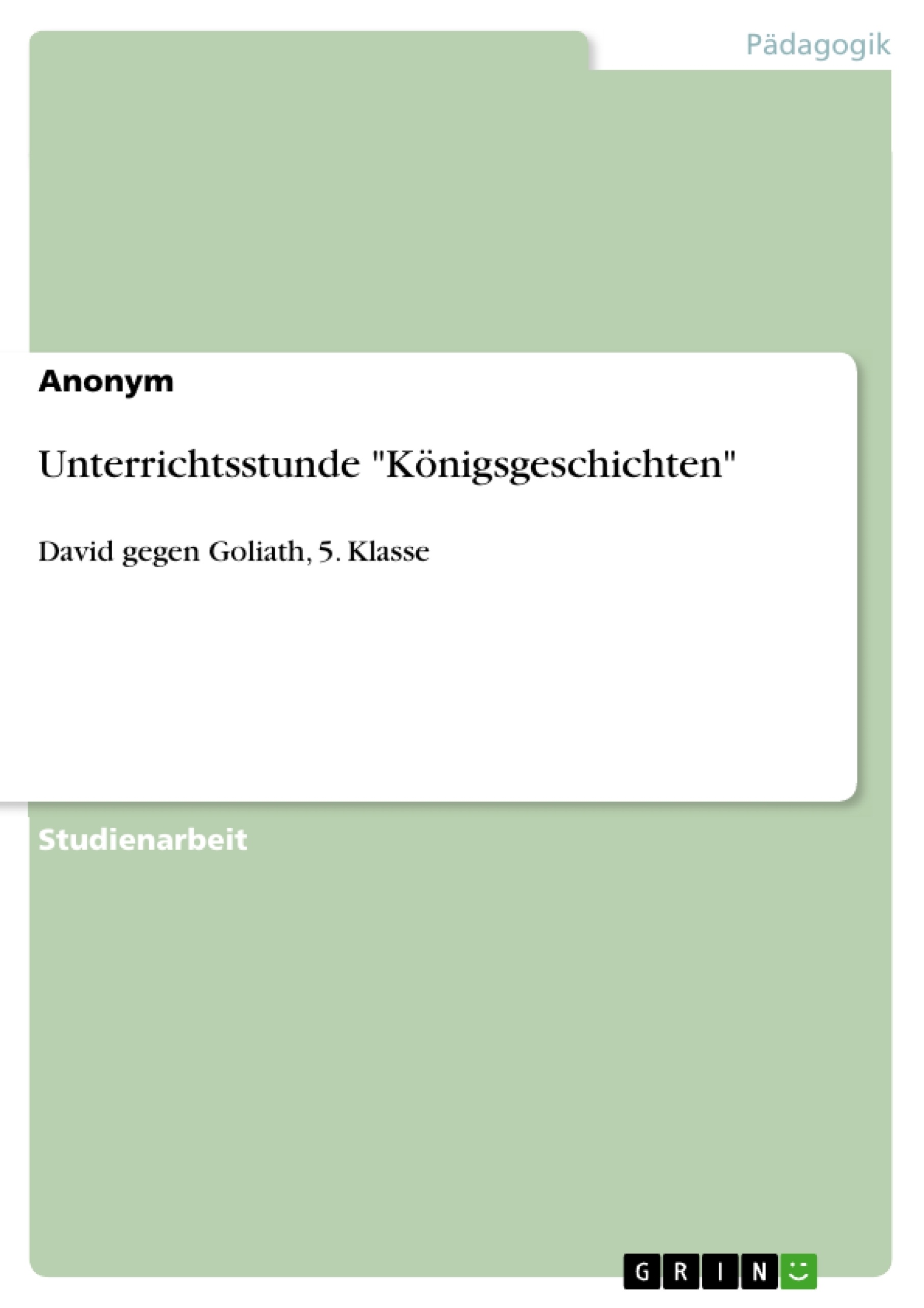Die Unterrichtsstunde über David und Goliath findet in einer 5. Klasse statt.
Die Schüler sind hier zwischen 10 und 11 Jahren. Nach Jean Piaget geht nun das konkret-operative Denken in das formal-operative Denken über. Das Denken über Gedanken und Theorien, auch über konkret Erfahrbares hinaus, entwickelt sich. Die Jugendlichen beginnen, eigenes Denken zu reflektieren, Argumentationen zu überprüfen, Hypothesen aufzustellen und allgemeine Gesetzmäßigkeiten zu entdecken. In den ersten 7 Jahren im Leben des Kindes geht es vorrangig darum, Erfahrungen über die Qualitäten der Welt zu sammeln (wie die Welt ist). In den nächsten 7 Jahren, also bis zum 14. Lebensjahr, steht das Erfahren und Verstehen des Quantitativen durch das Entdecken von Beziehungen der Dinge untereinander (wie die Welt funktioniert) im Vordergrund.
Nach James W. Fowler wird bildhafte Sprache zunächst noch eindimensional wörtlich verstanden. Mit Beginn des Schulalters, ab dem sechsten Lebensjahr, spricht Fowler vom so genannten mythisch-wörtlichen Glauben. Er betont, dass Kinder dieses Alters religiöse Symbole noch wortwörtlich nehmen, deren Sinngehalt also noch nicht verstehen. Aber ab dem 11. Lebensjahr erwacht dann allmählich der kritische Realismus. Die Schüler denken noch in übernommenen Formen, aber alle kritischen Fragen sind bereits vorhanden. Historisches Bewusstsein ist noch kaum differenziert, die Wahrheitsfrage wird aber häufig gestellt. Aber die Neugier nach dem Woher gegenwärtiger Sachverhalte und ihren Funktionen wächst. Auch gelingt es ab nun, zunehmend Zusammenhänge herzustellen.
„Unter den soziokulturellen Voraussetzungen ist die Tabuisierung des Religiösen bei den Erwachsenen zu beachten. Diese führt zu mangelnder Verbalisierungskraft in diesem Bereich, da vorherrschend eine kausal-technische Welterklärung dominiert. Das Verhältnis der Eltern zur Kirche ist häufig gestört. Dies deutet auf eine mangelnde Begegnungsmöglichkeit der Schüler mit dem christlichen Glauben hin.“
Für Friedrich Schweitzer liegt die Schwierigkeit dagegen eher darin, dass Kinder und Jugendliche eigene Sinn- und Lebensentwürfe haben, dass sie anders fühlen und denken als Erwachsene und dementsprechend andere Handlungsstrategien entwickeln. Deshalb muss beachtet werden, dass Heranwachsende nicht einfach die religiösen und moralischen Vorstellungen der...
Inhaltsverzeichnis
- Analyse des didaktischen Bedingungsfeldes
- Fachwissenschaftliche Analyse
- Zu den Samuelbüchern
- Zur Bibelstelle
- Fachdidaktische Analyse
- Bezug zum Lehrplan
- Auswahl und Begrenzung der Stunde
- Lernvoraussetzungen
- Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung
- Lernziele
- Methodische Überlegungen
- Verlaufsplanung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert eine Unterrichtsstunde zum Thema David und Goliath in einer 5. Klasse. Ziel ist es, die fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Grundlagen der Stunde zu beleuchten und deren methodische Umsetzung zu beschreiben. Die Arbeit berücksichtigt die Entwicklungspsychologie der Schüler und die soziokulturellen Bedingungen des Lernumfelds.
- Entwicklungspsychologische Aspekte des religiösen Verständnisses im Kindes- und Jugendalter
- Fachwissenschaftliche Analyse der Samuelbücher und der David-Goliath-Erzählung
- Didaktische Überlegungen zur Gestaltung einer altersgerechten und motivierenden Unterrichtsstunde
- Methodische Planung und Umsetzung der Stunde
- Bedeutung der Geschichte von David und Goliath für die Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Analyse des didaktischen Bedingungsfeldes: Dieses Kapitel beschreibt den Kontext der Unterrichtsstunde, insbesondere die Altersstufe der Schüler (10-11 Jahre) und deren kognitive Entwicklung nach Piaget und Fowler. Es werden die soziokulturellen Bedingungen des Unterrichts, wie die Tabuisierung des Religiösen in der Gesellschaft und die unterschiedlichen religiösen Hintergründe der Schüler, beleuchtet. Die Bedeutung der individuellen Biographie und die Notwendigkeit, die religiöse und moralische Entwicklung der Schüler ernst zu nehmen, werden hervorgehoben. Die Frage nach Gott als grundlegenden Bezug des menschlichen Wesens und die Bedeutung von Neugier und Vertrauen im Lernprozess werden ebenfalls thematisiert.
Fachwissenschaftliche Analyse: Dieses Kapitel unterteilt sich in zwei Abschnitte. Der erste befasst sich mit den Samuelbüchern als Teil des deuteronomistischen Geschichtswerks und ihrer Bedeutung für die israelitische Geschichtsschreibung. Es werden die Hauptpersonen (Samuel, Saul, David) und die chronologische Abfolge der Ereignisse erläutert. Der zweite Abschnitt analysiert die Bibelstelle 1 Samuel 17,1-54, die den Kampf Davids gegen Goliath beschreibt. Ungereimtheiten und Spannungen innerhalb des Kapitels werden angedeutet, jedoch nicht im Detail ausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Samuelbücher, David und Goliath, Religionspädagogik, Entwicklungspsychologie (Piaget, Fowler), Didaktik, Unterrichtsplanung, Altes Testament, Bibelauslegung, religiöses Verständnis, moralische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Unterrichtsanalyse: David und Goliath
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert eine Unterrichtsstunde zum Thema David und Goliath in einer 5. Klasse. Sie beleuchtet die fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Grundlagen der Stunde und beschreibt deren methodische Umsetzung. Berücksichtigt werden dabei die Entwicklungspsychologie der Schüler und die soziokulturellen Bedingungen des Lernumfelds.
Welche Aspekte werden in der fachwissenschaftlichen Analyse behandelt?
Die fachwissenschaftliche Analyse umfasst zwei Bereiche: Erstens eine Auseinandersetzung mit den Samuelbüchern als Teil des deuteronomistischen Geschichtswerks und deren Bedeutung für die israelitische Geschichtsschreibung, inklusive der Hauptpersonen (Samuel, Saul, David) und der chronologischen Abfolge der Ereignisse. Zweitens eine Analyse der Bibelstelle 1 Samuel 17,1-54 (David und Goliath), wobei Ungereimtheiten und Spannungen angedeutet, aber nicht detailliert ausgearbeitet werden.
Welche didaktischen Aspekte werden betrachtet?
Die didaktische Analyse beinhaltet die Berücksichtigung des Lehrplans, die Auswahl und Eingrenzung des Stundeninhalts, die Lernvoraussetzungen der Schüler (10-11 Jahre), deren kognitive Entwicklung nach Piaget und Fowler, die soziokulturellen Bedingungen (Tabuisierung des Religiösen, diverse religiöse Hintergründe), die Bedeutung der individuellen Biographie, die religiöse und moralische Entwicklung der Schüler, die Frage nach Gott als grundlegendem Bezug des menschlichen Wesens und die Bedeutung von Neugier und Vertrauen im Lernprozess.
Welche methodischen Überlegungen werden angestellt?
Die Arbeit beschreibt die methodische Planung und Umsetzung der Stunde, um eine altersgerechte und motivierende Unterrichtsgestaltung zu gewährleisten. Konkrete methodische Ansätze werden jedoch nicht im Detail ausgeführt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf entwicklungspsychologische Aspekte des religiösen Verständnisses im Kindes- und Jugendalter, die fachwissenschaftliche Analyse der Samuelbücher und der David-Goliath-Erzählung, didaktische Überlegungen zur Gestaltung einer altersgerechten und motivierenden Unterrichtsstunde, die methodische Planung und Umsetzung der Stunde sowie die Bedeutung der Geschichte von David und Goliath für die Gegenwart.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: Analyse des didaktischen Bedingungsfeldes, fachwissenschaftlicher Analyse (mit Unterkapiteln zu den Samuelbüchern und zur Bibelstelle), fachdidaktischer Analyse (mit Unterkapiteln zu Lehrplanbezug, Stundenauswahl, Lernvoraussetzungen, Gegenwartsbedeutung und Lernzielen), methodischen Überlegungen und Verlaufsplanung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen Samuelbücher, David und Goliath, Religionspädagogik, Entwicklungspsychologie (Piaget, Fowler), Didaktik, Unterrichtsplanung, Altes Testament, Bibelauslegung, religiöses Verständnis und moralische Entwicklung.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2008, Unterrichtsstunde "Königsgeschichten", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/138500