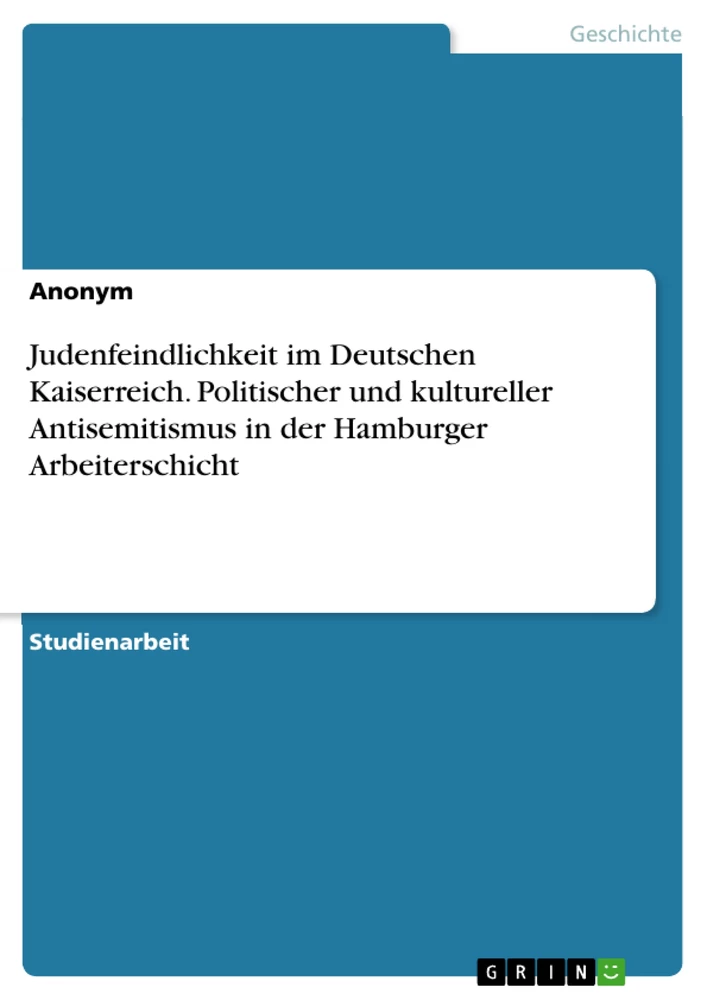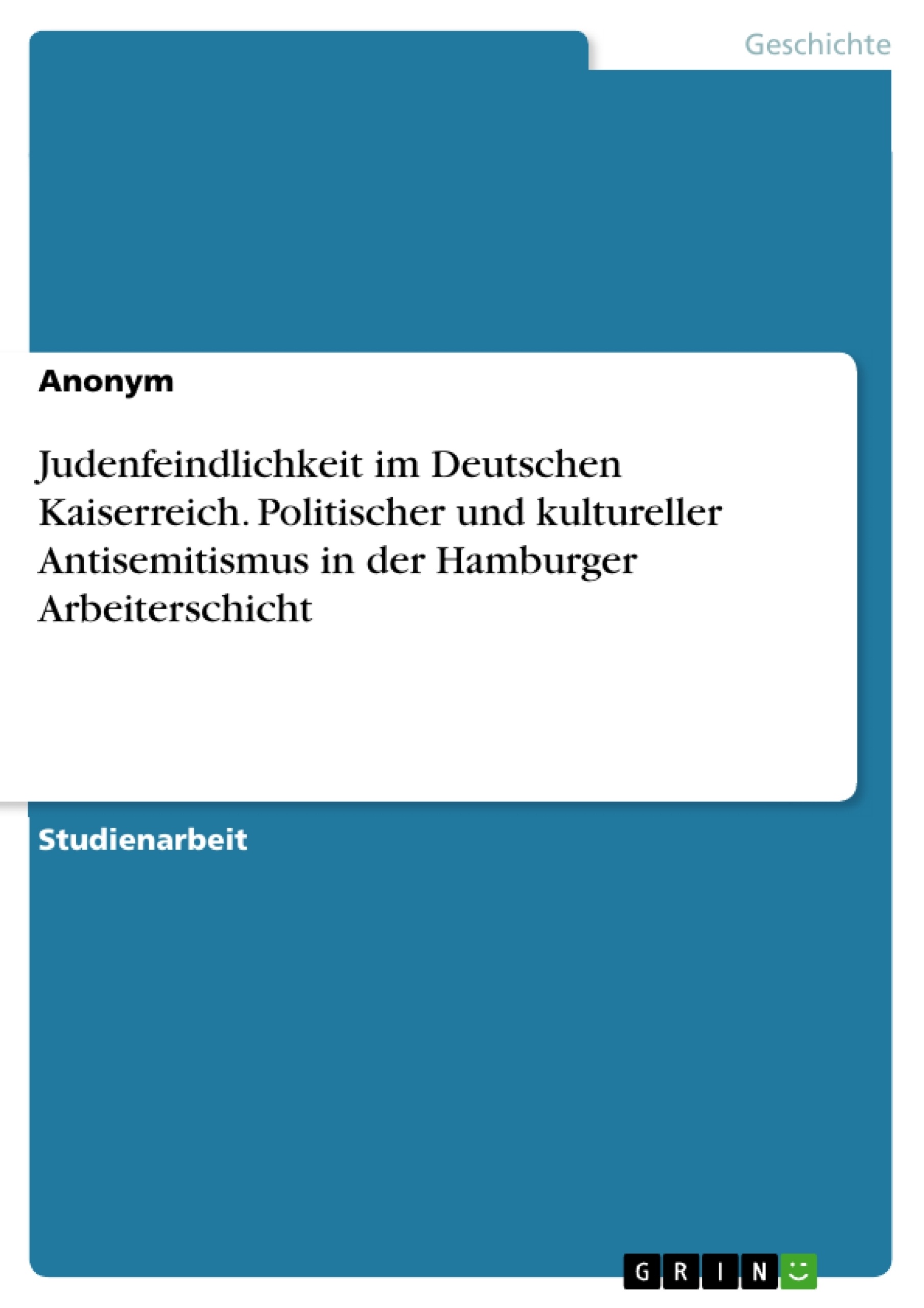Diese Arbeit befasst sich mit den verschiedenen Ausprägungen von Judenfeindlichkeit in der Hamburger Arbeiterschicht des Kaiserreichs. Speziell geht es um politischen und kulturellen Antisemitismus und seine Verbreitung in den Jahren 1893-1907. Im Kaiserreich war es nämlich kein notwendiger Widerspruch für die Menschen, politischen Antisemitismus abzulehnen, aber gleichzeitig kulturell gewachsene, anti-jüdische Stereotypen zu reproduzieren. Was aus unserer heutigen Sicht eindeutig antisemitische Vorurteile sind, galt damals für viele Menschen als "neutrale" oder sogar "berechtigte" Haltung gegenüber denjenigen, die sie als jüdisch identifizierten.
Den Beginn der Untersuchung bilden die Darstellung einiger wesentlicher Aspekte der Judenfeindlichkeit im Kaiserreich, sowie die Erläuterung zentraler Begrifflichkeiten und Definitionen, welche für das Verständnis des Themas unabdinglich sind. Anschließend folgt eine genauere Erklärung der Entstehung, Aussagekraft und Repräsentanz der Berichte und eine Auswertung ihrer Inhalte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildung von politischem und gesellschaftlichem Antisemitismus
- Antisemitische Entwicklungen im Kaiserreich
- Zeitgenössische und moderne Auffassung von Antisemitismus
- Einordnung und Auswertung der Berichte
- Historische Entstehung der Berichte
- Aussagekraft und Repräsentativität der Berichte
- Auswertung der Berichte als Quellen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ambivalenten Einstellungen der Hamburger Arbeiterschicht gegenüber Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich (1893-1907). Sie analysiert, ob die Ablehnung politischen Antisemitismus mit dem gleichzeitigen Vorhandensein kulturellen Antisemitismus in dieser Bevölkerungsgruppe vereinbar war und inwieweit diese an der Verbreitung judenfeindlicher Stereotype beteiligt war. Die Analyse basiert auf Stimmungsberichten der Hamburger Politischen Polizei.
- Politischer vs. kultureller Antisemitismus im Kaiserreich
- Die Rolle der Sozialdemokratie im Umgang mit Antisemitismus
- Analyse von Stimmungsberichten der Hamburger Politischen Polizei als Quelle
- Judenfeindliche Stereotype in der Hamburger Arbeiterschicht
- Der Einfluss wirtschaftlicher und sozialer Faktoren auf antisemitische Einstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die kontroverse Forschungsfrage nach dem Stellenwert von Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich und dessen möglichem Zusammenhang mit der späteren NS-Zeit. Sie kritisiert frühere Forschungsansätze, die sich zu stark auf den Erfolg antisemitischer Parteien konzentrierten, und betont die Notwendigkeit, die tatsächliche Verbreitung antisemitischer Ressentiments in der Bevölkerung zu untersuchen. Die Arbeit konzentriert sich auf die ambivalente Haltung der Sozialdemokratie und der Arbeiterschicht gegenüber Antisemitismus und nutzt Stimmungsberichte der Hamburger Polizei als primäre Quelle zur Untersuchung dieser Ambivalenz.
Bildung von politischem und gesellschaftlichem Antisemitismus: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung und Entwicklung von Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich. Es beschreibt, wie die Wirtschaftskrise von 1873 zu einer Zunahme antisemitischer Vorwürfe und Agitationen führte, wobei „jüdische Kapitalisten“ als Sündenböcke für die wirtschaftlichen Probleme ausgemacht wurden. Das Kapitel differenziert zwischen gesellschaftlichem Antisemitismus, der auf religiösen und traditionellen Vorurteilen beruhte, und dem politischen Antisemitismus, der sich in der Gründung antisemitischer Parteien manifestierte. Es wird herausgestellt, dass während konservative Parteien den Antisemitismus unterstützten, sich liberale und sozialdemokratische Kräfte dagegen aussprachen. Die Arbeit betont die Entwicklung einer eigenen Arbeiterklasse, geprägt durch die Herausforderungen der Industrialisierung, die auch ihren kritischen Blick auf den Staat und dessen Agitationen mitprägte.
Schlüsselwörter
Antisemitismus, Deutsches Kaiserreich, Hamburger Arbeiterschicht, Sozialdemokratie, Politische Polizei, Stimmungsberichte, Kultureller Antisemitismus, Politischer Antisemitismus, Judenfeindliche Stereotype, Wirtschaftskrise 1873, Sozialdarwinismus, Rassenideologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Ambivalente Einstellungen der Hamburger Arbeiterschicht gegenüber Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich (1893-1907)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die ambivalenten Einstellungen der Hamburger Arbeiterschicht gegenüber Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich zwischen 1893 und 1907. Sie analysiert, ob die Ablehnung politischen Antisemitismus mit dem gleichzeitigen Vorhandensein kulturellen Antisemitismus vereinbar war und inwieweit diese Bevölkerungsgruppe an der Verbreitung judenfeindlicher Stereotype beteiligt war.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Analyse basiert primär auf Stimmungsberichten der Hamburger Politischen Polizei aus dem Zeitraum 1893-1907. Diese Berichte liefern Einblicke in die öffentlichen Meinungen und Einstellungen der Hamburger Bevölkerung.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Unterschied zwischen politischem und kulturellem Antisemitismus im Kaiserreich, die Rolle der Sozialdemokratie im Umgang mit Antisemitismus, die Analyse der Stimmungsberichte als Quelle, die Verbreitung judenfeindlicher Stereotype in der Hamburger Arbeiterschicht und den Einfluss wirtschaftlicher und sozialer Faktoren auf antisemitische Einstellungen.
Wie wird der Antisemitismus im Kaiserreich eingeordnet?
Die Arbeit differenziert zwischen gesellschaftlichem Antisemitismus, der auf religiösen und traditionellen Vorurteilen beruhte, und politischem Antisemitismus, der sich in der Gründung antisemitischer Parteien manifestierte. Die Wirtschaftskrise von 1873 wird als ein Faktor für die Zunahme antisemitischer Vorwürfe und Agitationen genannt, wobei "jüdische Kapitalisten" als Sündenböcke dienten.
Welche Rolle spielte die Sozialdemokratie?
Die Arbeit untersucht die ambivalente Haltung der Sozialdemokratie gegenüber Antisemitismus. Während konservative Parteien den Antisemitismus unterstützten, wird die Position liberaler und sozialdemokratischer Kräfte als gegensätzlich dargestellt. Die komplexe Haltung der Sozialdemokratie und der Arbeiterschicht bildet einen zentralen Fokus der Analyse.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird im Kapitel "Fazit" präsentiert und fasst die Ergebnisse der Analyse der Stimmungsberichte und deren Interpretation bezüglich der ambivalenten Haltung der Hamburger Arbeiterschicht gegenüber Antisemitismus zusammen. Die Einleitung beleuchtet die kontroverse Forschungsfrage nach dem Stellenwert von Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich und dessen möglichem Zusammenhang mit der späteren NS-Zeit und kritisiert frühere Forschungsansätze.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Antisemitismus, Deutsches Kaiserreich, Hamburger Arbeiterschicht, Sozialdemokratie, Politische Polizei, Stimmungsberichte, Kultureller Antisemitismus, Politischer Antisemitismus, Judenfeindliche Stereotype, Wirtschaftskrise 1873, Sozialdarwinismus, Rassenideologie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Bildung von politischem und gesellschaftlichem Antisemitismus, ein Kapitel zur Einordnung und Auswertung der Berichte und ein Fazit.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2023, Judenfeindlichkeit im Deutschen Kaiserreich. Politischer und kultureller Antisemitismus in der Hamburger Arbeiterschicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1380555