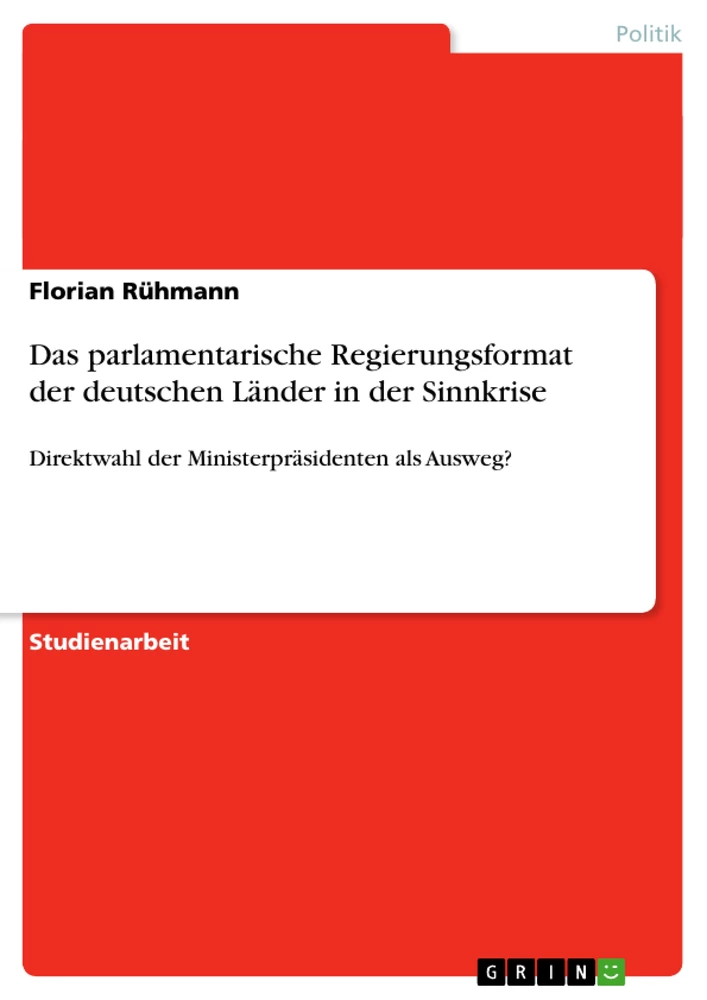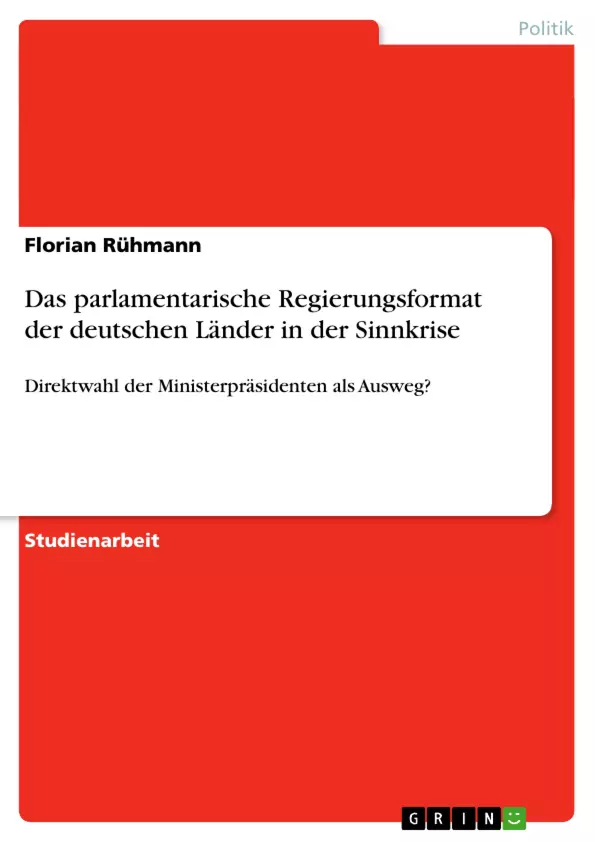„Man wird sich [...] fragen müssen, ob das parlamentarische Regierungssystem den politischen Bedürfnissen der Länder überhaupt entspricht.“ Mit diesem Ausspruch stellte Wilhelm Hennis bereits im Jahre 1956 die Form der staatlichen Neuordnung Deutschlands in Frage, wie sie nach dem 2. Weltkrieg zunächst in den Ländern der drei westlichen Besatzungszonen stattgefunden hatte. Der gesamtstaatlichen Verfassung wurde dabei das parlamentarische Regierungssystem zugrunde gelegt – eine Tradition, der sich auch die Gliedstaaten verpflichtet fühlten. Die Landesverfassungsgeber orientierten sich daher strikt am Vorbild des Parlamentarismus, so dass Bund und Länder in ihrer Organisationsstruktur bis heute keine nennenswerten Variationen aufweisen. In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob die Zeit reif ist für eine grundlegende Reform der gliedstaatlichen Verfassungen und diese zugleich geeignet erscheint, den Länderparlamentarismus aus seinem Dornröschenschlaf zu erwecken. Denn sind die Länder tatsächlich so weit mit der Bundesebene vergleichbar, dass sich dies zwangsläufig in der Einförmigkeit ihrer Regierungssysteme widerspiegeln muss? Oder sind Gemeinsamkeiten wohlmöglich eher auf der kommunalen Ebene zu suchen? Lässt sich der zunehmende Bedeutungsverlust der Landesparlamente durch die Implementierung eines präsidentiellen Regierungssystems umkehren? Ist eine solche Reform überhaupt durchführbar, ohne eine tief greifende Erschütterung des politischen Systems herbeizuführen?
In einem ersten Schritt werden zunächst die grundlegenden Unterschiede zwischen Präsidentialismus und Parlamentarismus aufgezeigt, um eine Basis für die weitere Analyse zu schaffen. Ausgestattet mit diesem Kompass wird im zweiten Teil der Arbeit kritisch hinterfragt, inwieweit das parlamentarische Modell als adäquates Regierungssystem für die Länderebene taugt, oder ob es möglicherweise seine Daseinsberechtigung verloren hat. Abschließend werden in einem dritten Schritt die Möglichkeiten und Grenzen einer Landesverfassungsreform erörtert, welche die Volkswahl der Regierungschefs in den Mittelpunkt stellt und damit die Einführung des präsidentiellen Systems auf Länderebene forciert. Dabei werden die Auswirkung einer solchen Reform auf das Institutionengefüge von Bund und Ländern untersucht, Wandlungen im Verhältnis des direkt gewählten Ministerpräsidenten zu seiner Partei in den Blick genommen, sowie Veränderungen für den Wähler selbst näher betrachtet.
Inhalt
1. Einleitung
2. Präsidentialismus vs. Parlamentarismus – Grundlegende Unterscheidungsmerkmale
3. Sinn und Unsinn des parlamentarischen Regierungsformats in den Ländern
4. Volkswahl des Ministerpräsidenten als Kernstück einer Landesverfassungsreform
4.1 Auswirkungen der Direktwahl auf das Institutionengefüge von Bund und Ländern
4.1.1 Effekte auf Landesebene
4.1.2 Konsequenzen für das Bund-Länder-Verhältnis
4.2 Verhältnis des unmittelbar legitimierten Ministerpräsidenten zu seiner Partei
4.3 Die Direktwahl als Element aktiver Bürgerbeteiligung
5. Präsidentialismus auf Länderebene – Innovative Reform oder Irrweg?
(Schlussbetrachtung)
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Mit diesem Ausspruch stellte Wilhelm Hennis[1] bereits im Jahre 1956 die Form der staatlichen Neuordnung Deutschlands in Frage, wie sie nach dem 2. Weltkrieg zunächst in den Ländern der drei westlichen Besatzungszonen stattgefunden hatte. Der gesamtstaatlichen Verfassung wurde dabei das parlamentarische Regierungssystem zugrunde gelegt – eine Tradition, der sich auch die Gliedstaaten verpflichtet fühlten. Die Landesverfassungsgeber orientierten sich daher strikt am Vorbild des Parlamentarismus, so dass Bund und Länder in ihrer Organisations-struktur bis heute keine nennenswerten Variationen aufweisen. Auch im Zuge der Wieder-vereinigung änderte sich daran nichts; die neuen Länder übernahmen anstandslos das parlamentarische Regierungsformat der gesamtstaatlichen Ebene.
In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob die Zeit reif ist für eine grundlegende Reform der gliedstaatlichen Verfassungen und diese zugleich geeignet erscheint, den Länderparlamentarismus aus seinem Dornröschenschlaf zu erwecken. Denn sind die Länder tatsächlich so weit mit der Bundesebene vergleichbar, dass sich dies zwangsläufig in der Einförmigkeit ihrer Regierungssysteme widerspiegeln muss? Oder sind Gemeinsam-keiten wohlmöglich eher auf der kommunalen Ebene zu suchen? Lässt sich der zunehmende Bedeutungsverlust der Landesparlamente durch die Implementierung eines präsidentiellen Regierungssystems umkehren? Wäre ein direkt gewählter Ministerpräsident in der Lage und Willens, den bundespolitischen Parteieneinfluss auf die Landesebene zurückzudrängen? Ist eine solche Reform überhaupt durchführbar, ohne eine tief greifende Erschütterung des politischen Systems herbeizuführen?
In einem ersten Schritt werden zunächst die grundlegenden Unterschiede zwischen Präsidentialismus und Parlamentarismus aufgezeigt, um eine Basis für die weitere Analyse zu schaffen. Dabei sind insbesondere die von Winfried Steffani in seinem Werk „Parlamentarische und präsidentielle Demokratie“[2] dargelegten Unterscheidungskriterien von Bedeutung, welche eine eindeutige Zuordnung von Regierungsformaten zu einem der beiden Systemtypen ermöglichen. Ausgestattet mit diesem Kompass wird im zweiten Teil der Arbeit kritisch hinterfragt, inwieweit das parlamentarische Modell als adäquates Regierungssystem für die Länderebene taugt, oder ob es möglicherweise seine Daseinsberechtigung verloren hat. Stützend auf zahlreiche Veröffentlichungen des Verfassungsrechtlers Hans Herbert von Arnim[3] sowie die Dissertation von Jan L. Backmann zur „Direktwahl der Ministerpräsidenten“[4], werden in einem dritten Schritt die Möglichkeiten und Grenzen einer Landesverfassungs-reform erörtert, welche die Volkswahl der Regierungschefs in den Mittelpunkt stellt und damit die Einführung des präsidentiellen Systems auf Länderebene forciert. Dabei werden die Aus-wirkung einer solchen Reform auf das Institutionengefüge von Bund und Ländern untersucht, Wandlungen im Verhältnis des direkt gewählten Ministerpräsidenten zu seiner Partei in den Blick genommen, sowie Veränderungen für den Wähler selbst näher betrachtet. Als Kritiker des Direktwahlvorschlags gilt es abschließend insbesondere Hans H. Klein und seinen Aufsatz „Direktwahl der Ministerpräsidenten?“[5] hervorzuheben.
Ziel dieser Arbeit ist es, zunächst einen groben Überblick über die gegenwärtige Lage der parlamentarischen Regierungsform auf Landesebene zu geben. Daraufhin soll der aktuelle Diskussionsstand bezüglich einer Direktwahl der Ministerpräsidenten als das Kernstück des Reformvorschlages skizziert werden, um die mit ihm einhergehenden verfassungsrechtlichen und verfassungspolitischen Konsequenzen abschätzen und bewerten zu können. Abschließend sollen die Realisierungschancen des Direktwahlvorschlags erörtert und der Frage nach-gegangen werden, ob das präsidentielle System den Ländern aus ihrer Sinnkrise verhelfen kann oder eine solche Reform zwangsläufig als Rohrkrepierer enden muss.
2. Präsidentialismus vs. Parlamentarismus – Grundlegende Unterscheidungsmerkmale
Die Frage nach der Zweckmäßigkeit des parlamentarischen Regierungsformats für die Länderebene setzt eine vorhergehende Analyse der wesentlichen Unterscheidungskriterien präsidentieller und parlamentarischer Regierungssysteme zwangsläufig voraus. Besonders da mit ihr das Verhältnis von Exekutive und Legislative – die Substanz eines jeden demo-kratischen Systems – berührt und näher austangiert wird.
Die herkömmliche Methode versucht dabei den Merkmalen der beiden Systemtypen durch „ein katalogartiges Verfahren“[6] näher zu kommen. Dem präsidentiellen System werden insbesondere die Attribute Direktwahl des Präsidenten durch das Volk, relative Unabhängigkeit von Regierung und Parlament sowie eine geschlossene Exekutive zugeordnet, während das parlamentarische System vorwiegend durch die Verschränkung von Regierung und Parlament sowie eine doppelte Exekutive charakterisiert wird. Darüber hinaus können jedoch zahlreiche weitere Merkmale[7] zur Unterscheidung genannt werden, so dass eine bloße Auflistung ebendieser nicht als besonders hilfreich erscheint. So kann sich die Zuordnung eines Regierungssystems zum Typus des Präsidentialismus oder des Parlamentarismus schnell dem Vorwurf der Beliebigkeit ausgesetzt sehen. Ebenso gut sind Mischtypen zwischen beiden Regierungssystemen möglich, was gleichermaßen einer klaren Abgrenzung abträglich ist und in Begriffen wie dem des Semi-Präsidentialismus[8] seine Entsprechung findet.
Wesentlich stringenter erscheint daher die Methode von Winfried Steffani. Dieser reduziert die Unterscheidungsmerkmale auf ein singuläres Kriterium, namentlich die Abberufbarkeit oder Nicht-Abberufbarkeit der Regierung durch das Parlament. Um auch in der Struktur der beiden Systemtypen eine Differenzierung zu ermöglichen, treten nachfolgend weitere supplementäre Merkmale hinzu.[9] Entscheidend bleibt jedoch das parlamentarische Abberufungsrecht, welches „wesentlich die Systemfunktionen [...] des Parteiensystems bestimmt.“[10] Während im präsidentiellen Regierungssystem Exekutive und Legislative in getrennten Wahlen legitimiert werden und sich nach klassischer Gewaltenteilungslehre klar gegenüberstehen, geht die Regierung im parlamentarischen System aus dem Parlament hervor und ist daher von dessen Vertrauen abhängig. Der neue Dualismus findet demnach eher zwischen Regierung und Parlamentsmajorität einerseits sowie Parlamentsminorität – der Opposition – andererseits statt. Die Abgeordneten der Mehrheitsfraktionen müssen ‚ihre’ Regierung im Amt halten, um Stabilität und Aktionsfähigkeit der Exekutive zu gewährleisten. Eine parlamentarische Regierung wird daher umso erfolgreicher sein, je enger sie „mit der sie tragenden Parlamentsmehrheit verbunden ist“[11], was letztlich in einer stark ausgeprägten Mehrheitsdisziplin mündet. Dies geht soweit, dass oft schon eine Abstimmungsniederlage der Regierung als schwere Krise gewertet wird und letztlich zu deren Sturz führen kann. Im präsidentiellen System verhält sich dies anders: Zwar ist die Regierung zur Durchsetzung ihrer Programmvorhaben ebenfalls auf die Zustimmung des Parlaments angewiesen, jedoch kann sie sich dabei gegebenenfalls auf wechselnde Mehrheiten – und damit auch auf Stimmen aus dem Oppositionslager – stützen. Da im präsidentiellen System die Amtsdauer der Exekutive institutionell gesichert ist und sie somit nicht Gefahr läuft durch die Legislative abberufen zu werden, wird der Regierung ein Zurückgreifen auf solche ad hoc-Mehrheiten nicht als Schwäche ausgelegt.[12]
Doch kann die Unterscheidung zwischen Parlamentarismus und Präsidentialismus wirklich allein am Kriterium der Abberufbarkeit bzw. Nicht-Abberufbarkeit der Exekutive festgemacht werden? Eine weiteres Merkmal, das bei Steffani implizit immer mitgedacht wird, dürfte die Art und Weise sein, nach der die Bestellung der Regierung erfolgt. Dieses Charakteristikum ist jedoch in erster Linie als ein verfassungspolitisches zu sehen, welches hinter dem verfassungsrechtlichen Kriterium der Abberufung der Regierung zumindest terminologisch zurückstehen muss.[13] So bleibt festzuhalten, dass das genannte Hauptmerkmal als zunächst grobes Unterscheidungskriterium fungiert, unter welchem sich jedes politische System – demokratische Grundstrukturen vorausgesetzt – eindeutig als parlamentarisch oder präsidentiell subsummieren lässt. Eine weitere Ausdifferenzierung kann je nach Einzelfall durch das Hinzufügen zusätzlicher supplementärer Attribute erreicht werden.
3. Sinn und Unsinn des parlamentarischen Regierungsformats in den Ländern
Die Regierungssysteme der Länder kommen insgesamt alle – von geringen Abweichungen zwischen den einzelnen Gliedstaaten abgesehen – dem „Idealtypus einer parlamentarischen Demokratie mit plebiszitären Erweiterungen“[14] sehr nahe und sind ausnahmslos mit einem Einkammerparlament sowie geschlossener Exekutive ausgestattet. Auch wenn letzteres Merk-mal zunächst auf eine präsidentielle Organisationsstruktur hindeuten mag, zeigt ein Blick auf das in allen Landesverfassungen verankerte Misstrauensvotum, dass es sich – dem Kriterium der Abberufbarkeit folgend – zweifelsfrei um parlamentarische Systeme handelt. Sie sind damit dem Regierungsformat der Bundesebene weitestgehend nachempfunden und unter-scheiden sich von dieser lediglich durch die Einrichtung zusätzlicher direktdemokratischer Elemente.[15] Vor dem Hintergrund des unitarischen Föderalismus deutscher Prägung mag die geringe Variationsbreite der Landesverfassungen und ihrer Regierungsformate zwar nicht weiter überraschen, verfassungsrechtlich zwingend ist sie jedoch keineswegs: So schreibt das Grundgesetz in dem als Homogenitätsgebot bezeichneten Art. 28 Abs. 1 lediglich vor, dass die Länder in ihrer verfassungsmäßigen Ordnung republikanischen, demokratischen, sozialen und rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen müssen. Die Beschränkung des Verfassungs-wortlauts auf diese sehr allgemeinen Prinzipien, legt den Schluss nahe, dass ‚Homogenität’ in diesem Fall nicht mit ‚Identität’ gleichgesetzt werden darf[16] und Abweichungen in den Regierungssystemen zwischen Bund und Ländern durchaus vorstellbar sind.[17]
Eine allzu große Nähe der beiden Regierungsebenen in ihrer verfassungsrechtlichen Ausgestaltung suggeriert zudem die Existenz überwiegend deckungsgleicher Aufgabenfelder. Mit Blick auf die Verwaltungslastigkeit der Länderpolitik kann jedoch festgestellt werden, „dass sich Bund und Länder vom politischen Charakter ihres Aufgabenzuschnitts deutlich unterscheiden.“[18] Während auf Bundesebene Gesetze beraten und verabschiedet werden, sind die Gliedstaaten vorwiegend für deren Vollzug zuständig. Dieses Verbundprinzip, nach welchem der Bund zur Durchsetzung seiner Normen mangels eigenem administrativen Unter-bau auf die Landesverwaltungen zurückgreift, mag aus praktischer Sicht sehr nützlich sein. Einer klaren Zuordnung politischer Verantwortlichkeit ist diese Konstruktion jedoch eher abträglich. Zudem fällt den Ländern dadurch ein systemimmanentes Interesse zu, auf die Ausgestaltung von Bundesgesetzen – insbesondere auf deren verwaltungstechnischen Voll-zugsregelungen – einen größtmöglichen Einfluss zu nehmen. Dieser ist den Ländern über ihre Mitwirkung im Bundesrat gesichert. Da dort jedoch ausschließlich die Landesregierungen repräsentiert sind, kann die bundesstaatliche Ordnung Deutschlands mit dem Diktum des Exekutivföderalismus charakterisiert werden.[19] Die Landesparlamente haben keinerlei Mög-lichkeit, auf das Abstimmungsverhalten der Landesregierungen im Bundesrat einzuwirken. Nicht einmal ‚ihrer’ Parlamentsmehrheit gegenüber ist die Exekutive dabei de facto ver-antwortlich.[20] Umgekehrt tut sich ebenfalls ein Legitimationsvakuum auf, da auch der Bundes-tag – haben seine Gesetze erst einmal die Länderkammer passiert – keinen Einfluss mehr auf deren Umsetzung nehmen kann. Die mit der Ausführung betrauten Landesexekutiven berufen sich gegenüber ihren Parlamenten wiederum auf verbindliche Bundesvorgaben, was bildlich gesprochen in einem „Verschiebebahnhof für politische Verantwortung“[21] mündet. Eine effektive Kontrolle findet somit nicht statt; dies widerspricht jedoch, wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde, den Grundprinzipien eines parlamentarischen Systems auf eklatante Weise.
[...]
[1] Wilhelm Hennis: Politik als praktische Wissenschaft. Aufsätze zur politischen Theorie und Regierungslehre, 2. Aufl., München 1968, S. 118f.
[2] Winfried Steffani: Parlamentarische und präsidentielle Demokratie. Strukturelle Aspekte westlicher Demo-kratien, Opladen 1979.
[3] Stellvertretend seien hier die Thesen der Frankfurter Intervention genannt: Hans Herbert von Arnim: Wege aus der Krise des Parteienstaates. Thesen der “Frankfurter Intervention“, in: Recht und Politik. Vierteljahreshefte für Rechts- und Verwaltungspolitik, Jg. 31, 1 (1995), S. 16-26.
[4] Jan L. Backmann: Direktwahl der Ministerpräsidenten. Als Kern einer Reform der Landesverfassungen, Diss., Speyer 2005.
[5] Hans H. Klein: Direktwahl der Ministerpräsidenten?, in: Burkhardt Ziemske u.a. (Hrsg.): Staatsphilosophie und Rechtspolitik. Festschrift für Martin Kriele zum 65. Geburtstag, München 1997, S. 573-586.
[6] Frank Decker: Direktwahl der Ministerpräsidenten?, in: Recht und Politik. Vierteljahreshefte für Rechts- und Verwaltungspolitik, Jg. 37, 3 (2001), S. 152.
[7] Neben verfassungsrechtlichen Kriterien werden oftmals auch verfassungspolitische Kategorien zur Unter-scheidung angeführt. Vgl. Ernst Fraenkel: Parlamentarisches Regierungssystem, in: Ders. / Karl Dietrich Bracher (Hrsg.): Staat und Politik, Frankfurt am Main 1957, S. 240f.
[8] Siehe dazu Maurice Duverger: A New Political System Model: Semi-Presidential Government, in: European Journal of Political Research, Jg. 8, 2 (1980), S. 165-187.
[9] Vgl. Steffani: a.a.O. (Anm. 2), S. 38f. Als supplementäre Merkmale gelten dabei zum einen formale Kriterien wie die Unterscheidung von Republik und Monarchie. Zum anderen fallen darunter materielle Merkmale, die auf die Machtverteilung innerhalb der Exekutive sowie im Verhältnis zwischen Exekutive und Legislative eingehen.
[10] Winfried Steffani: Parlamentarisches und präsidentielles Regierungssystem, in: Dieter Nohlen (Hrsg.): Lexikon der Politik. Band 3: Die westlichen Länder (hrsgg. von Manfred G. Schmidt), München 1992, S. 290.
[11] Steffani: a.a.O. (Anm. 2), S. 51.
[12] Vgl. Steffani: a.a.O. (Anm. 2), S. 55-58.
[13] Vgl. ebd., S. 40. Die dahinter stehende Beobachtung ist, dass normalerweise auch im parlamentarischen System der Regierungschef nicht direkt durch das Parlament ins Amt gelangen kann, sondern einer Ernennung durch das Staatsoberhaupt bedarf. Dessen Entscheidung muss sich aufgrund des Abberufungsrechts des Parlaments jedoch an den gegebenen Mehrheitsverhältnissen orientieren, wodurch de facto der „Parlamentswille bei der Regierungs-bestellung allein ausschlaggebend“ bleibt. Winfried Steffani: Regierungsmehrheit und Opposition, in: Ders. (Hrsg.): Regierungsmehrheit und Opposition in den Staaten der EG, Opladen 1991, S. 17.
[14] Sigrid Koch-Baumgarten: Der Landtag von Rheinland-Pfalz: Vom Entscheidungsträger zum Politikvermittler?, in: Siegfried Mielke / Werner Reutter (Hrsg.): Länderparlamentarismus in Deutschland. Geschichte – Struktur – Funktionen, Wiesbaden 2004, S. 341.
[15] Siehe dazu Andreas Kost (Hrsg.): Direkte Demokratie in den deutschen Ländern. Eine Einführung, Wiesbaden 2005.
[16] Vgl. Sven Leunig: Die Regierungssysteme der deutschen Länder im Vergleich, Opladen / Farmington Hills 2007, S. 62.
[17] Die Weimarer Reichverfassung hatte in Art. 17 dagegen das parlamentarische Regierungsformat auch für die Gliedstaaten verbindlich vorgeschrieben. Vgl. Jörg Menzel: Landesverfassungsrecht. Verfassungshoheit und Homogenität im grundgesetzlichen Bundesstaat, Diss., Bonn 1995, S. 256.
[18] Frank Decker: Das parlamentarische System in den Ländern. Adäquate Regierungsform oder Auslaufmodell?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Jg. 54, 50/51 (2004), S. 4.
[19] Vgl. Hans-Georg Wehling: Landespolitik und Länderpolitik im föderalistischen System Deutschlands – zur Einführung, in: Herbert Schneider / Ders. (Hrsg.): Landespolitik in Deutschland. Grundlagen – Strukturen – Arbeitsfelder, Wiesbaden 2006, S. 11-15.
[20] Vgl. Frank Decker: Die Regierungssysteme in den Ländern, in: Ders. (Hrsg.): Föderalismus an der Weg-scheide? Optionen und Perspektiven einer Reform der bundesstaatlichen Ordnung, Wiesbaden 2004, S. 191ff.
[21] Thomas Ellwein: Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, 4. völlig neubearbeitete Aufl., Opladen 1977, S. 73.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob das parlamentarische Regierungssystem für die deutschen Bundesländer noch zeitgemäß ist oder ob eine Reform hin zu einem präsidentiellen System (z. B. durch Direktwahl der Ministerpräsidenten) sinnvoll wäre.
Was ist das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Parlamentarismus und Präsidentialismus nach Winfried Steffani?
Das entscheidende Kriterium ist die Abberufbarkeit (Parlamentarismus) bzw. Nicht-Abberufbarkeit (Präsidentialismus) der Regierung durch das Parlament.
Warum wird von einer „Sinnkrise“ des Länderparlamentarismus gesprochen?
Es wird kritisiert, dass die Landesparlamente an Bedeutung verlieren, da sie oft nur das Modell der Bundesebene kopieren und stark vom bundespolitischen Parteieneinfluss dominiert werden.
Welche Auswirkungen hätte eine Direktwahl der Ministerpräsidenten?
Eine Direktwahl würde die demokratische Legitimation des Regierungschefs stärken, könnte aber das Verhältnis zu seiner Partei und das Institutionengefüge zwischen Bund und Ländern erheblich verändern.
Werden in der Arbeit auch Gegenargumente zur Direktwahl beleuchtet?
Ja, die Arbeit bezieht kritische Stimmen ein, wie etwa den Aufsatz von Hans H. Klein, um die verfassungsrechtlichen Risiken abzuwägen.
- Quote paper
- Florian Rühmann (Author), 2009, Das parlamentarische Regierungsformat der deutschen Länder in der Sinnkrise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137756