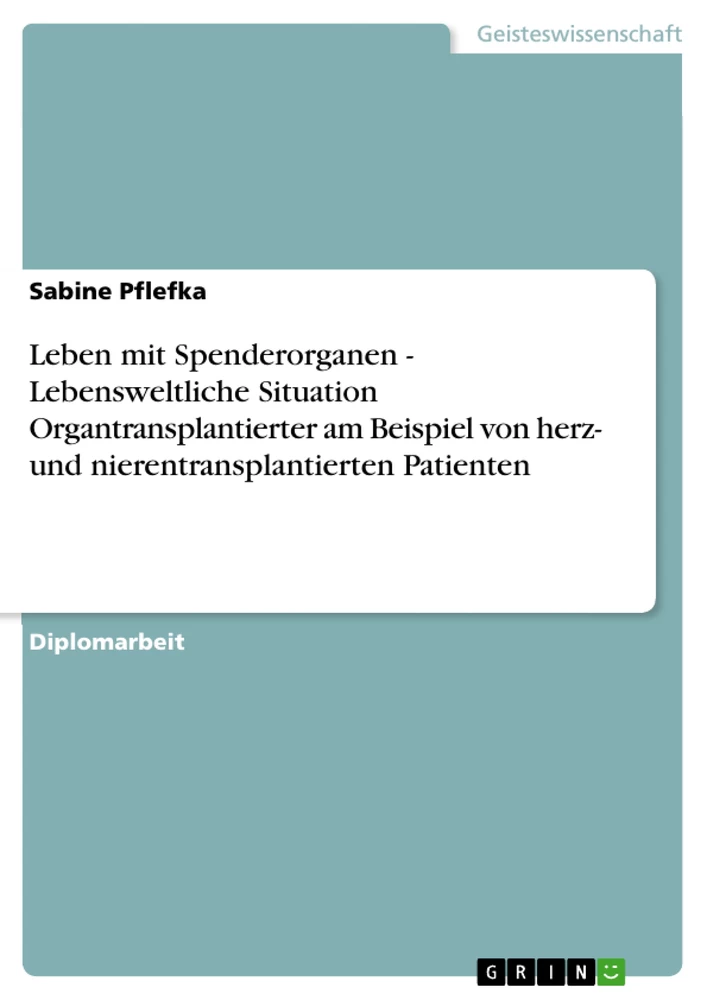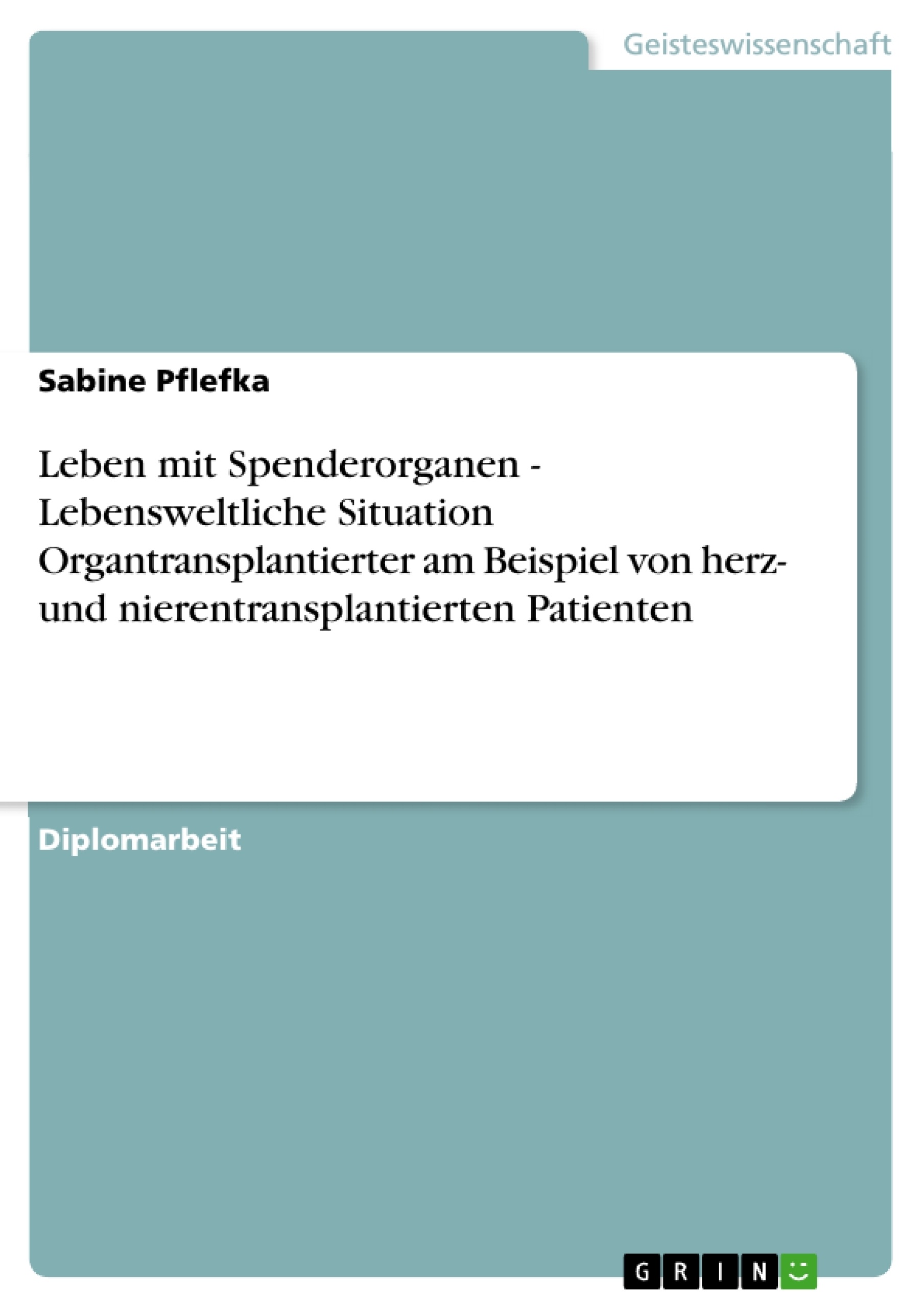[...]
Es findet ein langsames Umdenken in der medizinischen Versorgung statt, „Leben“ wird dabei nicht mehr nur als reines „Überleben“ bewertet, sondern beide Dimensionen, die
Quantität und die Qualität des Lebens bestimmen den Therapieerfolg. Die Diskussion
darüber, welche Behandlungsmaßnahme für den jeweiligen Patienten den größten Nutzen
verspricht, wird vermehrt unter der Einbeziehung des lebensweltlichen Kontextes des
Betroffenen geführt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den sozialpädagogischen Aspekten des
Transplantationsprozesses. Sie gibt Einblick in die lebensweltliche Situation von
Organtransplantierten am Beispiel von herz- und nierentransplantierten Patienten.2
Im Anschluß an Husserl3 wird die Lebenswelt als „die Sphäre des Alltags“ (Gstettner 1997,
633) und als „meine Welt“ (ebd. 633) definiert, in der sich die jeweils eigenen Erfahrungen
im Umgang mit Personen, Beziehungen, Orten und Dingen herausbilden.
„Die Lebenswelt ist die unhintergehbare kulturelle Folie, in die die Biographie
'eingewickelt' ist. Die Lebenswelt stellt jene evident gegebene Erfahrungsbasis dar, auf
die sich alle Erinnerungen, gegenwärtigen Handlungen und zukünftigen Hoffnungen
beziehen.“ (ebd.)
Die Lebenswelt ist prinzipiell offen, so daß Menschen, Ideen und Dinge aus anderen
Lebenswelten in unsere eigene eindringen und für unser Handeln Bedeutung gewinnen
können. In sozialer Hinsicht ist sie ebenfalls offen, da das, was dem Menschen als seine
Lebenswelt erscheint und sein Fühlen, Handeln und Denken im Alltag bestimmt, eine mit
anderen Menschen geteilte Erfahrung ist. Laut Mollenhauer (1972, 35) konstituiert sich
„meine Welt“ als soziale Wirklichkeit nur in Verschränkung mit anderen „Welten“ und
über Interaktionen (vgl. Gstettner 1997, 634).4
2 In der Arbeit wird der besseren Lesbarkeit halber auf eine geschlechtsspezifische Ausformulierung
verzichtet (außer in Kap. 3.3.4). Selbstverständlich ist auch immer die jeweils weibliche Form
angesprochen.
3 Edmund Husserl (1859 geboren, 1938 verstorben) hat den Begriff der Lebenswelt geprägt und begründete
die philosophische Richtung der Phänomenologie.
4 Eine ausführliche Darstellung verschiedener Aspekte von „Lebenswelt“ findet u.a. bei Schütz/Luckmann
(1979a; 1979b) statt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Herztransplantation - Nierentransplantation
- Geschichte und Entwicklung der Organtransplantation
- Gegenwärtige Situation der Herz- und Nierentransplantation
- Medizinische Aspekte der Herztransplantation
- Medizinische Aspekte der Nierentransplantation
- Lebensqualität nach Organtransplantation
- Begriffsklärung „Lebensqualität“
- Somatische und psychosoziale Auswirkungen der Transplantation
- Körperliche Befindlichkeit
- Körperbild und Körpererleben
- Emotionen, Psyche
- Bedeutung für die Partnerschaft
- Sozialkontakte und Freizeit
- Aspekte bezüglich Identität und Ethik
- Berufliche und finanzielle Situation
- Zusammenfassende Bemerkungen
- Krankheitsbewältigung
- Krankheitskonzepte
- Compliance
- Soziale Unterstützung
- Abschließende Bemerkungen
- Psychosoziale Hilfen für Patienten nach Transplantation
- Patientenschulung und Patientenberatung
- Gruppen für Organtransplantierte
- Persönliche Erfahrungen im Umgang mit Organtransplantierten Patienten
- Resumee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die lebensweltliche Situation von herz- und nierentransplantierten Patienten. Ziel ist es, über die rein medizinischen Aspekte hinaus, die subjektive Lebensqualität und die Bewältigungsstrategien dieser Patientengruppe zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die psychosozialen Auswirkungen der Transplantation auf verschiedene Lebensbereiche.
- Lebensqualität nach Organtransplantation
- Psychosoziale Auswirkungen der Transplantation
- Krankheitsbewältigung und Compliance
- Soziale Unterstützungssysteme
- Psychosoziale Hilfen für transplantierte Patienten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Organtransplantation ein und betont die Bedeutung der psychosozialen Aspekte neben den medizinischen Erfolgen. Am Beispiel der Transplantation einer Hand wird gezeigt, dass medizinischer Erfolg nicht automatisch mit subjektivem Gewinn für den Patienten gleichzusetzen ist. Die Arbeit hebt die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der Situation Transplantierter hervor, die sowohl medizinische als auch psychosoziale Faktoren berücksichtigt.
Herztransplantation - Nierentransplantation: Dieses Kapitel beschreibt die Geschichte und Entwicklung der Herz- und Nierentransplantation, von den Anfängen der Chirurgie bis zur Einführung von Cyclosporin A. Es beleuchtet die gegenwärtige medizinische Situation, einschließlich Indikationen, Kontraindikationen, postoperative Aspekte und mögliche Nebenwirkungen der Medikamente für beide Transplantationsarten. Der Fokus liegt auf der Darstellung des medizinischen Hintergrunds, der für das Verständnis der späteren psychosozialen Aspekte unerlässlich ist.
Lebensqualität nach Organtransplantation: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit dem komplexen Konzept der Lebensqualität nach einer Organtransplantation. Es werden verschiedene Aspekte der Lebensqualität untersucht, darunter die körperliche Befindlichkeit, das Körperbild und -erleben (einschließlich der emotionalen Beziehung zum Spenderorgan), die psychische Verfassung, die Partnerschaft, soziale Kontakte, Freizeitaktivitäten, sowie ethische und identitätsbezogene Fragen. Die Kapitel analysieren die Auswirkungen der Transplantation auf den gesamten Lebensbereich der Betroffenen.
Krankheitsbewältigung: Dieser Abschnitt beleuchtet die Strategien, die transplantierte Patienten zur Bewältigung ihrer Erkrankung einsetzen. Es werden unterschiedliche Krankheitskonzepte erörtert und der Begriff der Compliance eingehend erklärt. Der Einfluss des sozialen Umfelds und die Bedeutung sozialer Unterstützung auf den Umgang mit der Krankheit und die Einhaltung der medizinischen Vorgaben werden untersucht. Die verschiedenen Aspekte der Krankheitsbewältigung werden detailliert betrachtet, um ein umfassendes Bild zu liefern.
Psychosoziale Hilfen für Patienten nach Transplantation: Das Kapitel beschreibt verschiedene Formen der psychosozialen Unterstützung für transplantierte Patienten, insbesondere Patientenschulung, Patientenberatung und Selbsthilfegruppen. Es werden die Ziele, Kosten und Nutzen dieser Angebote analysiert, sowie die Herausforderungen und Leistungen von Selbsthilfegruppen im Detail dargestellt. Ein konkretes Beispiel einer Selbsthilfeorganisation wird vorgestellt, um die praktische Umsetzung psychosozialer Hilfe zu illustrieren.
Schlüsselwörter
Organtransplantation, Herztransplantation, Nierentransplantation, Lebensqualität, psychosoziale Aspekte, Krankheitsbewältigung, Compliance, soziale Unterstützung, Selbsthilfegruppen, Patientenschulung, Patientenberatung, Identität, Körperbild.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Lebensqualität und Krankheitsbewältigung nach Herz- und Nierentransplantation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Lebensqualität und Bewältigungsstrategien von Patient*innen nach Herz- und Nierentransplantation. Sie betrachtet die psychosozialen Auswirkungen der Transplantation auf verschiedene Lebensbereiche, über die rein medizinischen Aspekte hinaus.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte der Organtransplantation, die medizinischen Aspekte von Herz- und Nierentransplantationen, die Definition und Messung von Lebensqualität nach Transplantation, die psychosozialen Auswirkungen auf Körperbild, Psyche, Beziehungen, soziale Kontakte und Beruf, Krankheitsbewältigungsstrategien, Compliance, soziale Unterstützung, sowie die verfügbaren psychosozialen Hilfen wie Patientenschulung und Selbsthilfegruppen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Herz- und Nierentransplantation (inklusive medizinischer Aspekte), Lebensqualität nach Transplantation (mit Unterpunkten zu körperlicher und psychosozialer Befindlichkeit, Beziehungen etc.), Krankheitsbewältigung (inkl. Compliance und sozialer Unterstützung), psychosozialen Hilfen für transplantierte Patienten und einem Resümee. Zusätzlich beinhaltet sie ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die subjektive Lebensqualität und die Bewältigungsstrategien von herz- und nierentransplantierten Patient*innen zu beleuchten und die psychosozialen Auswirkungen der Transplantation auf verschiedene Lebensbereiche zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Organtransplantation, Herztransplantation, Nierentransplantation, Lebensqualität, psychosoziale Aspekte, Krankheitsbewältigung, Compliance, soziale Unterstützung, Selbsthilfegruppen, Patientenschulung, Patientenberatung, Identität, Körperbild.
Wie wird die Lebensqualität nach Transplantation betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Lebensqualität nach Transplantation umfassend und betrachtet verschiedene Aspekte wie die körperliche Befindlichkeit, das Körperbild und -erleben, die emotionale Verfassung, die Partnerschaft, soziale Kontakte, Freizeitaktivitäten und ethische sowie identitätsbezogene Fragen.
Welche Rolle spielt die Krankheitsbewältigung?
Die Arbeit analysiert die Strategien, die transplantierte Patienten zur Bewältigung ihrer Erkrankung einsetzen, einschließlich Krankheitskonzepte, Compliance und der Bedeutung sozialer Unterstützung.
Welche psychosozialen Hilfen werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt Patientenschulung, Patientenberatung und Selbsthilfegruppen als Formen der psychosozialen Unterstützung für transplantierte Patienten, analysiert deren Ziele, Nutzen und Herausforderungen.
Welche medizinischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt die Geschichte und Entwicklung der Herz- und Nierentransplantation, die gegenwärtige medizinische Situation (Indikationen, Kontraindikationen, postoperative Aspekte und Nebenwirkungen der Medikamente) als Grundlage für das Verständnis der psychosozialen Aspekte.
- Quote paper
- Sabine Pflefka (Author), 2001, Leben mit Spenderorganen - Lebensweltliche Situation Organtransplantierter am Beispiel von herz- und nierentransplantierten Patienten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13743