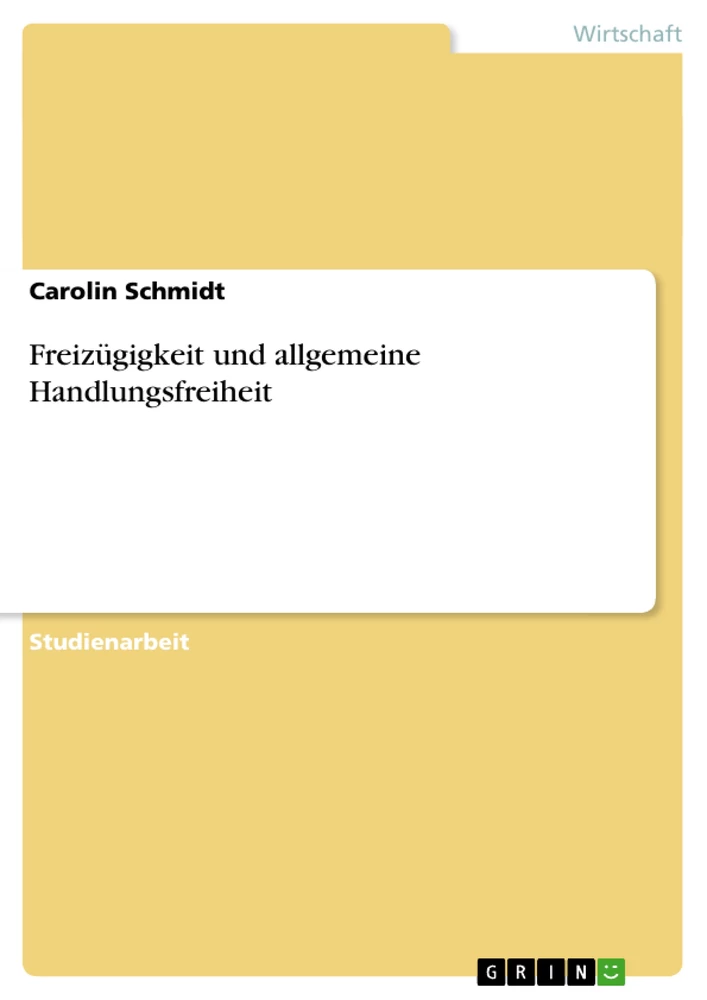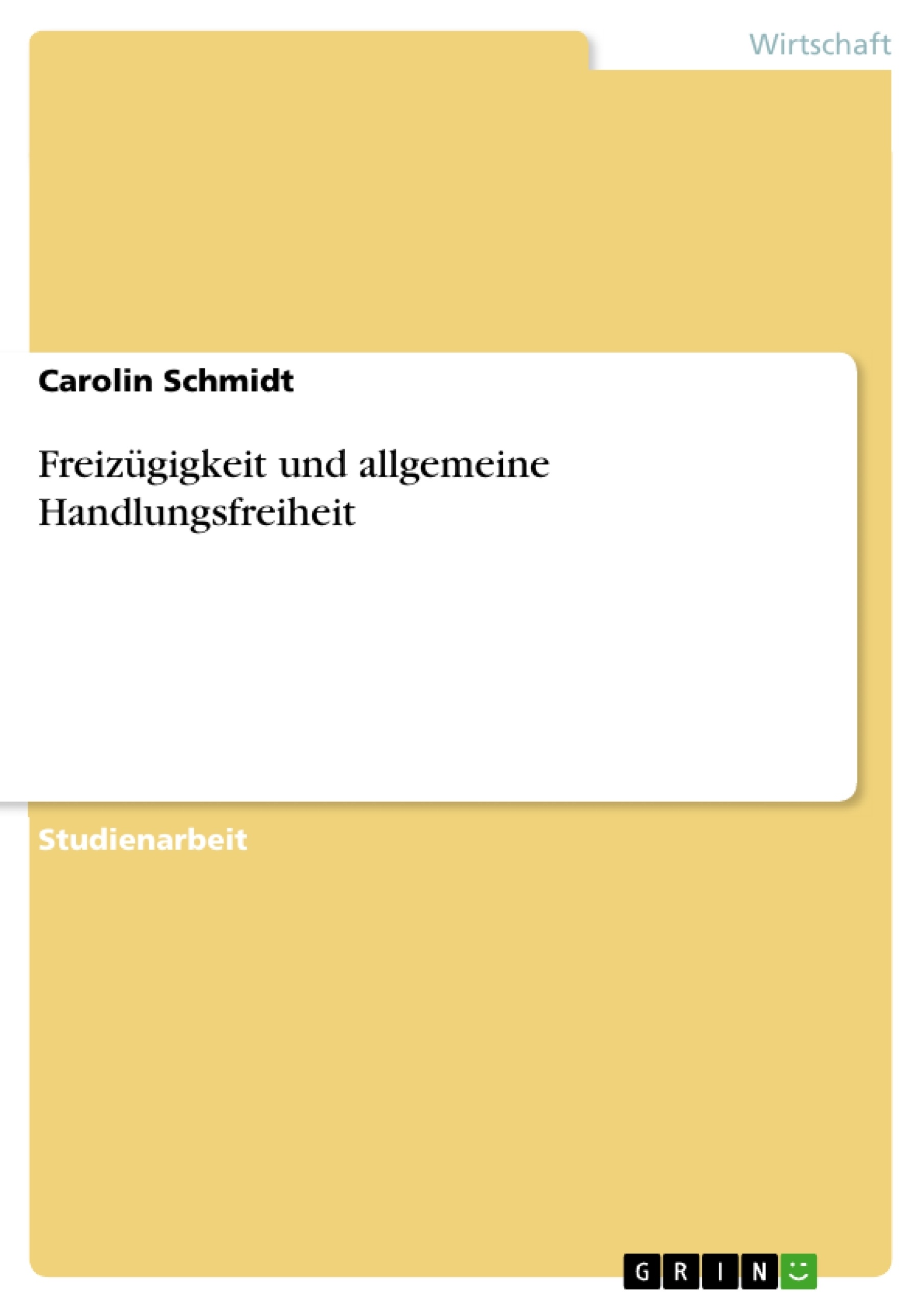Vorerst ist zwischen persönlichem und sachlichen Schutzbereich zu unterscheiden. Der persönliche Schutzbereich dieses „Jedermann- Grundrechts“ umfasst sowohl jede denkbare menschliche Betätigung, als auch jeden Menschen, gleich ob Ausländer oder Deutscher. Die Bezeichnung als allgemeines Auffanggrundrecht soll dazu dienen, Personengruppen, die durch die speziellen Freiheitsrechte, wie z.B. den Artikel 12 I GG („Deutschen- Grundrecht“), nicht geschützt sind, dennoch Schutz vor unerlaubten staatlichen Eingriffen zu gewährleisten. Sind jedoch besondere wirtschaftliche Freiheitsrechte, wie z.B. Art. 12, 14 und 11 GG relevant, dann tritt die allgemeine Handlungsfreiheit hinter diesen zurück.1
Hinsichtlich des sachlichen Schutzbereichs besagt Artikel 2 I GG, dass bezüglich der wirtschaftlichen Betätigung zum Einen die Vertragsfreiheit gegeben ist. Diese sichert den am Vertrag beteiligten Parteien zu, diesen inhaltlich und formell nach deren Belieben zu gestalten. Zum Anderen umfasst er die Wettbewerbsfreiheit, d.h. das Recht mit anderen Unternehmen in Konkurrenz treten zu können, ohne durch staatliche Einflüsse behindert oder verzerrt zu werden. Weiterhin wird auch die Unternehmer- bzw. die Unternehmensfreiheit mit eingeschlossen. Diese stellt das Recht zur freien Gründung, Führung, Auflösung und Umgestaltung eines Unternehmens sicher, solange es sich nicht um berufsbezogene Regelungen handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die allgemeine Handlungsfreiheit gemäß Artikel 2 I GG
- Schutzbereich
- Eingriffe
- Rechtfertigung von Eingriffen
- Personenfreizügigkeit in Deutschland am Beispiel Auslandsentsendungen von Arbeitnehmern
- Entsendung deutscher Arbeitnehmer in das Ausland
- Die Arbeitnehmerfreizügigkeit
- Vergleich Grundrechte versus Grundfreiheiten
- Die Arbeitnehmerfreizügigkeit gem. Artikel 39 EG-V
- Das Bosman- Urteil
- Die Niederlassungsfreiheit gem. Artikel 43 ff. EG-V
- Der Schutzbereich
- Schranken und Ausnahmen
- Das Centros- Urteil
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Freizügigkeit als Grundfreiheit und der allgemeinen Handlungsfreiheit als Grundrecht, insbesondere im Hinblick auf deren Verhältnis auf europäischer Ebene. Die Arbeit untersucht die jeweilige Reichweite dieser Rechte und analysiert relevante Rechtsprechung, wie beispielsweise das Bosman- und das Centros-Urteil.
- Allgemeine Handlungsfreiheit nach Artikel 2 I GG
- Personenfreizügigkeit im Kontext von Auslandsentsendungen
- Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Vergleich mit Grundrechten
- Niederlassungsfreiheit nach Artikel 43 ff. EG-V
- Der Einfluss der EU-Rechtsprechung auf die Ausgestaltung dieser Freiheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext der Grundrechte im deutschen Grundgesetz, insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung der allgemeinen Handlungsfreiheit und der Freizügigkeit. Sie betont die umfangreiche Literaturlage und die sich durch EU-Erweiterungen verändernden Perspektiven auf Grundfreiheiten.
Die allgemeine Handlungsfreiheit gemäß Artikel 2 I GG: Dieses Kapitel behandelt die allgemeine Handlungsfreiheit als Grundrecht, differenziert zwischen persönlichem und sachlichem Schutzbereich und diskutiert die Schranken der Handlungsfreiheit. Es wird der Schutzbereich des Grundrechts erläutert und der Vorrang spezifischer wirtschaftlicher Freiheitsrechte vor der allgemeinen Handlungsfreiheit behandelt. Die Vertragsfreiheit als Bestandteil der wirtschaftlichen Betätigung innerhalb des Schutzbereichs wird ebenfalls angesprochen.
Personenfreizügigkeit in Deutschland am Beispiel Auslandsentsendungen von Arbeitnehmern: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Personenfreizügigkeit und beleuchtet diese anhand des Beispiels von Auslandsentsendungen von Arbeitnehmern. Es analysiert die rechtlichen Aspekte und Herausforderungen, die mit der Entsendung von deutschen Arbeitnehmern ins Ausland verbunden sind. Details zu den spezifischen Aspekten der Entsendung, etwa den rechtlichen Rahmenbedingungen und den damit verbundenen Rechten und Pflichten, werden im Einzelnen beschrieben.
Die Arbeitnehmerfreizügigkeit: Dieses Kapitel vergleicht Grundrechte und Grundfreiheiten im Kontext der Arbeitnehmerfreizügigkeit, beleuchtet Artikel 39 EG-V und analysiert das einflussreiche Bosman-Urteil. Der Vergleich von Grundrechten und Grundfreiheiten gibt Einblick in die verschiedenen Rechtsgrundlagen und ihren jeweiligen Geltungsbereich. Die Diskussion von Artikel 39 EG-V bietet eine detaillierte Analyse der rechtlichen Bestimmungen. Das Bosman-Urteil wird hinsichtlich seiner Bedeutung für die Arbeitnehmerfreizügigkeit eingeordnet und ausführlich analysiert.
Die Niederlassungsfreiheit gem. Artikel 43 ff. EG-V: Dieses Kapitel untersucht die Niederlassungsfreiheit gemäß Artikel 43 ff. EG-V, einschließlich des Schutzbereichs und der Schranken dieser Freiheit. Es analysiert das Centros-Urteil und seine Bedeutung für die Auslegung der Niederlassungsfreiheit. Die Diskussion des Schutzbereichs beleuchtet, welche Aktivitäten unter die Niederlassungsfreiheit fallen. Die Analyse der Schranken und Ausnahmen beschreibt, unter welchen Bedingungen die Niederlassungsfreiheit eingeschränkt werden kann.
Schlüsselwörter
Allgemeine Handlungsfreiheit, Artikel 2 I GG, Freizügigkeit, Personenfreizügigkeit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Artikel 39 EG-V, Niederlassungsfreiheit, Artikel 43 ff. EG-V, Grundrechte, Grundfreiheiten, EU-Recht, Bosman-Urteil, Centros-Urteil, Auslandsentsendungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Grundrechte und Grundfreiheiten in der Europäischen Union
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit behandelt die Freizügigkeit als Grundfreiheit und die allgemeine Handlungsfreiheit als Grundrecht, insbesondere im Hinblick auf deren Verhältnis auf europäischer Ebene. Sie untersucht die Reichweite dieser Rechte und analysiert relevante Rechtsprechung (Bosman- und Centros-Urteil).
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die allgemeine Handlungsfreiheit nach Artikel 2 I GG, die Personenfreizügigkeit anhand von Auslandsentsendungen, die Arbeitnehmerfreizügigkeit im Vergleich zu Grundrechten, die Niederlassungsfreiheit nach Artikel 43 ff. EG-V und den Einfluss der EU-Rechtsprechung auf diese Freiheiten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zur allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 I GG), Personenfreizügigkeit (Auslandsentsendungen), Arbeitnehmerfreizügigkeit (inkl. Vergleich mit Grundrechten und Analyse des Bosman-Urteils), Niederlassungsfreiheit (Art. 43 ff. EG-V, inkl. Centros-Urteil) und Schlussbemerkungen. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung.
Was ist der Inhalt des Kapitels zur Allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 I GG)?
Dieses Kapitel definiert die allgemeine Handlungsfreiheit als Grundrecht, unterscheidet zwischen persönlichem und sachlichem Schutzbereich, diskutiert Schranken und den Vorrang spezifischer wirtschaftlicher Freiheitsrechte. Die Vertragsfreiheit als Bestandteil der wirtschaftlichen Betätigung wird ebenfalls thematisiert.
Was wird im Kapitel zur Personenfreizügigkeit behandelt?
Das Kapitel konzentriert sich auf die Personenfreizügigkeit am Beispiel von Auslandsentsendungen deutscher Arbeitnehmer. Es analysiert die rechtlichen Aspekte und Herausforderungen, die mit der Entsendung verbunden sind, einschließlich rechtlicher Rahmenbedingungen, Rechte und Pflichten.
Worum geht es im Kapitel zur Arbeitnehmerfreizügigkeit?
Dieses Kapitel vergleicht Grundrechte und Grundfreiheiten im Kontext der Arbeitnehmerfreizügigkeit, analysiert Artikel 39 EG-V und das Bosman-Urteil. Der Vergleich der Rechtsgrundlagen und deren Geltungsbereich wird detailliert dargestellt.
Was ist der Inhalt des Kapitels zur Niederlassungsfreiheit (Art. 43 ff. EG-V)?
Dieses Kapitel untersucht die Niederlassungsfreiheit gemäß Artikel 43 ff. EG-V, inklusive Schutzbereich und Schranken. Das Centros-Urteil und seine Bedeutung für die Auslegung der Niederlassungsfreiheit werden ausführlich analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Allgemeine Handlungsfreiheit, Artikel 2 I GG, Freizügigkeit, Personenfreizügigkeit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Artikel 39 EG-V, Niederlassungsfreiheit, Artikel 43 ff. EG-V, Grundrechte, Grundfreiheiten, EU-Recht, Bosman-Urteil, Centros-Urteil, Auslandsentsendungen.
Welche Rechtsprechungsentscheidungen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert insbesondere das Bosman-Urteil und das Centros-Urteil im Kontext der Arbeitnehmerfreizügigkeit bzw. der Niederlassungsfreiheit.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und alle, die sich mit Grundrechten und Grundfreiheiten im europäischen Recht auseinandersetzen.
- Arbeit zitieren
- Carolin Schmidt (Autor:in), 2009, Freizügigkeit und allgemeine Handlungsfreiheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137430