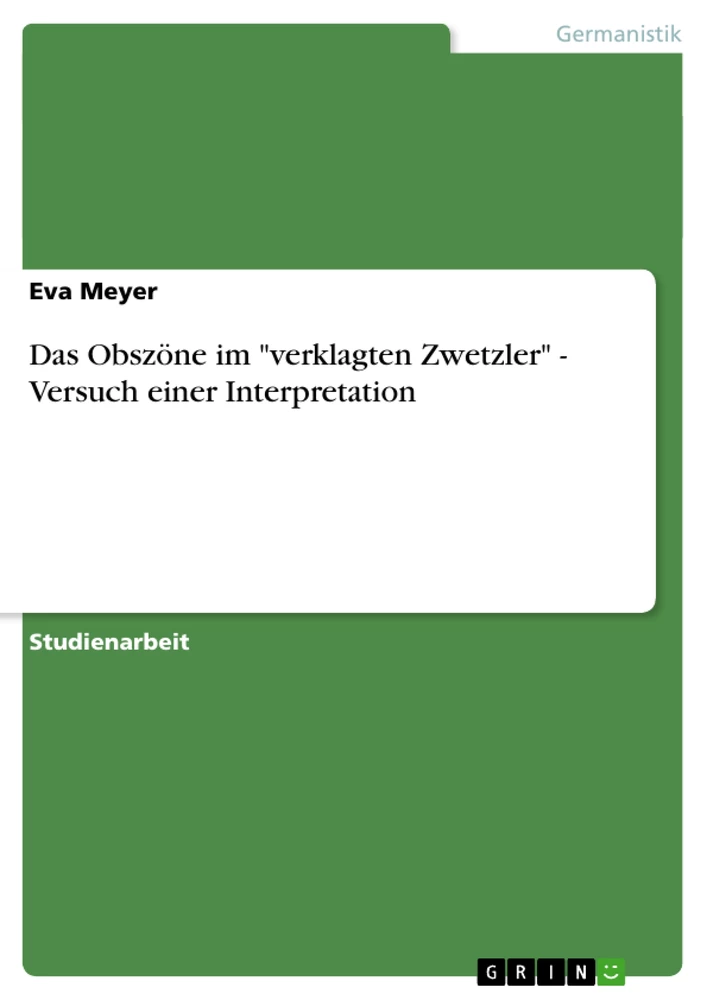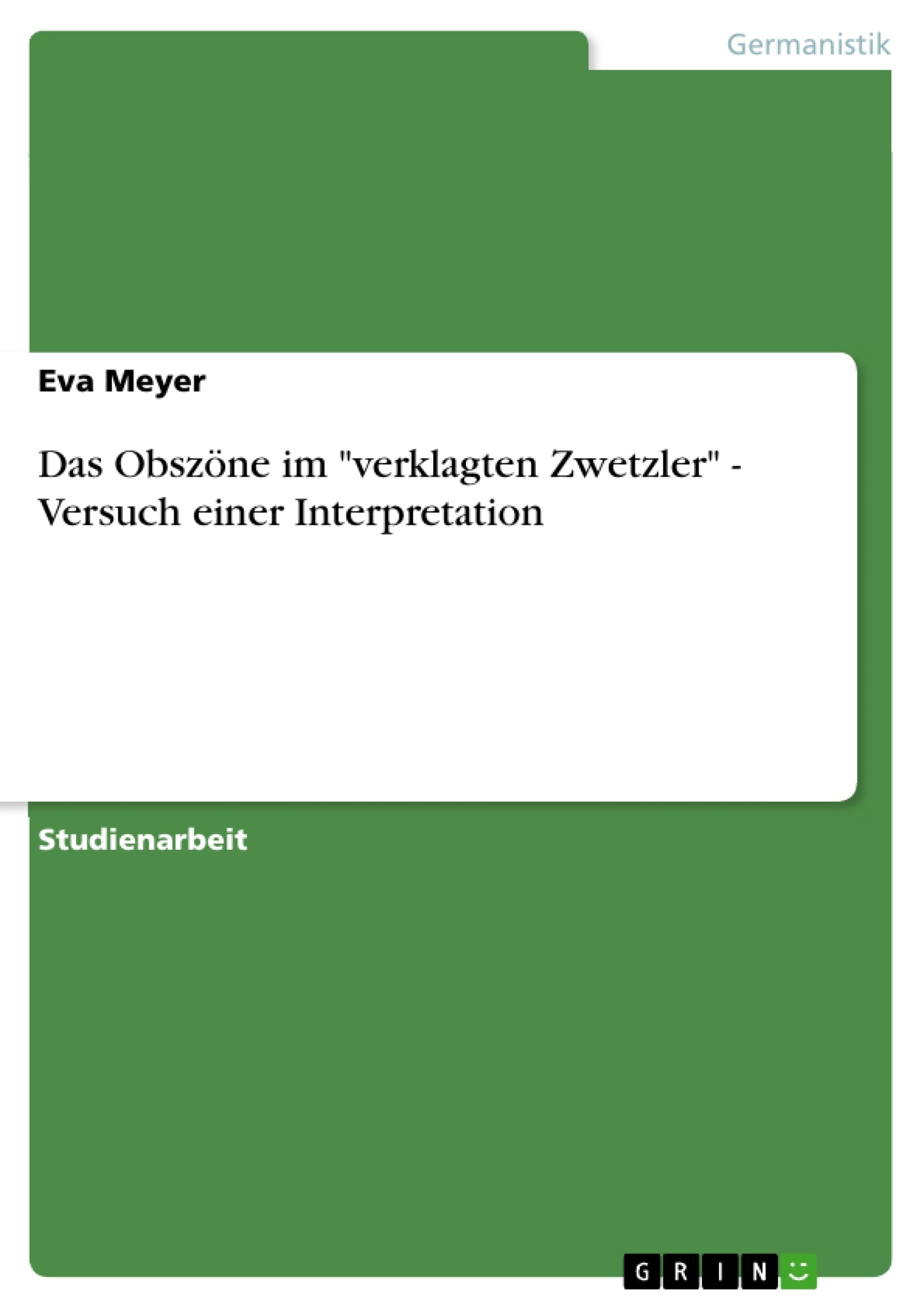1 Einleitung
(...)Am Beispiel der vermutlich um 1200 entstandenen Erzählung „Der verklagte Zwetzler“ sollen diese kontrastären Positionen untersucht, auf ihre Tauglichkeit geprüft und gegebenenfalls widerlegt werden. Ebenso ist es das Ziel dieser Arbeit zu untersuchen, welcher literarischen Gattung der oben genannte Text zugeordnet werden kann bzw. soll sich kritisch mit Hanns Fischers These, dass es sich dabei um eine „Priapeia“ handelt, auseinandergesetzt werden.
Zu Beginn erfolgt hierzu eine Einführung in die Überlieferungsgeschichte des literarischen Werkes sowie die Schilderung des historischen Hintergrunds mit dem Fokus auf die Erotik und Sexualität im Mittelalter. Anschließend wird kurz der Inhalt des „verklagten Zwetzlers“ zusammengefasst, bevor im Hauptteil die Interpretationsarbeit geleistet werden kann. Diese beginnt zunächst mit dem Aufzeigen der komischen Elemente des Textes. Das Hauptaugenmerk der Interpretation liegt allerdings auf der Untersuchung der Obszönität des literarischen Werkes. Bevor das Spiel mit dem Obszönen erkundet werden kann, ist allerdings eine Bestimmung des Obszönitätsbegriffes notwendig, die in Kapitel 5.2 gefunden werden soll. Auch der Frage nach der obszönen weiblichen Stimme im „verklagten Zwetzer“ soll nachgegangen werden.
Die Suche nach der zugehörigen Gattung des Textes, soll im darauffolgenden Kapitel thematisiert werden. Dabei steht die These Hanns Fischers, dass es sich beim „verklagten Zwetzler“ um eine Märe handelt, im Mittelpunkt.Jene Auffassung soll anschließend diskutiert werden, wobei einerseits die Kritikpunkte an Fischers Konzept aufgezeigt werden sollen, andererseits eine eigenständige Einordnung der Erzählung in die Märendiskussion vorgenommen werden. (...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überlieferung und literarische Einordnung
- Der historische Hintergrund: Erotik und Sexualität im Mittelalter
- „Der verklagte Zwetzler“ - Der Inhalt
- Interpretation
- Das Komische im „verklagten Zwetzler“
- „Obszön“- Versuch einer Begriffsklärung
- Das Spiel mit dem Obszönen
- Die Frage nach der „obszönen weiblichen Stimme“
- „Der verklagte Zwetzler“- eine obszöne Märe?
- Der Märenbegriff nach Hanns Fischer
- Kritik an Fischers Märendefinition
- Einordnung des „verklagten Zwetzler“ in die Mären-Diskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erzählung „Der verklagte Zwetzler“, entstanden um 1200, und beleuchtet gegensätzliche Positionen zur mittelalterlichen Obszönität. Es wird geprüft, ob der Text als obszön empfunden wurde und welcher literarischen Gattung er zuzuordnen ist, insbesondere im Hinblick auf Hanns Fischers These einer „Priapeia“. Die Arbeit analysiert die Überlieferung, den historischen Kontext, die komischen Elemente und den Umgang mit Obszönität im Text.
- Die Definition und Darstellung von Obszönität im Mittelalter
- Die literarische Einordnung des „verklagten Zwetzlers“
- Die Rolle des Komischen in der Erzählung
- Die Analyse der erotischen Elemente und deren Kontextualisierung
- Die Bewertung der These, dass es sich um eine Märe handelt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die gegensätzlichen Auffassungen von Siciliano und Nykrog zur mittelalterlichen Obszönität dar und benennt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung dieser Positionen anhand des „verklagten Zwetzlers“, die Klärung seiner literarischen Gattung und die kritische Auseinandersetzung mit Hanns Fischers These. Der methodische Ansatz wird skizziert, der die Überlieferungsgeschichte, den historischen Hintergrund, den Inhalt und eine detaillierte Interpretation umfasst, mit dem Schwerpunkt auf der Obszönität und der Gattungszuordnung.
Überlieferung und literarische Einordnung: Dieses Kapitel beschreibt die Überlieferung des „verklagten Zwetzlers“ in den Handschriften We, k und N¹, datiert auf das 14. und 15. Jahrhundert. Es werden die unterschiedlichen Fassungen und ihre Veröffentlichungen durch Keller und Fischer diskutiert, wobei die Unterschiede zwischen den Fassungen in Bezug auf erotische Details und den Minneteil herausgestellt werden. Die enge inhaltliche Beziehung zu anderen Texten in der Karlsruher Handschrift wird erwähnt, und es wird die Entscheidung begründet, sich auf die umfangreichere Fassung I in Handschrift k zu konzentrieren. Die Dreiteilung des Textes nach Gerhard Wolf (Minne, erotische Naivität, Wandlung der Frau) wird kurz angerissen.
Der historische Hintergrund: Erotik und Sexualität im Mittelalter: Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf Erotik und Sexualität im Mittelalter. Es konfrontiert die romantisierende Sicht mit der Realität eines ambivalenten Verhältnisses zur Sexualität, geprägt von der kirchlichen Moral, aber auch von einer in der Praxis oftmals freizügigeren Lebensweise. Die Rolle der Kirche und ihre restriktiven Regeln werden ebenso thematisiert wie der unterschiedliche Umgang mit Sexualität in den verschiedenen sozialen Schichten. Die Bedeutung von Badehäusern und Prostitution als Indikatoren für die gesellschaftliche Offenheit gegenüber sexuellen Themen wird hervorgehoben. Das Kapitel schlussfolgert, dass die Einstellung zur Sexualität im Mittelalter komplex war und weder extrem obszön noch extrem frigide.
„Der verklagte Zwetzler“ - Der Inhalt: Dieses Kapitel gibt eine knappe Inhaltsangabe der Erzählung „Der verklagte Zwetzler I“ aus der Karlsruher Handschrift wieder. Es beginnt mit der Einleitung des Erzählers, beschreibt das Treffen des Knaben und des Mädchens, deren Gespräch über den „Zwetzler“ und das anschließende Geschehen. Es betont, dass der Titel „Der verklagte Zwetzler“ keine direkte Übersetzung des mittelhochdeutschen Titels ist.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Literatur, „Der verklagte Zwetzler“, Obszönität, Erotik, Sexualität, Märe, Hanns Fischer, Komik, Gattungszuordnung, mittelhochdeutsche Literatur, Interpretationsansätze.
Häufig gestellte Fragen zu „Der verklagte Zwetzler“
Was ist der Inhalt des Textes und welche Themen werden behandelt?
„Der verklagte Zwetzler“, eine um 1200 entstandene Erzählung, behandelt die Themen Obszönität, Erotik und Sexualität im Mittelalter. Der Text erzählt die Geschichte eines Mädchens und eines Knaben und ihre Auseinandersetzung mit einem „Zwetzler“. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Auffassungen zur mittelalterlichen Obszönität und beleuchtet die Frage, ob der Text als obszön empfunden wurde und welcher literarischen Gattung er zuzuordnen ist. Schwerpunkte sind die Überlieferung, der historische Kontext, die komischen Elemente und der Umgang mit Obszönität im Text.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht gegensätzliche Positionen zur mittelalterlichen Obszönität anhand des „verklagten Zwetzlers“. Sie prüft, ob der Text als obszön empfunden wurde und welcher literarischen Gattung er zuzuordnen ist, insbesondere im Hinblick auf Hanns Fischers These einer „Priapeia“. Die Analyse umfasst die Überlieferung, den historischen Kontext, die komischen Elemente und den Umgang mit Obszönität im Text.
Wie ist der Text in der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Überlieferung und literarischer Einordnung, historischem Hintergrund (Erotik und Sexualität im Mittelalter), Inhaltsangabe des „verklagten Zwetzlers“, Interpretation (einschließlich Komik und Obszönität), Einordnung als Märe (mit Bezug auf Hanns Fischer) und Fazit. Die Kapitel fassen die Überlieferungsgeschichte, den historischen Kontext, den Inhalt und eine detaillierte Interpretation zusammen, mit dem Schwerpunkt auf der Obszönität und der Gattungszuordnung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Mittelalterliche Literatur, „Der verklagte Zwetzler“, Obszönität, Erotik, Sexualität, Märe, Hanns Fischer, Komik, Gattungszuordnung, mittelhochdeutsche Literatur, Interpretationsansätze.
Wie wird die Überlieferung des Textes behandelt?
Die Arbeit beschreibt die Überlieferung des „verklagten Zwetzlers“ in den Handschriften We, k und N¹, datiert auf das 14. und 15. Jahrhundert. Es werden die unterschiedlichen Fassungen und ihre Veröffentlichungen durch Keller und Fischer diskutiert, mit Fokus auf Unterschiede in erotischen Details und dem Minneteil. Die enge inhaltliche Beziehung zu anderen Texten in der Karlsruher Handschrift wird erwähnt, und die Entscheidung, sich auf die umfangreichere Fassung I in Handschrift k zu konzentrieren, wird begründet.
Wie wird der historische Kontext beleuchtet?
Das Kapitel zum historischen Kontext beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf Erotik und Sexualität im Mittelalter. Es konfrontiert die romantisierende Sicht mit der Realität eines ambivalenten Verhältnisses zur Sexualität, geprägt von kirchlicher Moral, aber auch von einer in der Praxis oftmals freizügigeren Lebensweise. Die Rolle der Kirche, der Umgang mit Sexualität in verschiedenen sozialen Schichten und die Bedeutung von Badehäusern und Prostitution werden thematisiert. Das Kapitel schlussfolgert, dass die Einstellung zur Sexualität im Mittelalter komplex war.
Welche Rolle spielt Hanns Fischer in der Arbeit?
Hanns Fischers These einer „Priapeia“ im Zusammenhang mit dem „verklagten Zwetzler“ ist ein zentraler Punkt der Arbeit. Die Arbeit analysiert kritisch Fischers Märendefinition und diskutiert die Einordnung des „verklagten Zwetzlers“ in die Mären-Diskussion. Die Arbeit setzt sich mit Fischers Interpretation auseinander und bewertet seine These kritisch.
Wie wird die Frage der Obszönität behandelt?
Die Arbeit untersucht die Definition und Darstellung von Obszönität im Mittelalter und analysiert, ob und wie der „verklagte Zwetzler“ als obszön empfunden werden konnte. Sie beleuchtet die komischen Elemente des Textes und deren Beziehung zur Obszönität und diskutiert den Umgang mit Obszönität im Text selbst. Die „obszöne weibliche Stimme“ wird als ein besonderes Thema untersucht.
- Arbeit zitieren
- Eva Meyer (Autor:in), 2009, Das Obszöne im "verklagten Zwetzler" - Versuch einer Interpretation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/137426