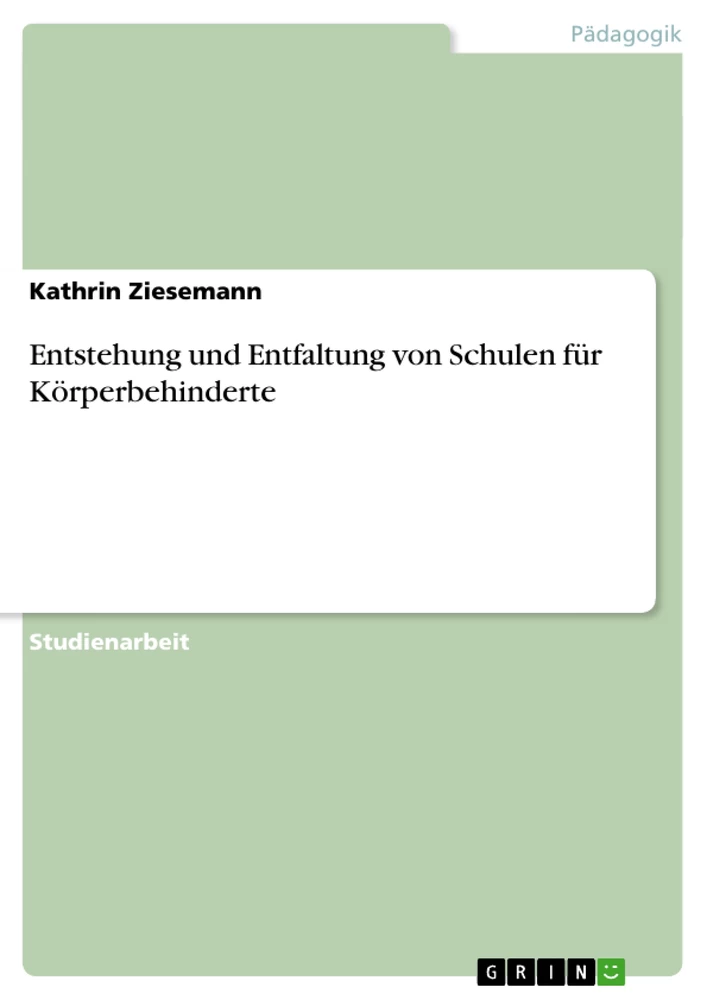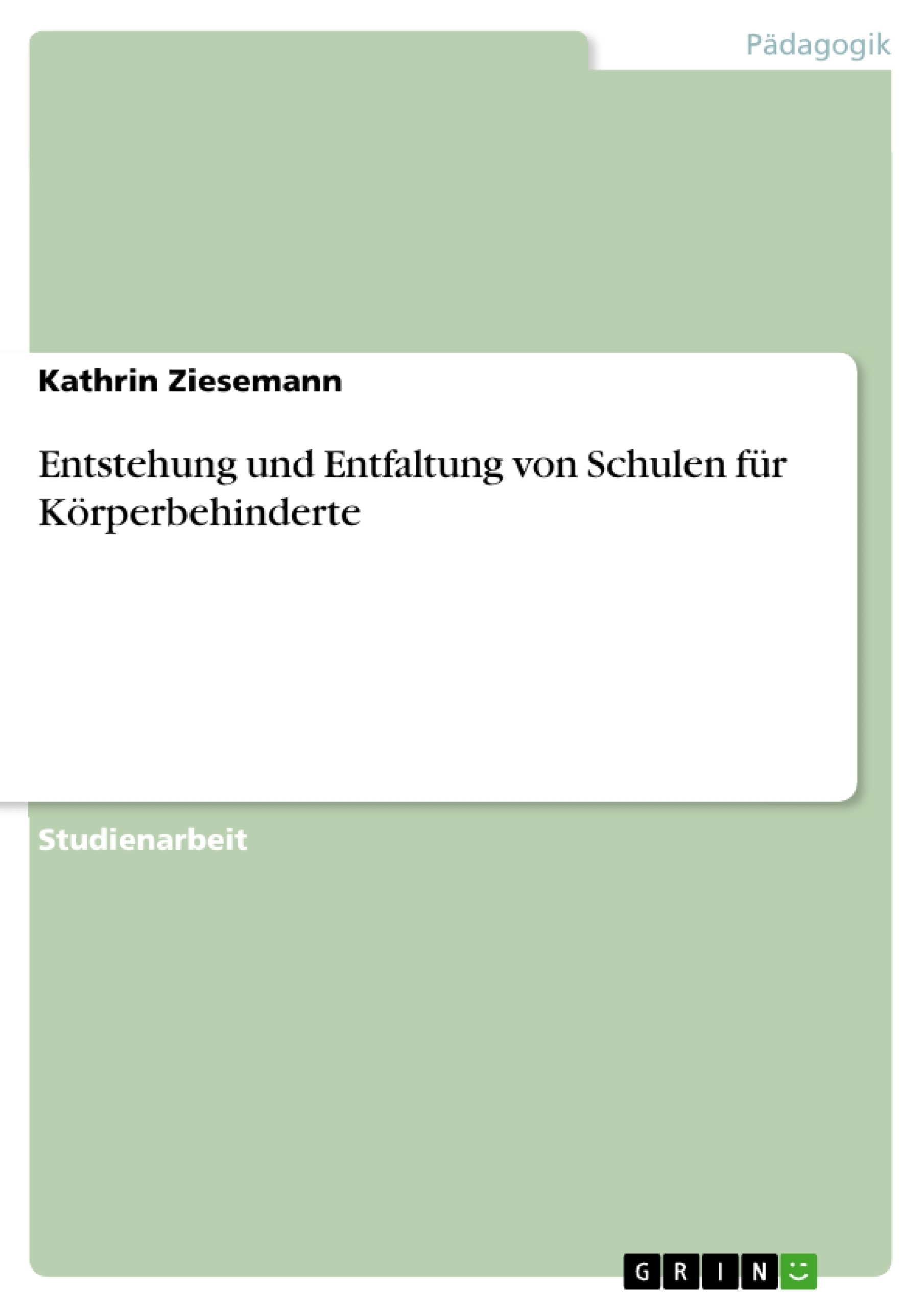Der Begriff des „Körperbehinderten“ begegnet uns erstmals im Jahre 1925, um den mit negativen
Vorurteilen besetzten Terminus „Krüppel“ abzulösen. Das Wort „Krüppel“ stammt von dem Wort
„crupel“ ab, das im 11. Jahrhundert am Mittelrhein zur Beschreibung körperlich Behinderter entstand.
Bereits um 1500 wurde der Begriff des Krüppels mit dem eines Minderwertigen gleichgesetzt.
Laut des Deutschen Wörterbuches der Gebrüder Grimm aus dem Jahre 1873 war ein Krüppel ein
Mensch mit „gekrümmten, verwachsenen oder gelähmten Gliedern“.
Dietrich referierte 1908:
„Ein Krüppel ist ein körperlich Gebrechlicher oder wie Biesalski auf dem Orthopädenkongreß
1908 unter allgemeiner Zustimmung erklärte, >ein infolge eines angeborenen oder erworbenen
Nerven- oder Knochen- und Gelenkleidens in dem Gebrauch seines Rumpfes oder seiner Gliedmaßen
behinderter Kranker<.“
Da die Behinderten und deren Angehörige sich dem Begriff des Krüppels widersetzten, wurde nach
einem anderen Terminus zur Beschreibung Körperbehinderter gesucht. Vorschläge waren „Gebrechlicher“,
„Knochen- und Gliederkranker“, „orthopädisch Kranker“, „Gelähmter“, „Brestling“
und „Hilfling“. Trotz aller Bemühungen fand man jedoch keinen anderen Terminus, welcher den
Menschen mit einer Körperbehinderung besser hätte bezeichnen können als der Begriff „Krüppel“.
Nach Ende des Ersten Weltkrieges, als die Behinderten selbst das Wort ergriffen, tauchte der Begriff
des „Körperbehinderten“ auf. Jedoch wurde der Terminus des Krüppels in der Wissenschaft und
der breiten Öffentlichkeit bewußt weiter verwendet:
„Stoße sich niemand an dem Wort >Krüppel<; die Fachleute haben sich vergeblich bemüht, einen
Ersatz zu finden. >Kriegsbeschädigt< klingt besser, aber es deckt nicht den Begriff, den man meint;
denn auch ein Mann, der ein Auge oder sein Gehör verloren oder sich ein dauerndes inneres Leiden
zugezogen hat, ist beschädigt und doch nicht verkrüppelt. Hierunter versteht man eine schwere
Beeinträchtigung der Bewegungsmöglichkeiten und der Körperhaltung. Es gibt nur ein Mittel, über
dieses Wort hinwegzukommen, nämlich umzulernen und nicht unter einem Krüppel ein abschreckendes
Jammerbild zu verstehen.“ (Biesalski 1915). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Zur Geschichte des Sprachgebrauchs der Begriffe „Krüppel“ und „Körperbehinderter“
- Historischer Rückblick der Einstellung gegenüber Körperbehinderten
- Das Altertum
- Der Einfluß des Christentums bis zur Epoche der Aufklärung
- Erste Ansätze der Erziehung und Beschulung Körperbehinderter
- Der Beitrag der Orthopädie in der Neuzeit
- Die Entwicklung der Körperbehindertenpädagogik und der Schule für Körperbehinderte
- Berufswahl und berufliche Eingliederung Körperbehinderter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung von Schulen für körperbehinderte Menschen, mit einem Schwerpunkt auf der Neuzeit. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Körperbehinderung und den damit verbundenen Herausforderungen in der Erziehung und Bildung.
- Wandel des Sprachgebrauchs bezüglich Körperbehinderung (von „Krüppel“ zu „Körperbehinderter“)
- Historische Einstellungen gegenüber Körperbehinderten in verschiedenen Epochen
- Entwicklung erster Ansätze der Erziehung und Beschulung
- Einfluss der Orthopädie auf die Entwicklung von Schulen
- Entwicklung der Körperbehindertenpädagogik und der spezifischen Schulformen
Zusammenfassung der Kapitel
Zur Geschichte des Sprachgebrauchs der Begriffe „Krüppel“ und „Körperbehinderter“: Dieses Kapitel analysiert die semantische Entwicklung der Begriffe „Krüppel“ und „Körperbehinderter“. Es zeigt den negativen Beigeschmack des Begriffs „Krüppel“ auf, der im Laufe der Zeit mit Minderwertigkeit gleichgesetzt wurde. Die Suche nach einem adäquaten Ersatzbegriff wird beleuchtet, wobei die Schwierigkeiten bei der Findung eines neutralen und akzeptierten Terminus hervorgehoben werden. Die endgültige Akzeptanz des Begriffs „Körperbehinderter“ nach dem Zweiten Weltkrieg wird als Meilenstein der gesellschaftlichen Entwicklung dargestellt, verbunden mit der gesetzlichen Definition des Begriffs in den 1950er und 1970er Jahren.
Historischer Rückblick der Einstellung gegenüber Körperbehinderten: Der Rückblick auf die Geschichte der Einstellungen gegenüber Körperbehinderten beginnt mit dem babylonischen Codex Hammurabi, der die Tötung missgebildeter Kinder erlaubte. Im alten Ägypten wird eine gespaltene Haltung gezeigt: neben staatlicher Fürsorge existierte die Praxis der Tötung von Schwächlingen. Das Kapitel legt den Fokus auf den Wandel der gesellschaftlichen Sichtweise im Laufe der Geschichte, angefangen vom Ausschluss und der Ausgrenzung bis hin zu ersten Ansätzen der Fürsorge und Integration. Die Rolle des Christentums und der Aufklärung wird in der weiteren Entwicklung dieses gesellschaftlichen Wandels beleuchtet.
Erste Ansätze der Erziehung und Beschulung Körperbehinderter: Dieses Kapitel befasst sich mit den frühen Bemühungen um die Erziehung und Beschulung körperbehinderter Menschen. Es beschreibt die Anfänge der Entwicklung von pädagogischen Konzepten und entsprechenden Einrichtungen. Die Herausforderungen und Schwierigkeiten in diesem Bereich werden analysiert. Das Kapitel bildet eine Brücke zu den späteren Entwicklungen im Bereich der Körperbehindertenpädagogik und der Etablierung von spezialisierten Schulen.
Der Beitrag der Orthopädie in der Neuzeit: Das Kapitel beleuchtet den Einfluss der Orthopädie auf die Entwicklung der Betreuung und Bildung körperbehinderter Menschen. Es zeigt die Entwicklung orthopädischer Methoden und ihre Auswirkungen auf die Rehabilitation und Integration von Betroffenen. Die Bedeutung der Orthopädie für die Verbesserung der Lebensqualität und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird hervorgehoben.
Die Entwicklung der Körperbehindertenpädagogik und der Schule für Körperbehinderte: Dieser Abschnitt beschreibt die Entstehung und Entwicklung der Körperbehindertenpädagogik als eigenständiges Fachgebiet. Die Gründung und Entwicklung von Schulen für körperbehinderte Kinder wird detailliert behandelt. Der Text analysiert die Herausforderungen, die mit der Etablierung dieser Schulformen verbunden waren, sowie die Entwicklung verschiedener pädagogischer Ansätze und Konzepte. Die Kapitel beschreibt den langen Weg von der Ausgrenzung zur Integration und Teilhabe.
Berufswahl und berufliche Eingliederung Körperbehinderter: Das Kapitel befasst sich mit den Aspekten der Berufswahl und beruflichen Eingliederung körperbehinderter Menschen. Es untersucht die historischen Entwicklungen und Herausforderungen bei der Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten und der Integration in den Arbeitsmarkt. Hier wird die Bedeutung von geeigneten Ausbildungswegen und Unterstützungsprogrammen für eine erfolgreiche berufliche Integration hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Körperbehinderung, Krüppel, Körperbehindertenpädagogik, Inklusion, Exklusion, Geschichte der Behindertenpädagogik, Orthopädie, gesellschaftliche Wahrnehmung, Schulentwicklung, Berufsbildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Geschichte der Schulen für Körperbehinderte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung von Schulen für körperbehinderte Menschen, insbesondere in der Neuzeit. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Körperbehinderung und die damit verbundenen Herausforderungen in der Erziehung und Bildung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel des Sprachgebrauchs (von „Krüppel“ zu „Körperbehinderter“), historische Einstellungen gegenüber Körperbehinderten in verschiedenen Epochen, die Entwicklung erster Ansätze der Erziehung und Beschulung, den Einfluss der Orthopädie auf die Entwicklung von Schulen, die Entwicklung der Körperbehindertenpädagogik und spezifischer Schulformen sowie die Berufswahl und berufliche Eingliederung Körperbehinderter.
Wie wird der Wandel des Sprachgebrauchs beschrieben?
Das Kapitel analysiert die semantische Entwicklung der Begriffe „Krüppel“ und „Körperbehinderter“, den negativen Beigeschmack von „Krüppel“ und die Schwierigkeiten bei der Findung eines neutralen Ersatzbegriffs. Die Akzeptanz von „Körperbehinderter“ nach dem Zweiten Weltkrieg und die gesetzliche Definition in den 1950er und 1970er Jahren werden als Meilenstein dargestellt.
Wie werden historische Einstellungen gegenüber Körperbehinderten dargestellt?
Der Rückblick beginnt mit dem babylonischen Codex Hammurabi und zeigt eine gespaltene Haltung im alten Ägypten (staatliche Fürsorge neben Tötung von Schwächlingen). Der Fokus liegt auf dem Wandel von Ausschluss und Ausgrenzung zu Fürsorge und Integration, wobei die Rolle des Christentums und der Aufklärung beleuchtet wird.
Was wird über die ersten Ansätze der Erziehung und Beschulung gesagt?
Dieses Kapitel beschreibt die frühen Bemühungen um die Erziehung und Beschulung körperbehinderter Menschen, die Entwicklung pädagogischer Konzepte und Einrichtungen sowie die damit verbundenen Herausforderungen. Es bildet eine Brücke zu späteren Entwicklungen in der Körperbehindertenpädagogik und der Etablierung spezialisierter Schulen.
Welche Rolle spielt die Orthopädie?
Das Kapitel beleuchtet den Einfluss der Orthopädie auf die Betreuung und Bildung körperbehinderter Menschen, die Entwicklung orthopädischer Methoden und deren Auswirkungen auf Rehabilitation und Integration. Die Bedeutung der Orthopädie für die Verbesserung der Lebensqualität und Teilhabe wird hervorgehoben.
Wie wird die Entwicklung der Körperbehindertenpädagogik und der Schulen beschrieben?
Dieser Abschnitt beschreibt die Entstehung und Entwicklung der Körperbehindertenpädagogik als eigenständiges Fachgebiet, die Gründung und Entwicklung von Schulen für körperbehinderte Kinder und die Herausforderungen bei der Etablierung dieser Schulformen. Verschiedene pädagogische Ansätze und der Weg von der Ausgrenzung zur Integration werden analysiert.
Was wird zur Berufswahl und beruflichen Eingliederung gesagt?
Das Kapitel befasst sich mit den Aspekten der Berufswahl und beruflichen Eingliederung körperbehinderter Menschen, untersucht historische Entwicklungen und Herausforderungen bei der Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten und Integration in den Arbeitsmarkt und betont die Bedeutung von Ausbildungswegen und Unterstützungsprogrammen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Körperbehinderung, Krüppel, Körperbehindertenpädagogik, Inklusion, Exklusion, Geschichte der Behindertenpädagogik, Orthopädie, gesellschaftliche Wahrnehmung, Schulentwicklung, Berufsbildung.
- Quote paper
- Kathrin Ziesemann (Author), 2000, Entstehung und Entfaltung von Schulen für Körperbehinderte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13740