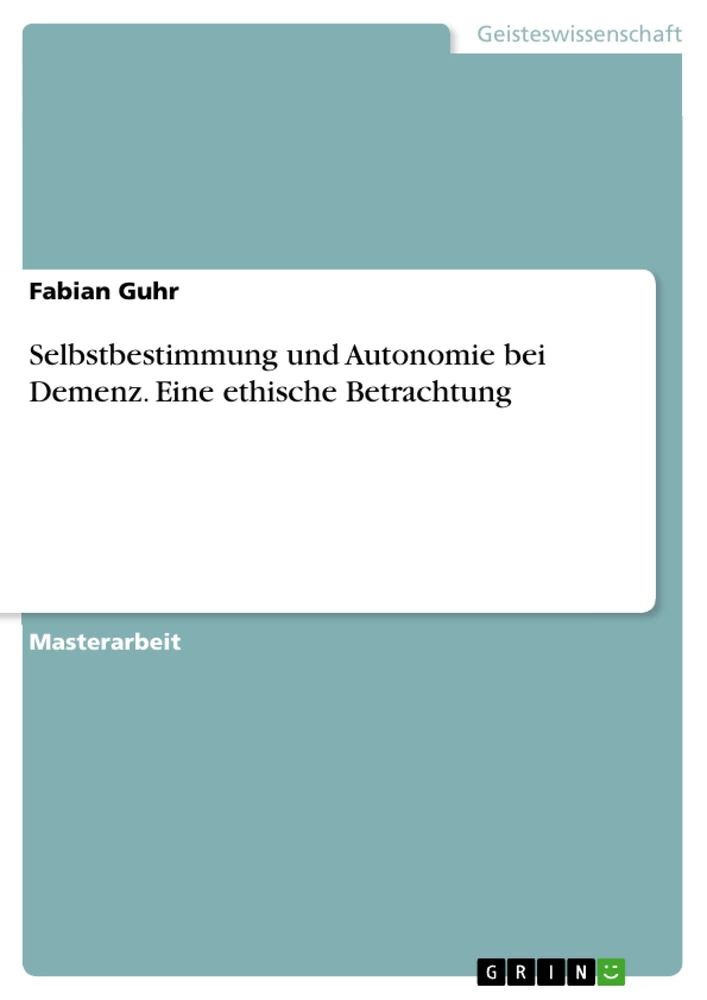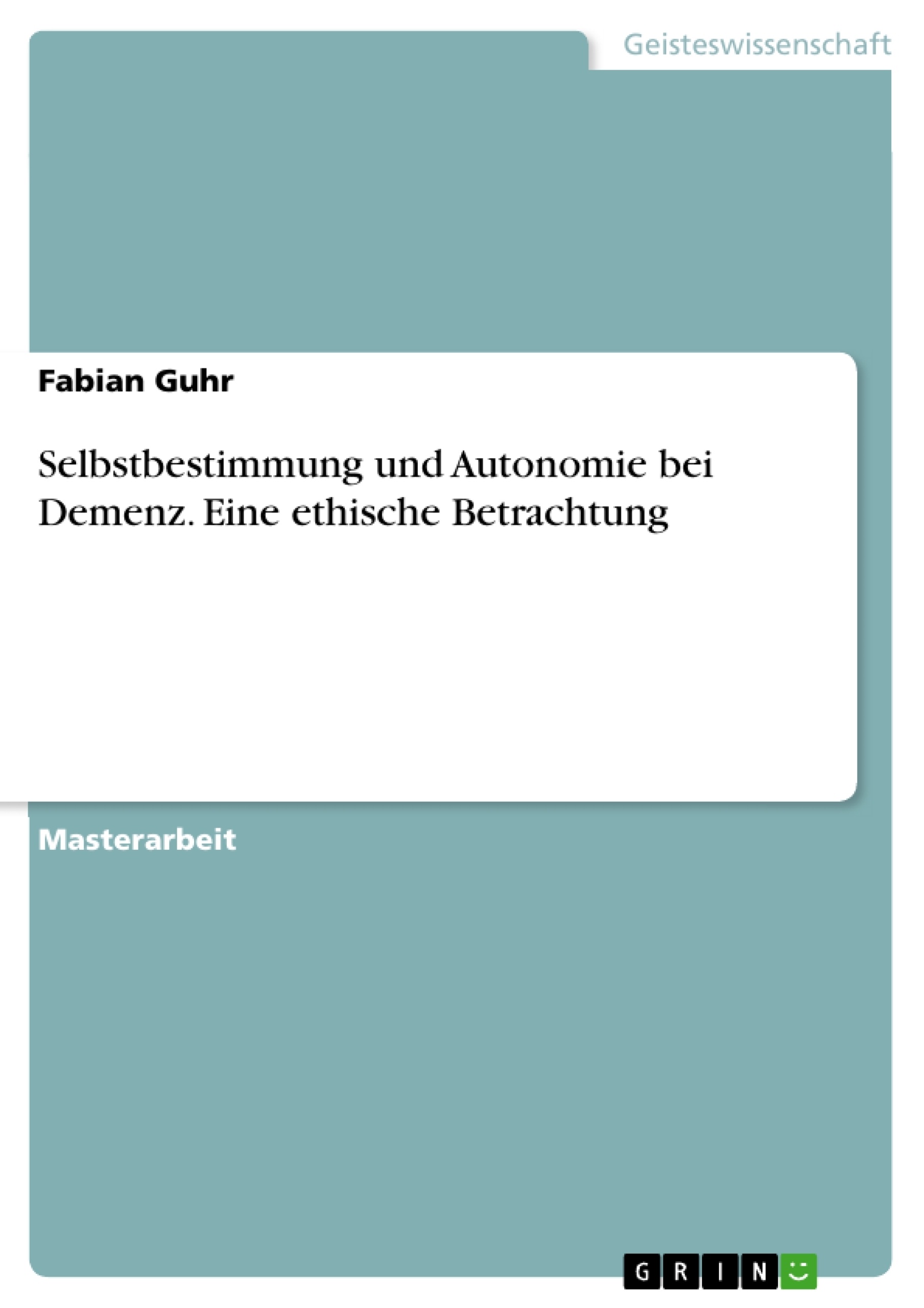Diese Arbeit befasst sich mit der zunehmenden Prävalenz von Demenzerkrankungen in unserer Gesellschaft und den ethischen Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Im Fokus stehen dabei die Fragen der Selbstbestimmung und Autonomie von Demenzerkrankten in Bezug auf ihre Beteiligung an der Forschung und die Pflege. Ziel ist es, die bestehende Spannung zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung zu diskutieren und zu analysieren, wie ethisches Handeln in diesem Kontext aussehen kann.
In der heutigen Gesellschaft scheint es ein Ziel zu sein, möglichst selbstbestimmt zu leben und sich selbst zu verwirklichen. Landläufig wird dies vor allem mit der Möglichkeit (mehr oder weniger) autonom entscheiden und handeln zu können verbunden.3 Auf den ersten Blick scheinen sich jedoch Selbstbestimmung und Demenz gegenseitig auszuschließen. Ob dies tatsächlich so ist, oder ob es möglich ist die Selbstbestimmung der Erkrankten ein Stück weit zu wahren, soll an zwei Beispielfeldern diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Demenz?
- 2.1. Demenzen allgemein
- 2.2. Leichte kognitive Beeinträchtigungen
- 2.3. Alzheimer-Demenz
- 2.3.1. Ursachen
- 2.3.2. Frühe Phase
- 2.3.3. Mittlere Phase
- 2.3.4. Späte Phase
- 2.3.5. Präsenile Alzheimer-Demenz
- 2.4. Vaskuläre Demenzen
- 2.5. Frontotemporale Demenzen
- 2.6. Andere Demenzen
- 2.7. Diagnose von Demenzerkrankungen
- 2.8. Vorsorge und Behandlung von Demenzerkrankungen
- 3. Forschung mit Demenzkranken
- 3.1. Allgemeine berufsethische Grundlagen für Studiendesigns
- 3.2. Therapeutische und nicht-therapeutische Forschung
- 3.3. Forschung mit nicht-einwilligungsfähigen Patient*innen
- 3.4. Selbstbestimmte Zustimmung
- 3.4.1. Informed Consent
- 3.4.1.1. Informed Consent allgemein
- 3.4.1.2. Informed Consent und Demenz
- 3.4.2. Advance Directives
- 3.4.2.1. Advance Directives allgemein
- 3.4.2.2. Begrenzte Vorstellbarkeit und Konkretheit
- 3.4.2.3. Personelle Kontinuität der Patient*innen
- 3.4.2.4. Zwischenfazit
- 3.4.3. Stellvertretende Zustimmung
- 3.5. Nicht-Schadens-Prinzip und Nutzen-Risiko-Analyse
- 3.6. Ethische Bewertung der Forschung mit Demenzkranken
- 4. Umgang mit Unruhe
- 4.1. Unruhe
- 4.2. Selbstbestimmung allgemein
- 4.3. Selbstbestimmung in der Pflege
- 4.4. Umgang mit Unruhe
- 4.4.1. Freiheitsentziehende Maßnahmen und Medikamente
- 4.4.2. Fiktive Realitäten
- 4.5. Selbstbestimmung oder Fürsorge?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Demenz. Die zentrale Fragestellung dabei lautet: Wie kann die Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz in verschiedenen Situationen gewahrt werden, insbesondere im Kontext von Forschung und Pflege?
- Ethische Aspekte von Forschung mit Demenzkranken
- Herausforderungen des Informed Consent bei Demenzpatient*innen
- Das Konzept der Advance Directives und ihre Relevanz im Umgang mit Demenz
- Selbstbestimmung in der Pflege von Demenzkranken
- Das Abwägen von Selbstbestimmung und Fürsorge im Kontext von Unruhe bei Demenzpatient*innen
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel werden die verschiedenen Formen von Demenz sowie die Prozesse der Diagnose und Behandlung erläutert. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit ethischen Aspekten der Forschung mit Demenzkranken und den Herausforderungen des Informed Consent. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Umgang mit nicht-einwilligungsfähigen Patient*innen und der Rolle von Advance Directives. Das dritte Kapitel widmet sich der Frage, wie mit Unruhe bei Demenzpatient*innen umgegangen werden kann und wie die Selbstbestimmung der Betroffenen trotz ihres veränderten Zustands gewahrt werden kann.
Schlüsselwörter
Demenz, Alzheimer-Demenz, Selbstbestimmung, Forschung, Informed Consent, Advance Directives, Pflege, Unruhe, Ethik, Fürsorge, Patient*innenrechte.
Häufig gestellte Fragen
Schließen sich Demenz und Selbstbestimmung gegenseitig aus?
Nein, die Arbeit diskutiert, wie durch geeignete Konzepte die Autonomie von Demenzkranken so weit wie möglich gewahrt werden kann.
Was ist "Informed Consent" bei Demenzpatienten?
Es bezeichnet die informierte Zustimmung zu medizinischen Maßnahmen oder Forschung, die bei Demenz aufgrund eingeschränkter Einwilligungsfähigkeit besondere ethische Hürden aufwirft.
Welche Rolle spielen Patientenverfügungen (Advance Directives)?
Sie ermöglichen es Personen, im Voraus festzulegen, wie sie in späteren Phasen der Demenz behandelt werden möchten, stoßen aber an Grenzen bei der Vorstellbarkeit der Situation.
Wie sollte mit Unruhe bei Demenzkranken umgegangen werden?
Ethisch kritisch diskutiert werden freiheitsentziehende Maßnahmen und Medikamente im Vergleich zu nicht-invasiven Ansätzen, die die Selbstbestimmung achten.
Was bedeutet "stellvertretende Zustimmung"?
Wenn ein Patient nicht mehr einwilligungsfähig ist, entscheiden rechtliche Vertreter auf Basis des mutmaßlichen Willens des Erkrankten.
- Citar trabajo
- Fabian Guhr (Autor), 2018, Selbstbestimmung und Autonomie bei Demenz. Eine ethische Betrachtung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1371510