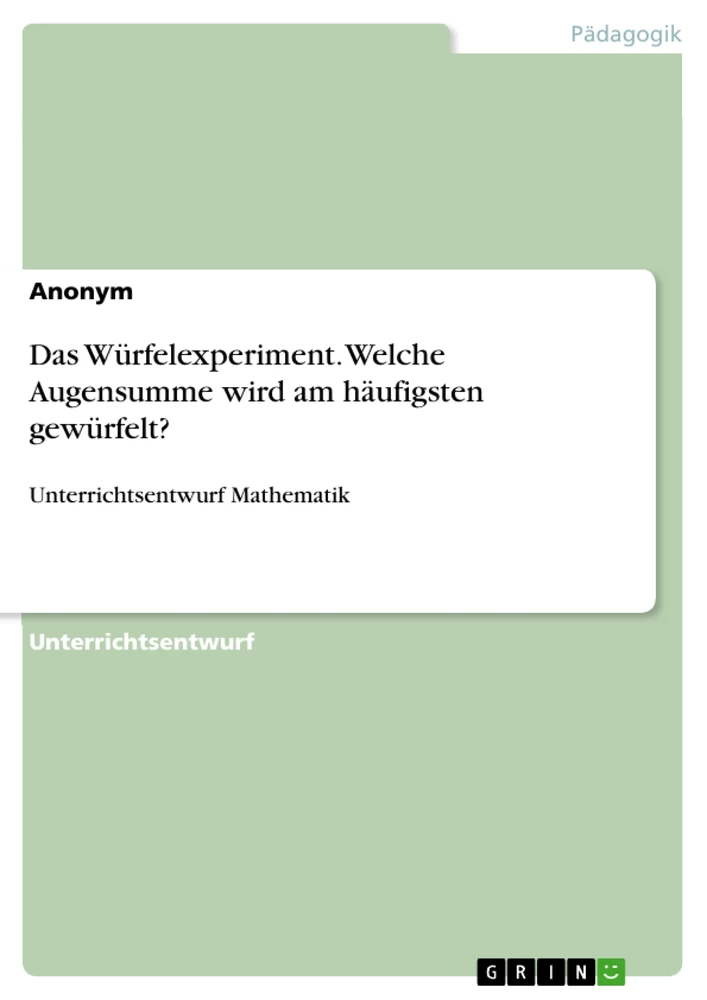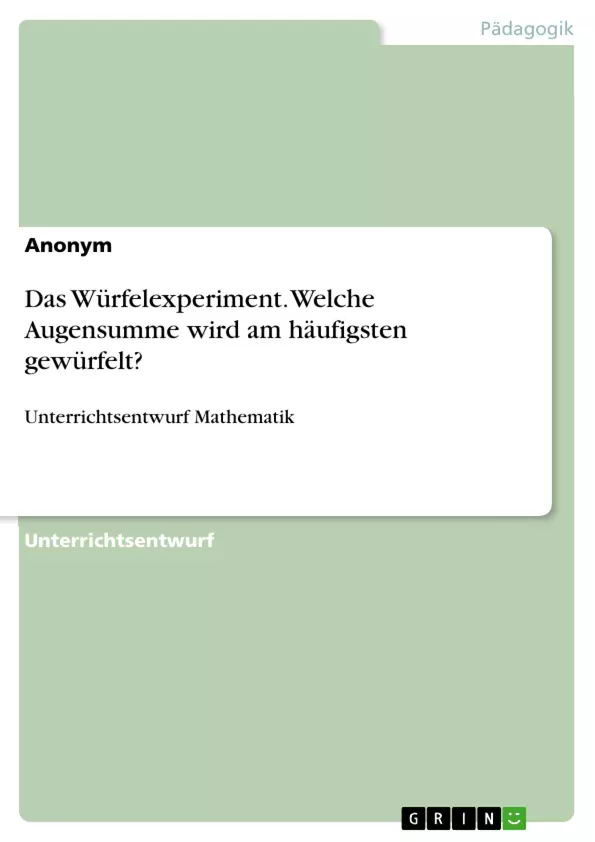Durch diese Unterrichteinheit sollen Schüler:innen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der Stochastik entwickeln und erweitern, indem sie mithilfe eingeführter mathematischer Techniken kombinatorische Fragestellungen lösen. Ferner lernen sie Daten darzustellen, zu erfassen und zu interpretieren.
Insgesamt sind sie durch das Auseinandersetzen mit und Lösen von alltagsbezogenen Vorgängen und Ereignissen zunehmend in der Lage, diese nicht per se auf Glück und Zufall zurückzuführen, sondern sie durch mathematische Überlegungen und Handlungsweisen realistisch einzuschätzen, wodurch sie die Modellierungskompetenz erlangen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Allgemeine Informationen zu der Revisionsprüfung
- 1. Thema und Lernschwerpunkt der Unterrichtsreihe
- 2. Einbettung der Unterrichtsstunde in die Unterrichtsreihe
- 3. Problemstellung, LSP und Anforderungsbereiche der Unterrichtsstunde
- 4. Lehr- und Arbeitsplanbezug
- 5. Sachanalyse
- 6. Didaktisch-methodische Überlegungen zu einzelnen Stundenaspekten
- 7. Tabellarischer Unterrichtsverlauf
- 8. Literatur-, Quellenverzeichnis und Abkürzungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Unterrichtsstunde liegt im Üben und Vertiefen stochastischer Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Bereich Statistik und Wahrscheinlichkeit. Die Schüler sollen ihre prozessbezogenen Kompetenzen im Darstellen, Kommunizieren und Argumentieren verbessern, indem sie die Häufigkeitsverteilung von Augensummen beim Werfen zweier Würfel erarbeiten.
- Kombinatorik und Stochastik
- Datenanalyse und -darstellung
- Wahrscheinlichkeit und Häufigkeitsverteilung
- Anwendung mathematischer Methoden zur Problemlösung
- Entwicklung von Modellierungskompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Thema und Lernschwerpunkt der Unterrichtsreihe: Dieses Kapitel beschreibt das Thema der Unterrichtsreihe "Kombinatorik, Daten und Diagramme" und den Lernschwerpunkt, der auf der Entwicklung und Erweiterung von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der Stochastik liegt. Die Schüler sollen lernen, kombinatorische Fragestellungen zu lösen, Daten darzustellen, zu erfassen und zu interpretieren, sowie alltagsbezogene Vorgänge und Ereignisse realistisch einzuschätzen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Modellierungskompetenz, indem mathematische Überlegungen und Handlungsweisen zur Einschätzung von Ereignissen genutzt werden.
2. Einbettung der Unterrichtsstunde in die Unterrichtsreihe: Dieses Kapitel beschreibt die Position der vorliegenden Unterrichtsstunde innerhalb der gesamten Unterrichtsreihe. Die Stunde "Wir würfeln mit zwei Würfeln" baut auf vorherigen Stunden auf, in denen die Schüler bereits Kombinatorik und die Darstellung von Daten in Diagrammen und Tabellen erlernt haben. Es ist ein wichtiger Schritt zur Vertiefung des Verständnisses von Wahrscheinlichkeit und Häufigkeitsverteilungen durch ein konkretes Zufallsexperiment. Die nachfolgenden Stunden befassen sich mit dem systematischen Ergründen des Zufallsexperiments und der Überprüfung von Spielregeln auf Fairness.
3. Problemstellung, LSP und Anforderungsbereiche der Unterrichtsstunde: Dieses Kapitel definiert die zentrale Problemstellung der Stunde: "Welche Augensumme wird am häufigsten gewürfelt?". Es beschreibt den Lernschwerpunkt, der auf dem Üben und Vertiefen stochastischer Kompetenzen liegt, sowie die Anforderungsbereiche der Stunde, die von einfachem Reproduzieren bis hin zum komplexeren Verallgemeinern und Reflektieren reichen. Die Schüler sollen nicht nur würfeln und Daten erfassen, sondern auch Zusammenhänge herstellen und die Ergebnisse reflektieren, um die Ungleichverteilung der Augensummen zu verstehen.
4. Lehr- und Arbeitsplanbezug: Dieses Kapitel zeigt den Bezug der Unterrichtsstunde zum Lehrplan Mathematik des Landes NRW und zum schuleigenen Curriculum. Es werden die relevanten inhaltsbezogenen Kompetenzen (Zahlen und Operationen, Daten, Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten) und prozessbezogenen Kompetenzen (Problemlösen, Argumentieren, Darstellen/Kommunizieren) herausgestellt, die in der Stunde gefördert werden. Die Stunde deckt verschiedene Aspekte des Lehrplans ab und fördert die Anwendung mathematischer Kenntnisse in einem praktischen Kontext.
5. Sachanalyse: In diesem Kapitel wird die fachliche Grundlage der Unterrichtsstunde erläutert. Es beschreibt das Würfeln mit zwei Würfeln als Zufallsexperiment und die daraus resultierende Ergebnismenge der möglichen Augensummen. Die Analyse verdeutlicht die Ungleichverteilung der Häufigkeiten der Augensummen und begründet diese mit der unterschiedlichen Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten für die einzelnen Summen. Dieses Kapitel legt die fachdidaktische Basis für das Verständnis des Experiments und der Interpretation der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Stochastik, Wahrscheinlichkeit, Häufigkeitsverteilung, Zufallsexperiment, Kombinatorik, Datenanalyse, Diagramm, Statistik, Augensumme, Würfeln, Lehrplanbezug, Modellierungskompetenz.
Häufig gestellte Fragen zur Unterrichtsstunde "Wir würfeln mit zwei Würfeln"
Was ist der allgemeine Inhalt dieser Unterrichtsplanung?
Diese Unterrichtsplanung beinhaltet eine umfassende Übersicht über eine Mathematikstunde zum Thema Stochastik. Sie umfasst ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Üben und Vertiefen stochastischer Kompetenzen durch ein Würfel-Experiment.
Welche Themen werden in der Unterrichtsreihe behandelt?
Die Unterrichtsreihe behandelt Kombinatorik, Datenanalyse und -darstellung, Wahrscheinlichkeit und Häufigkeitsverteilung sowie die Anwendung mathematischer Methoden zur Problemlösung und die Entwicklung von Modellierungskompetenzen.
Was ist der Lernschwerpunkt der Unterrichtsstunde?
Der Lernschwerpunkt liegt im Üben und Vertiefen stochastischer Kompetenzen der Schüler. Sie sollen die Häufigkeitsverteilung von Augensummen beim Werfen zweier Würfel erarbeiten und dabei ihre prozessbezogenen Kompetenzen im Darstellen, Kommunizieren und Argumentieren verbessern.
Wie ist die Stunde in die Unterrichtsreihe eingebettet?
Die Stunde baut auf vorherigem Wissen über Kombinatorik und die Darstellung von Daten in Diagrammen und Tabellen auf. Sie ist ein wichtiger Schritt zur Vertiefung des Verständnisses von Wahrscheinlichkeit und Häufigkeitsverteilungen und bereitet auf weitere Stunden zum systematischen Ergründen des Zufallsexperiments und der Überprüfung von Spielregeln auf Fairness vor.
Welche Problemstellung wird in der Stunde behandelt?
Die zentrale Problemstellung lautet: "Welche Augensumme wird am häufigsten gewürfelt?". Die Schüler sollen durch das Experiment die Ungleichverteilung der Augensummen erkennen und erklären.
Welche Anforderungsbereiche werden in der Stunde angesprochen?
Die Anforderungsbereiche reichen vom einfachen Reproduzieren bis hin zum komplexeren Verallgemeinern und Reflektieren. Die Schüler sollen nicht nur Daten erfassen, sondern auch Zusammenhänge herstellen und die Ergebnisse reflektieren.
Welcher Lehrplanbezug besteht?
Die Stunde bezieht sich auf den Lehrplan Mathematik des Landes NRW und das schuleigene Curriculum. Sie fördert inhaltsbezogene Kompetenzen (Zahlen und Operationen, Daten, Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten) und prozessbezogene Kompetenzen (Problemlösen, Argumentieren, Darstellen/Kommunizieren).
Welche Sachanalyse liegt der Stunde zugrunde?
Die Sachanalyse erläutert das Würfeln mit zwei Würfeln als Zufallsexperiment und die daraus resultierende Ergebnismenge. Sie verdeutlicht die Ungleichverteilung der Häufigkeiten der Augensummen und begründet diese mit der unterschiedlichen Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Stunde?
Schlüsselwörter sind: Stochastik, Wahrscheinlichkeit, Häufigkeitsverteilung, Zufallsexperiment, Kombinatorik, Datenanalyse, Diagramm, Statistik, Augensumme, Würfeln, Lehrplanbezug, Modellierungskompetenz.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2018, Das Würfelexperiment. Welche Augensumme wird am häufigsten gewürfelt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1370853