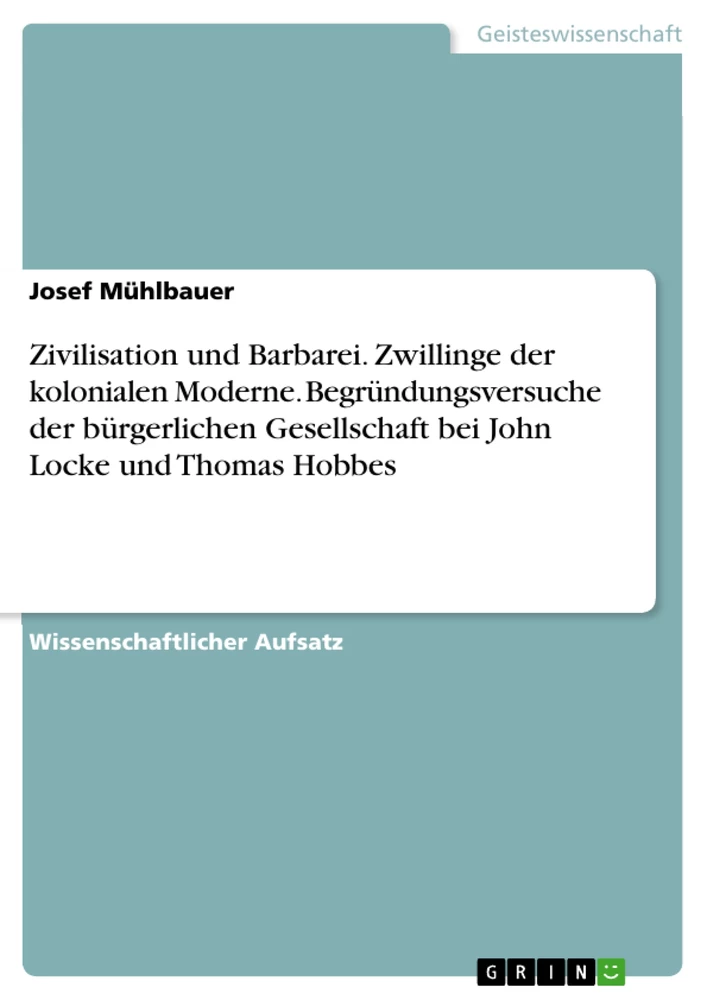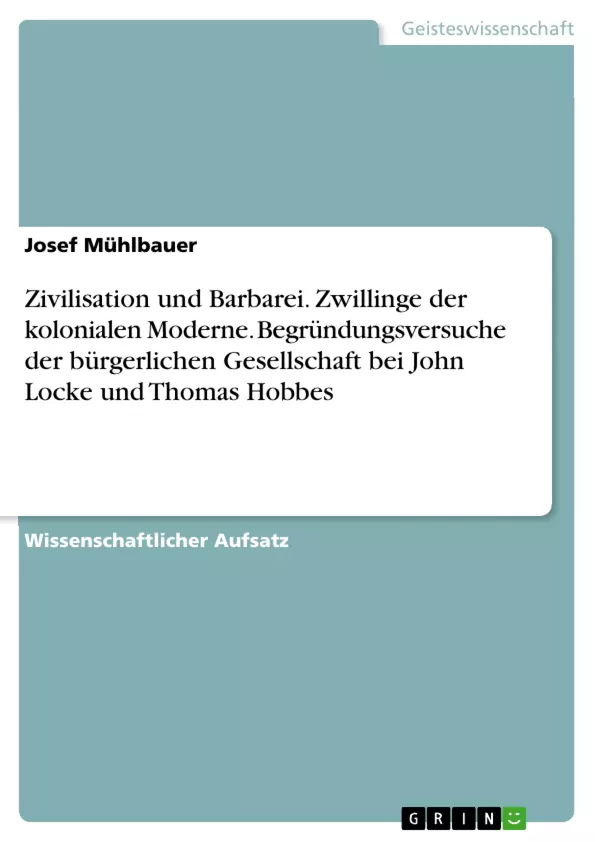Inwieweit hängen Fortschrittsdenken und Aufklärung mit Kolonialismus und Imperialismus in der liberalen Moderne zusammen? Wie kann der selbstdeklarierte Moment der politischen und wirtschaftlichen Freiheit zu Weltkriegen, dem Holocaust und Kolonialismus/Imperialismus geführt haben? Wie kann das autonome und rationale Subjekt der Moderne sich freiwillig einer Staatsgewalt unterwerfen und somit sich selbst quasi entmündigen? Welche epistemischen Grundlagen müssten dafür geschaffen worden sein?
Hobbes und Locke, auf die ich mich hauptsächlich in dieser Arbeit fokussiere, vereint der Wunsch nach einer sicheren Gesellschaftsordnung und es eint sie die Suche nach gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien die sich von Dogmen religiöser Art emanzipiert wollten. Sie stehen in der Tradition der Aufklärung und liberalen, bürgerlichen Gesellschaft, können aber auch als proto-imperialistische Denker betrachtet werden. Laut Arendt besteht eine enge Verbindung zwischen der liberalen Marktrationalität und der expansiven, imperialistischen (Geo-)Politik. Genau diese Ambivalenz der Moderne bzw. diese Dialektik der Aufklärung versuche ich in der folgenden Arbeit anhand des dichotomen Denkens aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Arbeit und zentrale Fragestellung
- Epistemischen Grundlagen der kolonialen Moderne
- Staatsgewalt bei Hobbes
- Eigentum bei Locke
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die epistemischen Grundlagen der kolonialen Moderne und die Rolle von John Locke und Thomas Hobbes bei der Begründung der bürgerlichen Gesellschaft. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse des dichotomen Denkens von Zivilisation und Barbarei, das als grundlegender epistemischer Baustein der Moderne betrachtet wird.
- Die epistemischen Grundlagen der kolonialen Moderne
- Die Rolle von John Locke und Thomas Hobbes bei der Begründung der bürgerlichen Gesellschaft
- Die Konstruktion des dichotomen Denkens von Zivilisation und Barbarei
- Die Bedeutung von Staatsgewalt und Eigentum in der kolonialen Moderne
- Die Verbindung zwischen Fortschrittsdenken, Aufklärung und Kolonialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet den Übergang von der Ständegesellschaft zur bürgerlichen Gesellschaft im Frühkapitalismus. Die Merkmale dieser Transformation, wie die neue kapitalistische Wirtschaftsweise, das rationalistische Weltbild und der Besitzindividualismus, werden dargelegt. Die Arbeit legt ihren Fokus auf das dichotome Denken von Zivilisation und Barbarei, welches in der liberalen Moderne häufig zur Rechtfertigung von imperialistischen Bestrebungen eingesetzt wurde.
Aufbau der Arbeit und zentrale Fragestellung
Der Aufbau der Arbeit und die zentrale Fragestellung werden vorgestellt. Die Arbeit befasst sich auf epistemischer Ebene mit der Wissensproduktion und -reproduktion bei Locke und Hobbes, um zu verstehen, wie das dichotome Denkmuster von Zivilisation und Barbarei entstand. Die Frage nach einem roten Faden zwischen liberalen Denkschulen von Locke/Hobbes bis Huntington und Fukuyama wird aufgeworfen.
Epistemischen Grundlagen der kolonialen Moderne
Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs „Zivilisation“ im Kontext der europäischen Expansion. Die Zivilisierungsmission als Schlagwort imperialer Ideologien und die damit einhergehende epistemische Hierarchisierung werden erläutert. Die Arbeit fokussiert sich auf zwei wesentliche Merkmale des kolonialen Diskurses: die Eigentumslogik und die Rechtfertigung von (Staats-)Gewalt im Zeichen des dichotomen Denkens von Natur- vs. Gesellschaftszustand.
Staatsgewalt bei Hobbes
Dieser Abschnitt analysiert Hobbes' Theorie des Naturzustandes und die daraus resultierende Notwendigkeit eines starken Staates zur Sicherung von Sicherheit und Ordnung. Es wird untersucht, wie sich Hobbes' anthropologische Annahmen über den Menschen, insbesondere die These vom „Kampf aller gegen alle“, auf das Staatsverständnis auswirken.
Eigentum bei Locke
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Lockes Eigentumstheorie und ihrer Verbindung zur Kolonialisierung. Lockes Konzept des Naturrechts, das jedem Menschen das Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum zuspricht, wird analysiert. Die Arbeit beleuchtet, wie Locke Eigentum als Ergebnis von Arbeit und Aneignung begreift und wie diese Konzeption zur Rechtfertigung der europäischen Expansion genutzt wurde.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Zivilisation, Barbarei, Staatsgewalt, Eigentum, Naturzustand, Gesellschaftsvertrag, koloniale Moderne, epistemische Grundlagen, Liberalismus, Imperialismus, Fortschrittsdenken, Aufklärung, dichotomes Denken und anthropologische Annahmen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These der Arbeit zu Locke und Hobbes?
Die Arbeit untersucht, wie Fortschrittsdenken und Aufklärung mit Kolonialismus und Imperialismus in der liberalen Moderne verknüpft sind.
Was bedeutet „dichotomes Denken“ in diesem Kontext?
Es beschreibt die strikte Trennung zwischen Zivilisation und Barbarei, die oft zur Rechtfertigung imperialer Gewalt genutzt wurde.
Wie rechtfertigt John Locke Eigentum und Kolonialisierung?
Locke begreift Eigentum als Ergebnis von Arbeit. Diese Theorie wurde genutzt, um die Aneignung von Land in Kolonien zu legitimieren.
Welche Rolle spielt die Staatsgewalt bei Thomas Hobbes?
Hobbes sieht die Notwendigkeit einer starken Staatsgewalt, um den chaotischen Naturzustand („Kampf aller gegen alle“) zu beenden und Sicherheit zu garantieren.
Warum werden Locke und Hobbes als „proto-imperialistische“ Denker bezeichnet?
Weil ihre Theorien zur bürgerlichen Gesellschaft und zum Staat die epistemischen Grundlagen für die expansive Politik der Moderne schufen.
- Citation du texte
- Josef Mühlbauer (Auteur), 2023, Zivilisation und Barbarei. Zwillinge der kolonialen Moderne. Begründungsversuche der bürgerlichen Gesellschaft bei John Locke und Thomas Hobbes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1370833