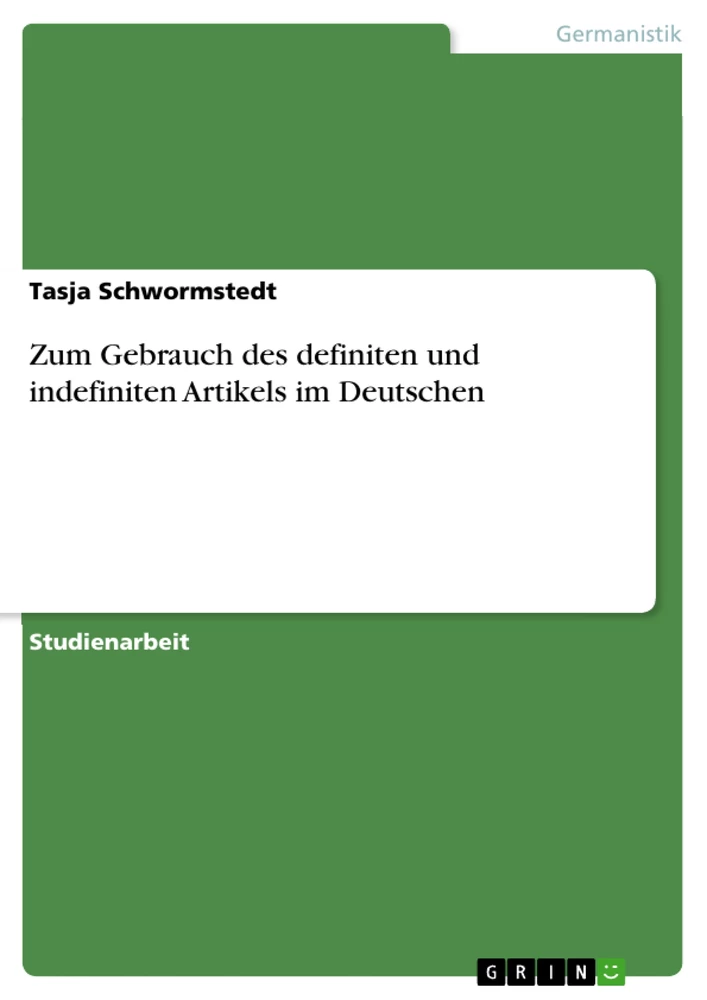Die Arbeit zeigt den Gebrauch der Artikel im Deutschen mit seiner jeweiligen Funktion im Satz auf. Welche Merkmale weisen Artikel auf? Wie werden sie verwendet? Wie unterscheidet sich der Gebrauch eines definiten Artikels vom indefiniten Artikel?
Die vorliegende Arbeit zeigt zunächst die Herausbildung der Artikel im Rahmen der Grammatikalisierung auf. Hier wird verständlich warum sich Artikel in der deutschen Sprache herausgebildet haben und woraus ihre ursprüngliche Funktion besteht. Auf Basis des etymologischen Wissens folgt die Kategorisierung der Artikel.
In der Forschung herrscht große Uneinigkeit. Die traditionelle Grammatik gilt als überholt. Doch auch die synthetische Grammatik oder die Dependenz-Verb Grammatik haben unterschiedliche Ansätze zum Einordnen der Artikel in Kategorien. An dieser Stelle kann keine vollständige Diskussion erfolgen. Dennoch ist es wichtig die Komplexität der verschiedenen Ansätze und ihre Heterogenität nachzuvollziehen, um sich im weiteren Schritt mit der Form und Funktion zu beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur etymologischen Basis
- 3. Zur Kategorisierung der Artikel
- 4. Form und Funktion der Artikel
- 4.1 definiter Artikel
- 4.2 indefiniter Artikel
- 5. Zum Gebrauch der Artikel
- 5.1 Unterarten von Substantiven
- 5.2 Sprachwandel
- 5.3 Generischer Gebrauch
- 5.4 Spezifischer Gebrauch und unspezifischer Gebrauch
- 5.5 Nullartikel
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über den Gebrauch des definiten und indefiniten Artikels im Deutschen. Der Fokus liegt auf der Funktion der Artikel im Satz, weniger auf einer quantitativen Aufzählung aller Verwendungsmöglichkeiten. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Artikel, verschiedene grammatische Kategorisierungen und deren Herausforderungen sowie den Gebrauch der Artikel in verschiedenen Kontexten.
- Etymologische Entwicklung der deutschen Artikel
- Unterschiedliche grammatische Kategorisierungen der Artikel
- Form und Funktion des definiten und indefiniten Artikels
- Gebrauch der Artikel in verschiedenen Kontexten (z.B. generischer, spezifischer Gebrauch, Nullartikel)
- Der Artikelgebrauch im Kontext des Sprachwandels
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Artikelgebrauchs im Deutschen ein und hebt die Schwierigkeiten beim Verständnis und Gebrauch von Artikeln für Muttersprachler und Lerner hervor. Sie benennt die Zielsetzung der Arbeit, einen Überblick über den Artikelgebrauch und dessen Funktion im Satz zu geben, und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Einleitung betont die unzureichende Auseinandersetzung mit dieser Thematik in der linguistischen Literatur und in der schulischen Grammatikdidaktik, die oft auf Auswendiglernen anstatt auf Verständnis setzt. Die Arbeit kündigt die Darstellung der Herausbildung der Artikel im Rahmen der Grammatikalisierung und die Untersuchung der Form, Funktion und des Gebrauchs an. Der Vergleich mit anderen Sprachen wird aufgrund des begrenzten Rahmens ausgeschlossen.
2. Zur etymologischen Basis: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung der Artikel im Deutschen. Es vergleicht artikelreiche Sprachen wie Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch mit artikellosen Sprachen wie Türkisch, Finnisch und Japanisch. Es wird erläutert, dass im Gegensatz zu artikellosen Sprachen, wo oft Zahlwörter als unbestimmter Artikel fungieren, der deutsche Artikel flektiert und an das Nomen angepasst wird. Das Kapitel verfolgt die Entwicklung vom Indogermanischen und Lateinischen (ohne Artikel) über das Altgriechische (nur definiter Artikel) und Althochdeutsch (Definitheitskontext nicht immer realisiert) bis zum Mittelhochdeutschen (obligatorischer Gebrauch). Der Prozess der Grammatikalisierung des Demonstrativs zum definiten Artikel wird detailliert beschrieben. Die Entstehung des indefiniten Artikels aus dem Zahlwort "eins" wird ebenfalls behandelt. Zusammenfassend beschreibt das Kapitel die historische Entwicklung der Artikel als Ergebnis eines langfristigen grammatischen Entwicklungsprozesses.
3. Zur Kategorisierung der Artikel: Dieses Kapitel befasst sich mit den unterschiedlichen Ansätzen zur Kategorisierung von Artikeln in der Linguistik. Es zeigt die Schwierigkeiten und Widersprüche der traditionellen Grammatik auf, die den Artikel als Geschlechtswort und Marker des Genus definiert. Das Kapitel deutet an, dass sowohl die synthetische Grammatik als auch die Dependenz-Verb-Grammatik unterschiedliche Ansätze zur Einordnung der Artikel in Kategorien verfolgen, ohne diese im Detail zu diskutieren. Die Komplexität und Heterogenität verschiedener Ansätze wird betont, um den Übergang zur Diskussion von Form und Funktion der Artikel im folgenden Kapitel zu begründen. Das Kapitel verdeutlicht die anhaltende Debatte über die richtige Kategorisierung von Artikeln in der Sprachwissenschaft.
Schlüsselwörter
Artikelgebrauch, Definitartikel, Indefinitartikel, Grammatikalisierung, Etymologie, Kategorisierung, Form, Funktion, Gebrauch, Sprachwandel, DAF, DaZ, Hoffmanns Determinative, Nominale Kasus, Linguistik, Traditionelle Grammatik
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Artikelgebrauch im Deutschen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zum Artikelgebrauch im Deutschen?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über den Gebrauch definiter und indefiniter Artikel im Deutschen. Sie behandelt die etymologische Entwicklung der Artikel, verschiedene grammatische Kategorisierungen, die Form und Funktion der Artikel im Satz und deren Gebrauch in unterschiedlichen Kontexten (generischer, spezifischer Gebrauch, Nullartikel). Ein Schwerpunkt liegt auf der Funktionsweise der Artikel, nicht auf einer vollständigen Auflistung aller Verwendungsmöglichkeiten. Der Sprachwandel im Bezug auf den Artikelgebrauch wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, etymologische Basis der Artikel, Kategorisierung der Artikel, Form und Funktion der Artikel (definiter und indefiniter Artikel), Gebrauch der Artikel (Subtypen von Substantiven, Sprachwandel, generischer und spezifischer Gebrauch, Nullartikel) und Fazit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit soll ein verständliches Verständnis des Artikelgebrauchs im Deutschen vermitteln, insbesondere für Lerner. Sie zielt darauf ab, die Funktion der Artikel im Satz zu erklären und nicht nur Regeln auswendig zu lernen. Die Arbeit kritisiert die unzureichende Behandlung des Themas in der linguistischen Literatur und der schulischen Grammatikdidaktik.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die etymologische Entwicklung der deutschen Artikel, unterschiedliche grammatische Kategorisierungen, die Form und Funktion definiter und indefiniter Artikel, den Gebrauch der Artikel in verschiedenen Kontexten (generischer, spezifischer Gebrauch, Nullartikel) und den Artikelgebrauch im Kontext des Sprachwandels. Ein Vergleich mit artikellosen Sprachen wird angedeutet, um die Besonderheiten des deutschen Systems zu verdeutlichen.
Wie wird die historische Entwicklung der Artikel dargestellt?
Das Kapitel zur etymologischen Basis verfolgt die Entwicklung der Artikel vom Indogermanischen und Lateinischen (ohne Artikel) über das Altgriechische (nur definiter Artikel) und Althochdeutsch bis zum Mittelhochdeutschen (obligatorischer Gebrauch). Der Prozess der Grammatikalisierung des Demonstrativs zum definiten Artikel und die Entstehung des indefiniten Artikels aus dem Zahlwort "eins" werden detailliert beschrieben.
Welche Schwierigkeiten bei der Kategorisierung von Artikeln werden angesprochen?
Die Arbeit weist auf die Schwierigkeiten und Widersprüche der traditionellen Grammatik hin, die den Artikel als Geschlechtswort und Marker des Genus definiert. Sie erwähnt unterschiedliche Ansätze in der synthetischen Grammatik und der Dependenz-Verb-Grammatik, ohne diese im Detail zu diskutieren. Die anhaltende Debatte über die richtige Kategorisierung von Artikeln in der Sprachwissenschaft wird betont.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Artikelgebrauch, Definitartikel, Indefinitartikel, Grammatikalisierung, Etymologie, Kategorisierung, Form, Funktion, Gebrauch, Sprachwandel, DAF, DaZ, Hoffmanns Determinative, Nominale Kasus, Linguistik, Traditionelle Grammatik.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Studierende der Linguistik und Sprachwissenschaft sowie an Deutsch als Fremdsprache (DaF) und Deutsch als Zweitsprache (DaZ)-Lehrende und -lernende. Sie kann auch für alle Interessierten nützlich sein, die ein tieferes Verständnis des deutschen Artikelgebrauchs erlangen möchten.
- Citar trabajo
- Tasja Schwormstedt (Autor), 2015, Zum Gebrauch des definiten und indefiniten Artikels im Deutschen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1369064