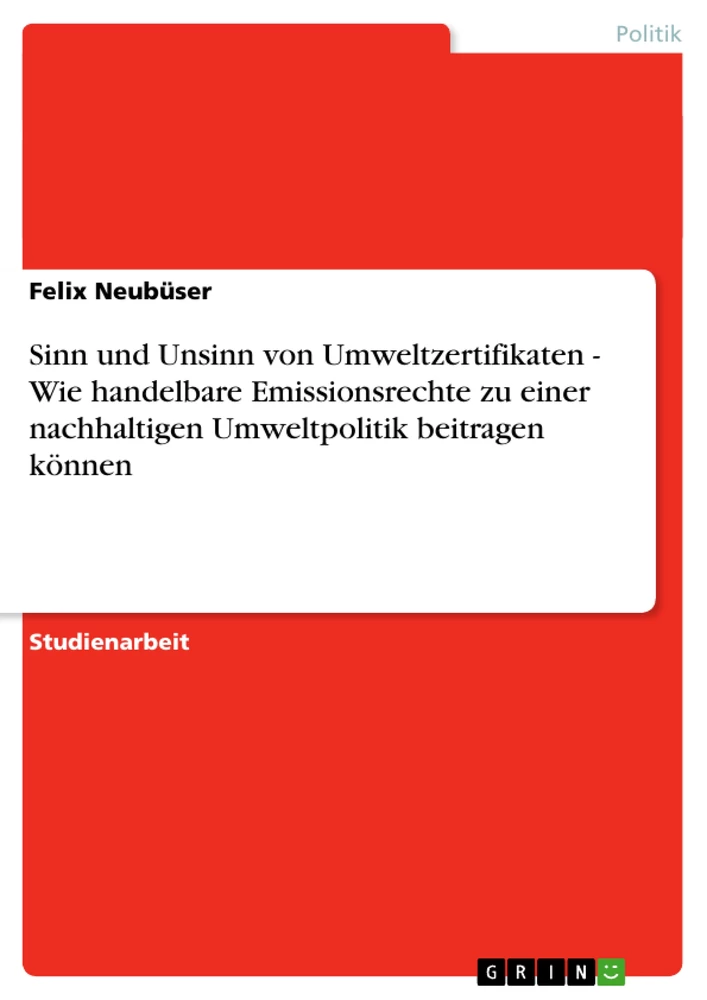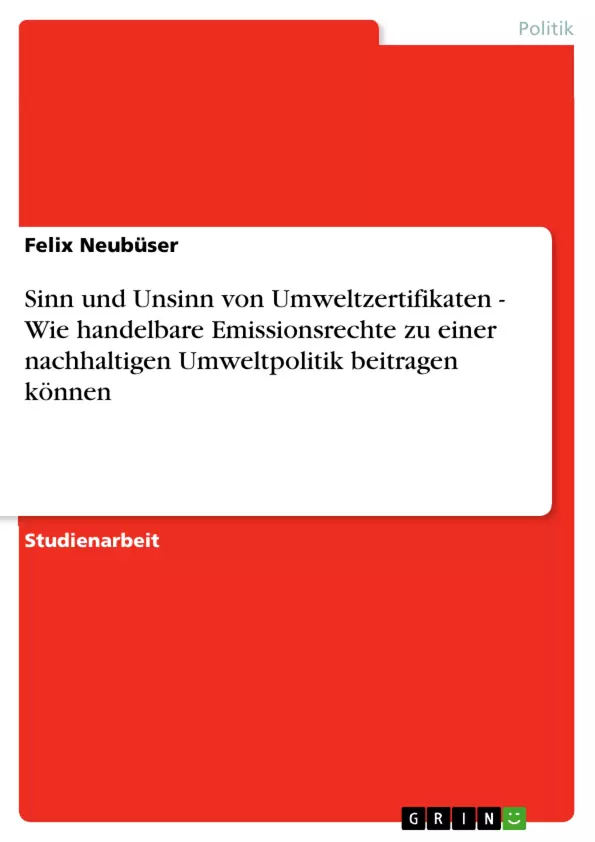Kaum eine politische Grundsatzrede kommt mehr ohne diesen Begriff aus, zahlreiche Wirtschaftsunternehmen haben sich diese Formel als hehres Ziel und Leitbild auf die Fahnen oder zumindest in ihren Jahreswirtschaftsbericht geschrieben, und auch in der internationalen Staatengemeinschaft der Vereinten Nationen spielt er eine Schlüsselrolle – die Rede ist von „nachhaltiger Entwicklung“. Insbesondere mit dem Amtsantritt der rot-grünen Bundesregierung erlebt dieser Ausdruck, der ursprünglich aus der Forstwirtschaft stammt , einen regelrechten Boom. Seine Faszination verdanke „das Heilsversprechen ‚nachhaltiger Entwicklung’“ der Eigenschaft, ein Formelkompromiss zu sein, versucht Fritz Vorholz in der Wochenzeitung „Die Zeit“ diese Popularität zu erklären – freilich nicht ohne im selben Artikel ironisch den früheren deutschen Umweltminister Klaus Töpfer als Direktor des UN-Umweltprogramms zu zitieren: „Wenn einem nichts anderes mehr einfällt, spricht man von ‚nachhaltiger Entwicklung’"
Das mag sein, aber so einfach abzutun ist das Thema damit nicht. Inhaltlich maßgeblich geprägt wurde der Ausdruck von der Brundtland-Kommission. Dieses, nach ihrem Vorsitzenden, dem damaligen norwegischen Ministerpräsidenten Gro Harlem-Brundtland, benannte Gremium, definierte nachhaltige Entwicklung im „Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung“ (1987) wie folgt: „Die gegenwärtige Generation soll ihren Bedarf befriedigen, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu Befriedigung ihres Eigenbedarfs zu beeinträchtigen.“ Wenige Jahre später, auf dem sogenannten „Erd-Gipfel“ von Rio im Jahre 1992 wurde „sustainable development“ von den Vereinten Nationen sogar zum Leitbild künftigen globalen Handelns erklärt. Auch in deutschen Regierungskreisen scheint man sich intensiv mit dem Begriff der Nachhaltigkeit zu beschäftigen – alleine 1083 „Treffer“ liefert der interne Suchalgorithmus, wenn man auf der Homepage der Bundesregierung nach dem Begriff „Nachhaltigkeit“ forscht. Außerdem stößt man auf ein weiteres Zauberwort, das nicht selten in der Nähe des gesuchten Wortes steht und in diesem Zusammenhang immer populärer zu werden scheint. Die Rede ist von handelbaren Umweltzertifikaten, genauer: Emissionsberechtigungen.
Wie also funktioniert diese besondere Form des Klimaschutzes? Und vor allem:
Welches Potenzial haben handelbare Emissionsrechte, um tatsächlich langfristig zu einer, auf nachhaltige Entwicklung ausgerichteten, Umweltpolitik beizutragen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nachhaltigkeit - ein Definitionsversuch
- Allgemein: Instrumente der Umweltpolitik
- Handelbare Emissionsrechte
- Marktversagen und externe Effekte
- Die Schaffung eines künstlichen Marktes durch die Ausgabe von Emissionsrechten
- Befristete und unbefristete Zertifikate
- Flexible Steuerung durch eine unabhängige „Zertifikatebank“
- Das Marktvolumen und das Entstehen weiterer Märkte
- Handelbare Zertifikate und das Kosten-Nutzen-Kalkül der Unternehmen
- Die Probleme handelbarer Emissionsrechte
- Globale Instrumente als Lösung für ein globales Problem
- Probleme der Globalität und die Bedeutung der Nationalstaaten
- Das Problem der Kompensation extremer Umweltbelastungen
- Bereits existierende Systeme handelbarer Umweltzertifikate
- Minderungsnachweise und Umweltzertifikate in den USA
- Der Vorstoss der Europäischen Union
- Fazit und Zusammenfassung: Emissionsrechte und Nachhaltigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Thematik handelbarer Emissionsrechte und deren Potenzial für eine nachhaltige Umweltpolitik. Er analysiert die Funktionsweise von Emissionszertifikaten, beleuchtet ihre Vor- und Nachteile und untersucht bestehende sowie geplante Systeme in verschiedenen Ländern.
- Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung
- Die Funktionsweise von Emissionszertifikaten und die Schaffung künstlicher Märkte
- Die Rolle von Emissionszertifikaten bei der Bewältigung von Umweltproblemen
- Die Herausforderungen und Probleme bei der Umsetzung eines globalen Systems für Emissionsrechte
- Die Bedeutung von Emissionszertifikaten für eine nachhaltige Umweltpolitik.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung erläutert die Bedeutung des Begriffs "nachhaltige Entwicklung" und stellt den Emissionsrechtehandel als einen möglichen Ansatz zur Umsetzung dieser Zielsetzung vor.
- Kapitel 2 definiert den Begriff der Nachhaltigkeit und verdeutlicht seine Ursprünge in der Forstwirtschaft.
- Kapitel 3 widmet sich den allgemeinen Instrumenten der Umweltpolitik, um den Emissionsrechtehandel in einen breiteren Kontext zu stellen.
- Kapitel 4 erläutert die Funktionsweise von Emissionszertifikaten, die Entstehung künstlicher Märkte und die Bedeutung von Marktversagen und externen Effekten. Es beleuchtet verschiedene Aspekte des Emissionsrechtehandels, wie die Ausgabe von befristeten und unbefristeten Zertifikaten sowie die Rolle einer unabhängigen "Zertifikatebank".
- Kapitel 5 analysiert die Probleme und Herausforderungen, die mit der Umsetzung von Emissionszertifikaten verbunden sind, insbesondere die Globalität des Problems und die Bedeutung nationaler Regelungen.
- Kapitel 6 präsentiert bereits existierende Systeme für Emissionszertifikate in den USA und der Europäischen Union, um konkrete Beispiele für die Anwendung des Instruments zu zeigen.
Schlüsselwörter
Die Kernthemen des Textes sind nachhaltige Entwicklung, Umweltpolitik, Emissionszertifikate, Emissionshandel, Marktversagen, externe Effekte, Globalisierung, nationale Regelungen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von nachhaltiger Entwicklung?
Nach der Brundtland-Kommission bedeutet es, den Bedarf der heutigen Generation zu decken, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden.
Wie funktionieren handelbare Emissionszertifikate?
Der Staat schafft einen künstlichen Markt, indem er eine begrenzte Anzahl an Verschmutzungsrechten ausgibt. Unternehmen können diese kaufen oder verkaufen, was Anreize zur CO2-Einsparung schafft.
Was sind externe Effekte in der Umweltökonomie?
Es sind Kosten (wie Umweltverschmutzung), die bei der Produktion entstehen, aber nicht vom Verursacher, sondern von der Allgemeinheit getragen werden (Marktversagen).
Welche Probleme gibt es beim Handel mit Emissionsrechten?
Herausforderungen sind die globale Umsetzung, die Kompensation extremer lokaler Belastungen und die Festlegung der richtigen Menge an Zertifikaten.
Wo gibt es bereits Systeme für Emissionsrechte?
Bekannte Beispiele sind Systeme in den USA sowie das Emissionshandelssystem der Europäischen Union.
- Quote paper
- Felix Neubüser (Author), 2003, Sinn und Unsinn von Umweltzertifikaten - Wie handelbare Emissionsrechte zu einer nachhaltigen Umweltpolitik beitragen können, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13636