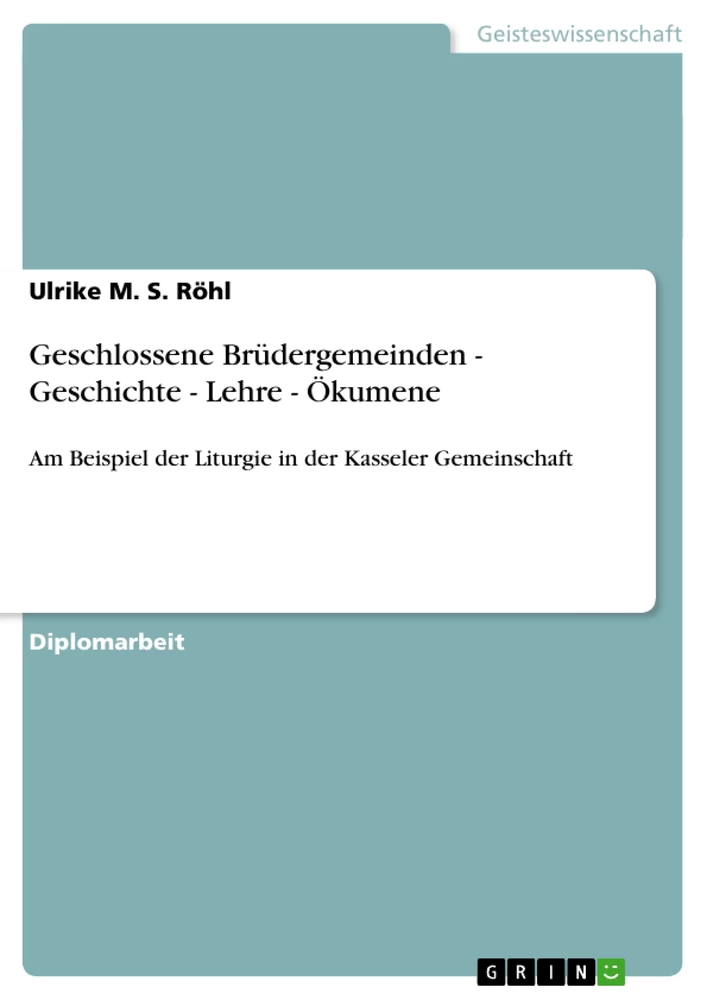„Ein Teil der weltweiten Gemeinde Jesu und der Geschichte Gottes mit den Menschen ist die Brüderbewegung[ ], die seit Anfang des 19. Jahrhunderts sich weltweit ausbreitet und den Gedanken des ‚Allgemeinen Priestertums’ und der Einheit des Leibes Christi auf ihre Fahnen geschrieben hat.“
Es ist eine unerklärliche, gar paradoxe Tatsache, dass die wissenschaftlich theologische Forschung in ihren Untersuchungen zur Historischen Theologie und Konfessionskunde bislang einen Mann fast vollkommen unberücksichtigt gelassen hat, der allerdings als eine Art Gründerfigur einer Sondergemeinschaft des Christentums fungiert: den Engländer John Nelson Darby und seine „Brüderbewegung“, - obgleich der Einfluss, den Darby bis heute in der Theologie ausübt, bezeichnend ist.
Mit Hilfe der hier vorliegenden Diplomarbeit: „’Geschlossenen Brüdergemeinden’. Geschichte – Lehre und Verfassung – Ökumene. Am Beispiel der Liturgie in der Kasseler Gemeinschaft“, möchte ich mich intensiver mit dem religiösen Glaubenskonstrukt der „Geschlossenen Brüder“ auseinandersetzen und dieses differenzierter betrachten. In einem ersten Zugang wird sich der genannten Thematik im Rahmen einer Problemdarstellung sowie kritischen Hinterfragungen angenähert. Weiter wird das Selbstverständnis der „Christlichen Versammlung“ erörtert. Bei der Darstellung des Legitimationsverständnisses geht es primär darum, wie die Gemeinden sich aus ihrem je eigenen Verstehen heraus begreifen und sich in der Literatur präsentieren. Über einen prägnanten Auszug der „Brüdergeschichte“ wird sich einzelnen Lehren und Reglementierungen zugewendet. Eine kritische Auswertung der zuvor gewonnen Erkenntnisse schließt diesen Teil ab. Anschließend wird der Versuch unternommen, die Ergebnisse in den Kontext der Ökumene zu transferieren sowie denkbare Berührungspunkte beider Glaubensgemeinschaften zueinander aufzuzeigen. Am konkreten Paradigma eines Gottesdienstes der Gemeinde in Kassel werden die Differenzen sowie Gemeinsamkeiten beider Gemeinschaften in liturgischer Verständigkeit gegenübergestellt, um eine Auswertung sowie einen sich anschließenden Fazit zu formulieren. Die wissenschaftliche Ausarbeitung wird mit einer persönlichen Stellungnahme beendet. - Diese Diplomarbeit möchte einen Beitrag zum Verständnis der „Geschlossenen Brüdergemeinden“ liefern, welches zum interkonfessionellen Gespräch mit der „Christlichen Versammlung“ der heute in Deutschland existierenden „Brüderbewegung“, führen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Problemdarstellung
- 3. Selbstverständnis der „Geschlossenen Brüdergemeinden“
- 3.1 Geschichtlicher Abriss
- 3.2 Lehre
- 3.2.1 Taufe
- 3.2.2 Mahl des Herrn
- 3.2.3 Allgemeine Priestertum
- 3.2.4 Absonderung
- 3.2.5 Stellung der Frau in der Gemeinde
- 3.2.6 Äußere Reglementierungen
- 3.3 Gemeindestruktur
- 3.3.1 Autonomie der lokalen Gemeinden
- 3.3.2 Dienste und Ämter
- 3.4 Kritik
- 4. Ökumene
- 4.1 „Geschlossene Brüdergemeinden“ und Ökumene
- 4.2 Ansichten der „Geschlossenen Brüder“ über die römisch-katholische Kirche
- 4.3 Mögliche Wege zur Annäherung
- 5. Darstellung eines Gottesdienstes bei den „Geschlossenen Brüder“
- 5.1 Vorstellung der Gemeinde
- 5.2 Gottesdienst
- 5.2.1 Ablauf
- 5.2.2 Predigt
- 5.3 Vergleich mit der römisch-katholischen Liturgie
- 5.3.1 Unterschiede
- 5.3.2 Gemeinsamkeiten
- 5.4 Auswertung
- 6. Fazit
- 7. Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die „Geschlossenen Brüdergemeinden“, eine konservative Gruppe innerhalb der Brüderbewegung. Die Arbeit analysiert deren Geschichte, Lehre, Gemeindestruktur und ökumenisches Verhältnis, insbesondere im Vergleich zur römisch-katholischen Kirche. Der Fokus liegt auf der Liturgie der Kasseler Gemeinschaft als Beispiel für die Praxis dieser Gemeinden.
- Historische Entwicklung der „Geschlossenen Brüdergemeinden“
- Lehre und Glaubensverständnis der „Geschlossenen Brüder“
- Gemeindestruktur und Organisation
- Ökumenische Beziehungen und Perspektiven
- Liturgische Praxis im Vergleich zur römisch-katholischen Liturgie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der „Geschlossenen Brüdergemeinden“ ein und erläutert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit. Sie hebt die Bedeutung der Gruppe innerhalb der Brüderbewegung hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Problemdarstellung: Dieses Kapitel beschreibt die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die sich bei der Erforschung der „Geschlossenen Brüdergemeinden“ stellen, unter anderem die Abgrenzung zu anderen Gruppen innerhalb der Brüderbewegung und der Zugang zu internen Dokumenten und Informationen. Die Problematik der Namensgebung und die Ablehnung des Begriffs "Darbyisten" wird ebenfalls erörtert.
3. Selbstverständnis der „Geschlossenen Brüdergemeinden“: Dieses Kapitel beleuchtet das Selbstverständnis der „Geschlossenen Brüdergemeinden“ aus verschiedenen Perspektiven. Der geschichtliche Abriss verfolgt die Entstehung und Entwicklung der Gruppe, während die Darstellung der Lehre die zentralen Glaubensüberzeugungen, wie Taufe, Abendmahl, und die Rolle der Frau, beleuchtet. Die Kapitel 3.3 und 3.4 beleuchten die Gemeindestruktur mit ihren Besonderheiten, sowie die interne und externe Kritik an dieser Glaubensgemeinschaft.
4. Ökumene: Dieses Kapitel analysiert das ökumenische Selbstverständnis und die Beziehungen der „Geschlossenen Brüdergemeinden“ zu anderen christlichen Konfessionen, mit einem besonderen Fokus auf die römisch-katholische Kirche. Es untersucht die bestehenden Unterschiede und diskutiert mögliche Wege der Annäherung.
5. Darstellung eines Gottesdienstes bei den „Geschlossenen Brüder“: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung eines Gottesdienstes in einer Kasseler Gemeinde der „Geschlossenen Brüder“. Es analysiert den Ablauf, die Predigt und vergleicht ihn mit der römisch-katholischen Liturgie, wobei sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede herausgearbeitet werden.
Schlüsselwörter
Geschlossene Brüdergemeinden, Brüderbewegung, John Nelson Darby, Liturgie, Ökumene, römisch-katholische Kirche, Lehre, Gemeindestruktur, Absonderung, Allgemeines Priestertum, Taufe, Abendmahl, Kassel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: "Geschlossene Brüdergemeinden"
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die „Geschlossenen Brüdergemeinden“, eine konservative Gruppe innerhalb der Brüderbewegung. Sie analysiert deren Geschichte, Lehre, Gemeindestruktur und ökumenisches Verhältnis, insbesondere im Vergleich zur römisch-katholischen Kirche. Der Fokus liegt auf der Liturgie einer Kasseler Gemeinschaft als Beispiel für die Praxis dieser Gemeinden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die historische Entwicklung der „Geschlossenen Brüdergemeinden“, deren Lehre und Glaubensverständnis, die Gemeindestruktur und Organisation, die ökumenischen Beziehungen und Perspektiven sowie einen detaillierten Vergleich der liturgischen Praxis mit der römisch-katholischen Liturgie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Vorwort, Einleitung, Problemdarstellung, Selbstverständnis der „Geschlossenen Brüdergemeinden“ (inkl. Geschichte, Lehre, Gemeindestruktur und Kritik), Ökumene (inkl. Verhältnis zu den Römisch-Katholischen Kirche und Annäherungsversuchen), Darstellung eines Gottesdienstes bei den „Geschlossenen Brüdern“ (inkl. Vergleich mit der römisch-katholischen Liturgie), Fazit und Stellungnahme.
Was wird im Kapitel "Selbstverständnis der Geschlossenen Brüdergemeinden" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet das Selbstverständnis der „Geschlossenen Brüdergemeinden“ umfassend. Es beinhaltet einen geschichtlichen Abriss, eine detaillierte Darstellung der Lehre (Taufe, Abendmahl, Allgemeines Priestertum, Absonderung, Stellung der Frau, äußere Reglementierungen), die Gemeindestruktur (Autonomie der lokalen Gemeinden, Dienste und Ämter) und schließlich Kritikpunkte an der Glaubensgemeinschaft.
Wie wird der ökumenische Aspekt behandelt?
Das Kapitel "Ökumene" analysiert das ökumenische Selbstverständnis und die Beziehungen der „Geschlossenen Brüdergemeinden“ zu anderen christlichen Konfessionen, insbesondere zur römisch-katholischen Kirche. Es untersucht bestehende Unterschiede und diskutiert mögliche Wege der Annäherung.
Wie wird der Gottesdienst der „Geschlossenen Brüder“ dargestellt?
Das Kapitel zur Darstellung eines Gottesdienstes bietet eine detaillierte Beschreibung eines Gottesdienstes in einer Kasseler Gemeinde. Es analysiert den Ablauf, die Predigt und vergleicht ihn im Detail mit der römisch-katholischen Liturgie, wobei sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede herausgearbeitet werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geschlossene Brüdergemeinden, Brüderbewegung, John Nelson Darby, Liturgie, Ökumene, römisch-katholische Kirche, Lehre, Gemeindestruktur, Absonderung, Allgemeines Priestertum, Taufe, Abendmahl, Kassel.
Welche Herausforderungen gab es bei der Forschung?
Die Problemdarstellung thematisiert die Schwierigkeiten bei der Erforschung der „Geschlossenen Brüdergemeinden“, wie z.B. die Abgrenzung zu anderen Gruppen innerhalb der Brüderbewegung und den Zugang zu internen Dokumenten und Informationen. Die Problematik der Namensgebung und die Ablehnung des Begriffs "Darbyisten" wird ebenfalls erörtert.
- Citar trabajo
- Ulrike M. S. Röhl (Autor), 2009, Geschlossene Brüdergemeinden - Geschichte - Lehre - Ökumene, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/136070