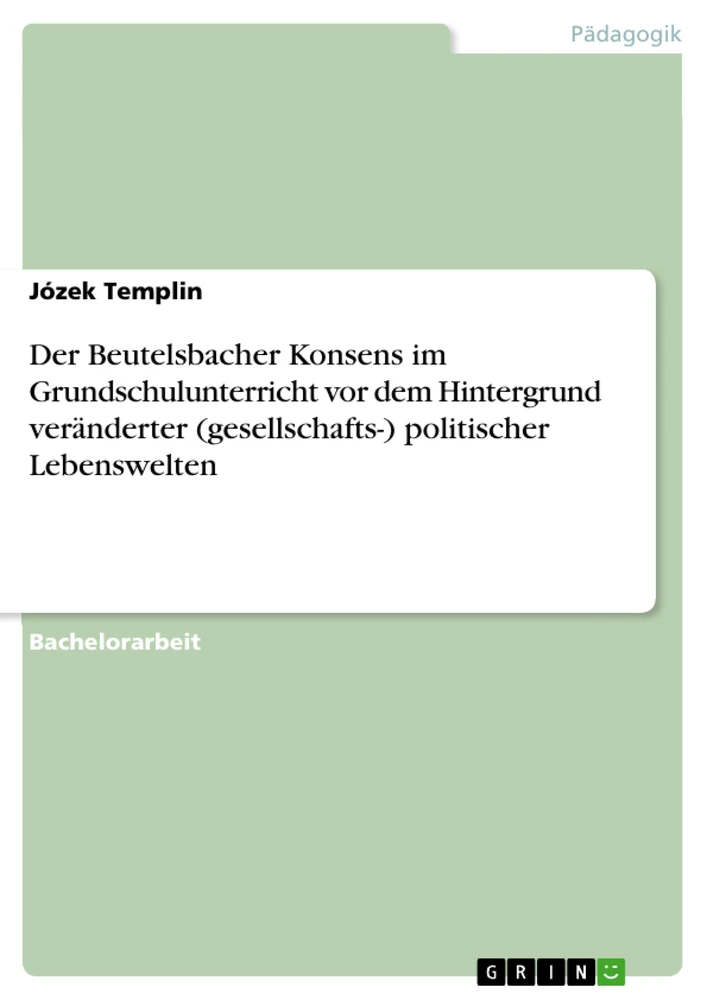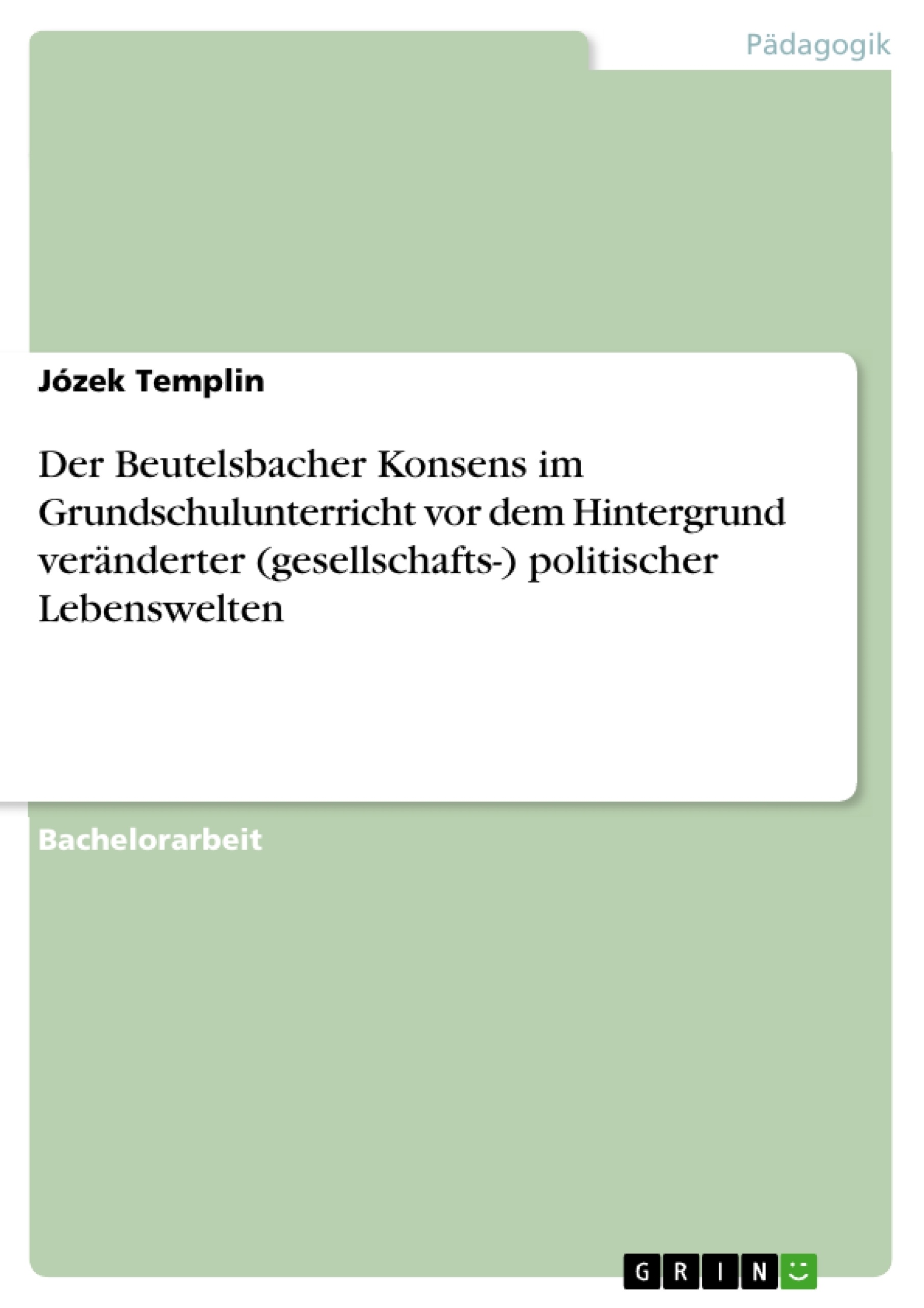Ausgehend von der These, dass sich die (gesellschafts-) politischen Lebenswelten von Kindern seit der Formulierung des Konsenses grundlegend verändert haben, wird in dieser Arbeit der Frage nachgegangen, ob der Beutelsbacher Konsens den Ansprüchen eines gegenwarts- und zukunftsbezogenen Sachunterrichts gerecht wird. Erkenntnisleitend wird die These formuliert, dass die Konsenspunkte des Beutelsbacher Minimalkonsenses als unterrichtliche Prinzipien im politischen Sachunterricht den veränderten (gesellschafts-) politischen Lebenswelten von Kindern nicht gerecht werden.
Dazu werden in der Arbeit unterschiedliche fachwissenschaftliche Texte aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen untersucht. Aufgrund der Vielzahl an Dokumenten und Ausführungen zum Konsens erfolgt eine Einschränkung der Texte unter diachronen Gesichtspunkten. Alle Texte, die sich unmittelbar auf den Konsens beziehen, entstammen entweder seiner Entstehungszeit oder sind gegenwärtig publiziert worden. Es wird davon ausgegangen, dass bedeutsame Erkenntnisse aus der Zeit dazwischen die heutigen Texte mitprägten. Als eine der grundlegenden Primärquelle dieser Arbeit soll der Sammelband "Brauchen wir den Beutelsbacher Konsens? Eine Debatte der politischen Bildung" von Benedikt Widmaier und Peter Zorn (vgl. 2016) genannt werden, der die Debatte um den Beutelsbacher Konsens zu seinem vierzigjährigen Jubiläum neu aufzurollen versucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Verhältnis zwischen politischer Bildung und Sachunterricht
- 2.1 Die Verortung politischer Bildung in der Konzeption Sachunterricht
- 2.2 Die politische Bildung im Rahmenlehrplan Sachunterricht Berlin/Brandenburg
- 2.3 Die politische Bildung im Perspektivrahmen Sachunterricht
- 2.4 Zwischenfazit
- 3. Die Entstehungsgeschichte des Beutelsbacher Konsenses
- 3.1 Die politische Bildung im Spannungsfeld von Parteien- und Bildungspolitik
- 3.2 Der Dissens zur politischen Bildung in der Wissenschaft
- 3.2.1 Die Konzeptionen zur politischen Bildung zwischen 1945 und 1970
- 3.2.2 Die politikdidaktische Auseinandersetzung in der Nachkriegszeit
- 3.2.3 Zwischenfazit
- 3.3 Der Befriedungsversuch Beutelsbach
- 3.4 Der Minimalkonsens als Ergebnis von Beutelsbach
- 3.4.1 Das Überwältigungsverbot in der politischen Bildung
- 3.4.2 Das Kontroversitätsgebot in der politischen Bildung
- 3.4.3 Die Schülerorientierung in der politischen Bildung
- 3.5 Der Beutelsbacher Konsens als didaktisches Prinzip politischer Bildungsprozesse
- 4. Eine kritische Reflexion des Beutelsbacher Konsenses
- 4.1 Die kritische Auseinandersetzung mit dem Konsens in der Politikdidaktik
- 4.2 Der Abgleich des Konsenses mit dem Sachunterricht
- 4.3 Die veränderten (gesellschafts-) politischen Lebenswelten
- 4.3.1 Der Wandel der Demokratie zur Postdemokratie
- 4.3.2 Die potenziellen Folgen für kindliche Lebenswelten in der Postdemokratie
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer kritischen Bewertung des Beutelsbacher Konsenses als didaktisches Prinzip der politischen Bildung im Sachunterricht vor dem Hintergrund veränderter (gesellschafts-) politischer Lebenswelten. Ziel der Arbeit ist es, die Relevanz des Beutelsbacher Konsenses im Kontext der gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu hinterfragen.
- Die Verortung des Politischen im Sachunterricht
- Die Entstehungsgeschichte des Beutelsbacher Konsenses im Spannungsfeld von Parteien- und Bildungspolitik sowie der politikdidaktischen Auseinandersetzung in der Nachkriegszeit
- Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Beutelsbacher Konsens im Hinblick auf die veränderten (gesellschafts-) politischen Lebenswelten von Kindern
- Die Relevanz des Beutelsbacher Konsenses für die politische Bildung im Sachunterricht in der Gegenwart
- Die potenziellen Auswirkungen des Wandels der Demokratie zur Postdemokratie auf die Lebenswelten von Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle politische Situation und stellt die Relevanz der politischen Bildung im Kontext veränderter Lebenswelten von Kindern heraus. Kapitel 2 befasst sich mit dem Verhältnis zwischen politischer Bildung und Sachunterricht, indem die Verortung der politischen Bildung in der Konzeption des Sachunterrichts sowie im Rahmenlehrplan und Perspektivrahmen des Sachunterrichts Berlin/Brandenburg untersucht wird. Kapitel 3 beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Beutelsbacher Konsenses, die von einem tiefgreifenden Dissens in der politischen Bildung geprägt ist. Der Konsens wird als Befriedungsversuch in der politikdidaktischen Auseinandersetzung der Nachkriegszeit dargestellt. Kapitel 4 beinhaltet eine kritische Reflexion des Beutelsbacher Konsenses im Hinblick auf seine Relevanz im Kontext veränderter (gesellschafts-) politischer Lebenswelten von Kindern.
Schlüsselwörter
Politische Bildung, Sachunterricht, Beutelsbacher Konsens, Postdemokratie, Lebenswelten von Kindern, Demokratie, politische Sozialisation, Politikdidaktik, Integrationsmöglichkeiten, Familien- und Sozialpolitik, Lügenpresse, Digitalisierung, Globalisierung, Bildungsungerechtigkeit, Rahmenlehrplan, Perspektivrahmen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Beutelsbacher Konsens?
Ein 1976 formulierter Minimalkonsens für die politische Bildung, bestehend aus drei Prinzipien: Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot und Schülerorientierung.
Was bedeutet das „Überwältigungsverbot“?
Lehrkräfte dürfen Schüler nicht mit ihrer eigenen Meinung überrumpeln oder indoktrinieren; die Schüler sollen sich eine eigene Meinung bilden können.
Ist der Beutelsbacher Konsens heute noch zeitgemäß?
Die Arbeit hinterfragt dies kritisch und untersucht, ob der Konsens den veränderten Lebenswelten (Digitalisierung, Globalisierung, Postdemokratie) von Grundschulkindern noch gerecht wird.
Was wird unter „Postdemokratie“ verstanden?
Ein Zustand, in dem demokratische Institutionen zwar formal existieren, die tatsächliche Politik aber zunehmend von Eliten und globalen Märkten statt vom Volk bestimmt wird.
Wie wird politische Bildung im Sachunterricht verortet?
Sie ist fester Bestandteil des Sachunterrichts und zielt darauf ab, Kinder frühzeitig an demokratische Prozesse und gesellschaftliche Mitbestimmung heranzuführen.
- Citation du texte
- Józek Templin (Auteur), 2017, Der Beutelsbacher Konsens im Grundschulunterricht vor dem Hintergrund veränderter (gesellschafts-) politischer Lebenswelten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1357643