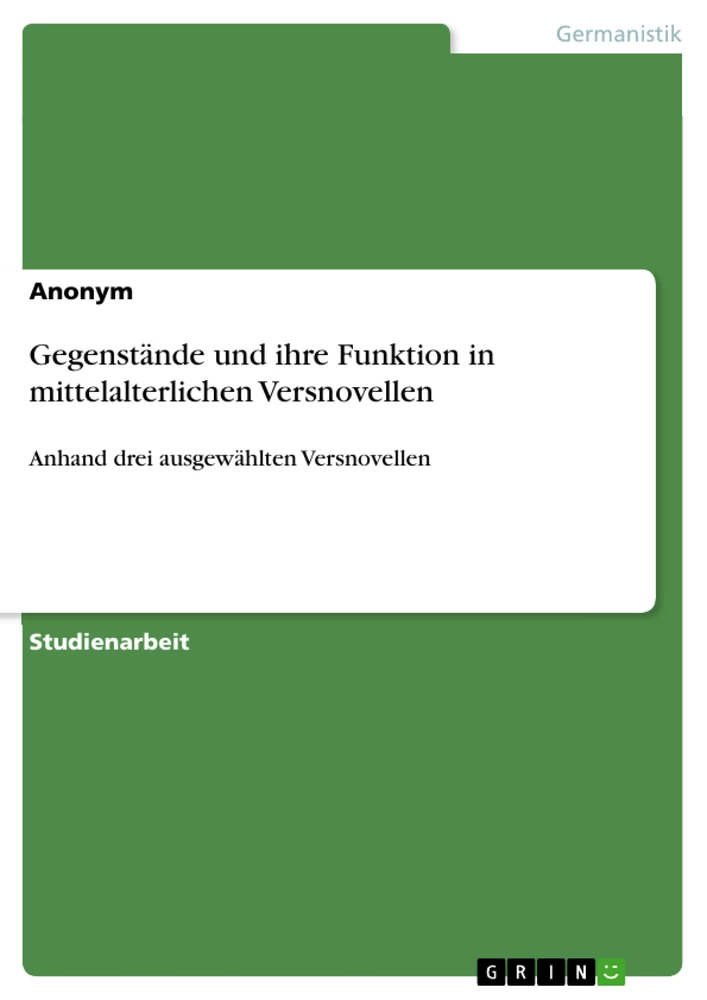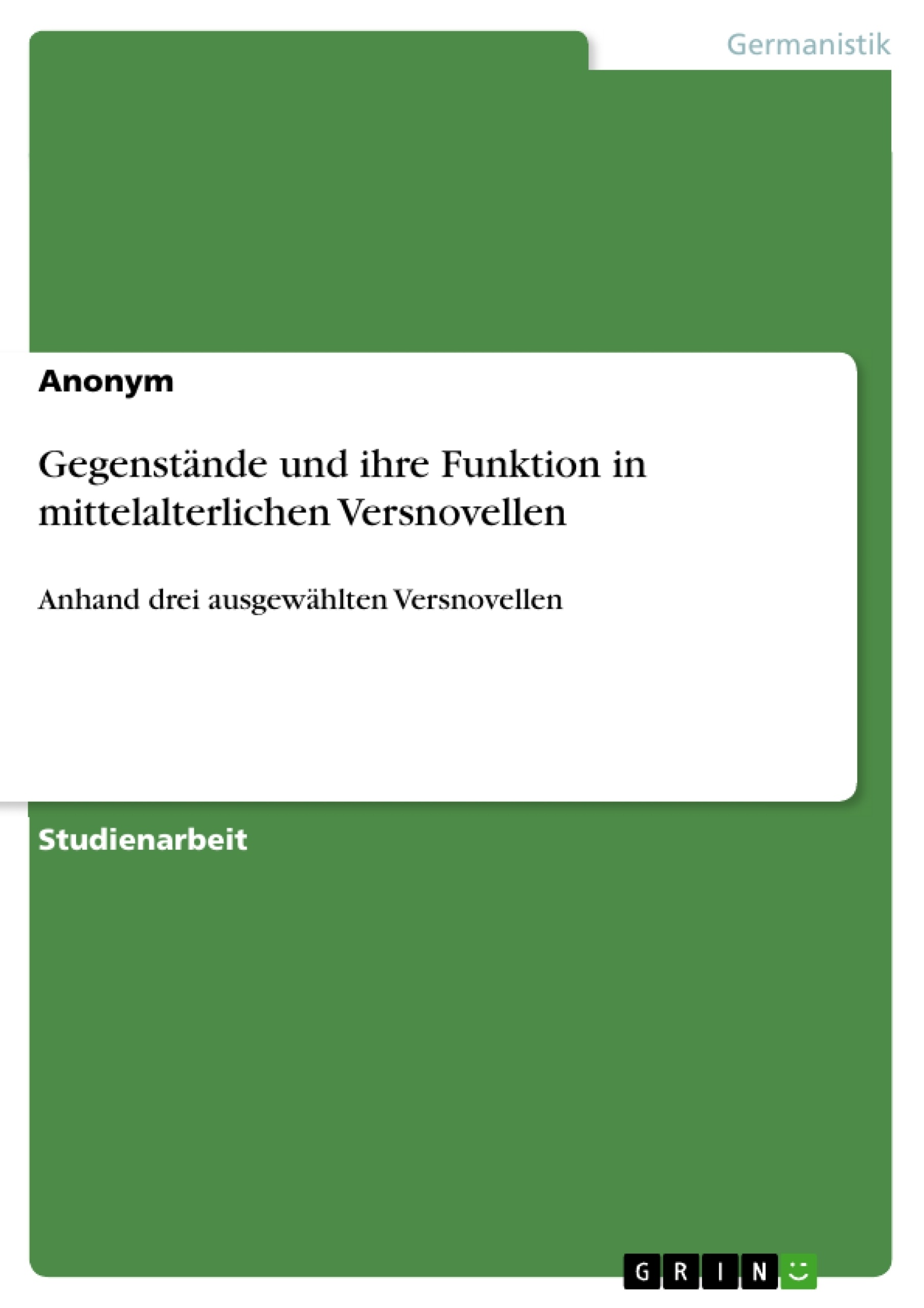Eine Arbeit mit Mären ist gleichzeitig eine Beschäftigung mit der ehelichen Untreue. So ist diese Thematik auch in den vorliegenden Dichtungen zu finden, sie ist eine der beliebtesten Aspekte, um das negative Bild der Beziehung von Mann zu Frau aufzuzeigen. Im Folgenden soll untersucht werden, inwieweit der Gegenstand der List und seine Funktion in Mären thematisiert wird, dies soll anhand der ehelichen Untreue geschehen, welche durch Gewalt und List geprägt ist.
Das Motiv des Ehebruchs, welches Fischer in seinen Studien beleuchtet, ist ein sehr beliebtes in der Märedichtung, etwa ein Drittel der Märe, handelt von Ehebruch. Anhand des Ehebruchmotives und dem damit eingehenden Handlungsgegenstand der List erfolgt eine Untersuchung unter Zuhilfenahme dreier Märedichtungen. Zur weiteren Stütze dient die Forschung von Schirmer, welche sich der Stil- und Motivuntersuchung von mittelhochdeutschen Versnovellen widmet, um den Ehebruch zu analysieren. Die Institution Kirche betitelt Untreue in der Ehe als einen Verstoß gegen das heilige Sakrament der Ehe. Märe haben die Absicht, die Leserschaft zu einem besseren Verhalten zu erziehen oder sie dienen der Unterhaltung.
Beginnend erfolgt eine theoretische Einbettung anhand eines gattungsgeschichtlichen Überblickes, welcher mit der Forschungsliteratur von Fischer und Schimmer erarbeitet wird, um die Ehebruchmotivik zu beleuchten. Im Zuge dessen folgen begriffliche Erklärungen. Die Analyse widmet sich der Untersuchung des Ehebruchs mittels der verschiedenen Primärquellen und deren Erzählinhalte. Abschließend wird in einem Fazit die Funktion der List in den Mären des Strickers festgehalten, anhand wiederkehrender Motive, die in den Textanalysen erarbeitet wurden.
Die Gattung der Märe entwickelt sich ab der Mitte des 13. Jahrhunderts, zunächst ist es im Werk des Strickers zu finden. Später dann sind erste Erscheinungen des Wortes maere zu finden, besonders im Zusammenhang mit epischen Reimpaardichtungen. In neuerer Forschung wird der Begriff Märe als Gattungsbezeichnung für mittelhochdeutsche Schwankerzählungen verwendet, welche im Zeitraum der Jahre 1250 bis 1500 entstanden sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung
- Theoretische Einbettung: Der Ehebruch in Mären
- Textstellenanalyse
- Das heiße Eisen
- Die Rache des Ehemanns
- Der Ritter unter dem Zuber
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Funktion von List und Gegenständen in mittelalterlichen Versnovellen, insbesondere im Kontext der ehelichen Untreue. Sie untersucht, wie diese Elemente die negative Darstellung der Beziehung zwischen Mann und Frau in den ausgewählten Texten verstärken. Die Arbeit analysiert dabei drei verschiedene Mären, um die Thematik des Ehebruchs und seine Beziehung zu List und Gegenständen zu beleuchten.
- Die Rolle von List als Mittel zur Verheimlichung von Ehebruch.
- Die Verwendung von Gegenständen als Symbole und Marker in der Erzählung.
- Die Bedeutung der Störung und Wiederherstellung der gesellschaftlichen Ordnung (ordo) im Zusammenhang mit Ehebruch.
- Die Analyse der verschiedenen Kategorien des Ehebruchs in der Märedichtung.
- Die Verwendung von Beispielen aus der Forschung zur Märedichtung, um die theoretische Einbettung zu verstärken.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Ehebruchs in mittelalterlichen Versnovellen ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar.
- Begriffserklärung: Dieses Kapitel erklärt den Begriff der List und stellt die verschiedenen Kategorien des Ehebruchs in Mären nach Fischer vor. Zudem werden die verschiedenen Erzähltypen der Märe erläutert.
- Textstellenanalyse: Dieser Abschnitt analysiert drei verschiedene Mären: „Das heiße Eisen“, „Die Rache des Ehemanns“ und „Der Ritter unter dem Zuber“. Er untersucht, wie die List und Gegenstände in diesen Texten zum Tragen kommen und welche Bedeutung sie im Kontext der Ehebruchthematik haben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Ehebruchmotivik in mittelalterlichen Versnovellen, insbesondere auf die Funktion von List und Gegenständen. Im Fokus stehen dabei die verschiedenen Kategorien des Ehebruchs nach Fischer, die Rolle der List als Mittel zur Verheimlichung und die Bedeutung der Störung und Wiederherstellung der gesellschaftlichen Ordnung (ordo). Zu den Schlüsselbegriffen zählen: Ehebruch, List, Gegenstand, Märe, ordo, Versnovelle, Fischer, Schirmer, Strickers.
Häufig gestellte Fragen zu mittelalterlichen Versnovellen
Was ist ein "Märe" in der mittelalterlichen Literatur?
Ein Märe ist eine mittelhochdeutsche Verserzählung bzw. Schwankerzählung, die oft moralisierende oder unterhaltende Themen wie Ehebruch behandelt.
Welche Rolle spielt das Motiv der "List" in diesen Erzählungen?
Die List dient meist als Mittel zur Verheimlichung von Untreue oder zur Täuschung des Ehepartners und treibt die Handlung der Versnovellen voran.
Welche Funktion haben Gegenstände in den analysierten Texten?
Gegenstände fungieren als Symbole oder Marker, wie etwa der Zuber im Märe "Der Ritter unter dem Zuber", um die List visuell und handlungstechnisch zu unterstützen.
Was bedeutet der Begriff "ordo" im Kontext des Ehebruchs?
"Ordo" bezeichnet die göttliche und gesellschaftliche Ordnung. Ehebruch gilt als Störung dieser Ordnung, die am Ende der Erzählung oft (ironisch oder gewaltsam) wiederhergestellt wird.
Wer war "Der Stricker"?
Der Stricker war ein bedeutender Dichter des 13. Jahrhunderts, der als Pionier der Gattung Märe gilt und die Ehebruchthematik literarisch prägte.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2022, Gegenstände und ihre Funktion in mittelalterlichen Versnovellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1350833