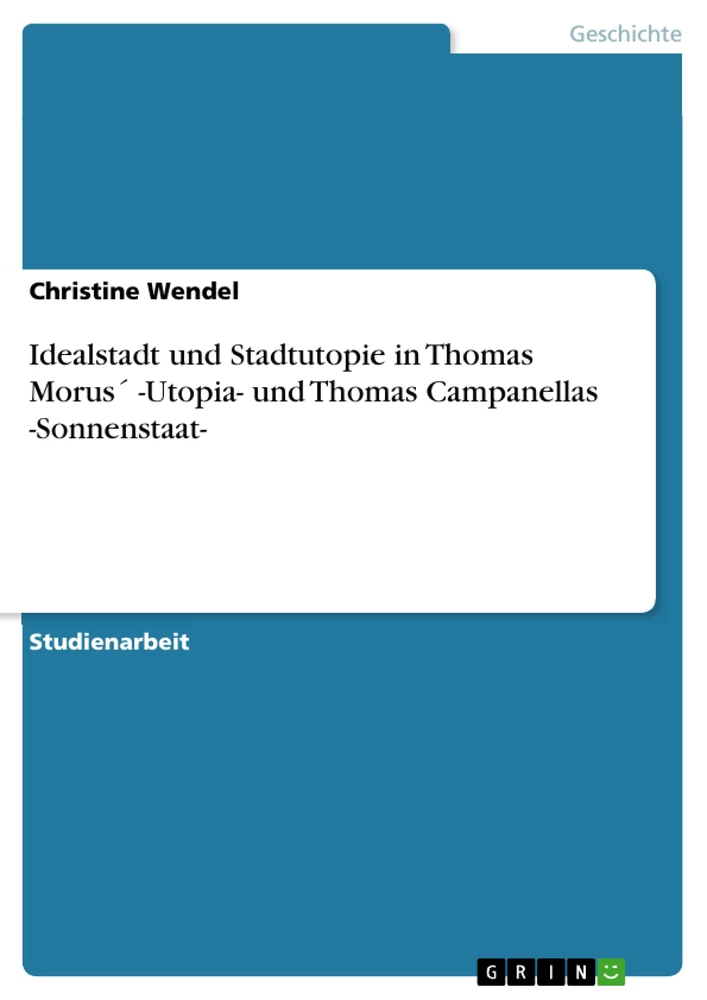Im Jahre 1516 wurde ein Werk veröffentlicht, dass eine neue Gattung einleiten sollte. Mit
seiner ,,Utopia“, oder, wie sie im Original heißt, seiner ,,De optimo rei publicae statu
deque nova insula Utopia” schuf Thomas Morus (1478-1535) eine Schrift, deren Typus
viele Arbeiten nachfolgender Schriftsteller prägte. In dieser Staatsschrift kreierte Morus in
Tradition antiker Staatstheorie, deren Bezugnahme sich bei Morus´ ,,Utopia” auch bei
schriftlichen Auseinandersetzungen mit Platon finden lassen, ein Gemeinwesen, das sich
dadurch hervorhebt, dass es im spiegelbildlichen Gegensatz zu den real existierenden
Missständen seiner Zeit steht. Die Gesellschaft ist angesiedelt auf einer fernen Insel und
wird von einem Weltreisenden namens Hythlodeus beschrieben, der diese besucht haben
soll. Die Gemeinschaft ist unter anderem besonders gekennzeichnet durch
Eigentumslosigkeit, religiöse Toleranz und Selbstverwirklichung durch Bildung. Morus´
Darstellung einer idealen Gesellschaft blieb nicht die einzige. Viele Schriftsteller, wie
Johann Valentin Andreae (1586-1654) oder Francis Bacon (1561-1626) entwarfen in
ihren Werken ihre eigenen Vorstellungen utopischer Gemeinwesen. Auch Thomas
Campanellas (1568-1639) literarische Utopie, ,,Sonnenstaat” stelle ein bedeutendes
Werk der literarischen Utopien dar. Hierin wird ein Staat beschrieben, dessen
Gesellschaft vorwiegend durch die neue Thematik der Naturwissenschaft ebenso wie
durch eine strenge hierarchische Ordnung geprägt wird. Sie wird im Rahmen eines
Dialoges mit einem Großmeister von einem genuesischen Seefahrer geschildert. All diese
erwähnten Utopien versetzen ihre Idealgesellschaft auf eine Insel, auf der sie eine, bzw.
mehrere aber gleiche Städte konstruieren, in denen sich das Leben dieser abspielt. Diese
Stadt ist jedoch mehr, als der bloße Schauplatz des Geschehens. Die Architektur und die
Beschaffenheit veranschaulichen vielmehr die inhaltlichen Fundamente und die
Aussagekraft der Utopien. Die Raumstruktur nimmt also große Bedeutung ein. In dieser
Arbeit möchte ich genau hierauf einzugehen versuchen. Vor allem möchte ich hierbei auf
die Werke Morus´ und Campanellas Bezug nehmen. Über die Beschreibung der
Idealstadt im allgemeinen soll die utopische Stadt bei Morus und anschließend bei
Campanella, sowie deren Relevanz für ihr entworfenes Gemeinwesen dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Utopia als Wegbereiter von Darstellungen idealer Gemeinwesen
- Idealstadt und Stadtutopie in Thomas Morus' „Utopia” und Thomas Campanellas „Sonnenstaat”
- Idealstadt und Stadtutopie
- Allgemeines zum Begriff der Idealstadt
- Formprinzipien der utopischen Idealstadt
- Idealstadt in Thomas Morus' „Utopia”
- Raumstruktur Utopias und Amaurotums
- Räumliche Gestaltung Utopias und Amaurotums in Beziehung zu Inhalt und Aussagekraft
- Idealstadt in Thomas Campanellas „Sonnenstaat”
- Raumstruktur der Sonnenstadt
- Räumliche Gestaltung der Sonnenstadt in Beziehung zu Inhalt und Aussagekraft
- Zusammenfassung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Idealstadt und Stadtutopie in den Werken Thomas Morus' „Utopia“ und Thomas Campanellas „Sonnenstaat”. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der räumlichen Gestaltung der utopischen Städte und deren Beziehung zum Inhalt und zur Aussagekraft der jeweiligen Werke.
- Der Begriff der Idealstadt und seine Bedeutung in der literarischen Utopie
- Die Formprinzipien der utopischen Idealstadt, insbesondere Geometrisierung, Zentrisierung und Geschlossenheit
- Die Raumstruktur und die räumliche Gestaltung der Stadt Utopia in Morus' Werk
- Die Raumstruktur und die räumliche Gestaltung der Sonnenstadt in Campanellas Werk
- Die Relevanz der Architektur und der Stadtgestaltung für die Darstellung des idealen Gemeinwesens in beiden Werken
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet den Einfluss von Thomas Morus' „Utopia“ auf die Entwicklung der literarischen Utopie und stellt die grundlegenden Elemente seiner idealen Gesellschaft vor.
- Das zweite Kapitel definiert den Begriff der Idealstadt und erläutert die Formprinzipien, die in der Gestaltung utopischer Städte zum Ausdruck kommen.
- Im dritten Kapitel wird die Raumstruktur Utopias und Amaurotums in Thomas Morus' „Utopia“ analysiert, wobei die Verbindung von räumlicher Gestaltung und inhaltlicher Botschaft im Mittelpunkt steht.
Schlüsselwörter
Idealstadt, Stadtutopie, Thomas Morus, Utopia, Thomas Campanella, Sonnenstaat, Raumstruktur, Architektur, Stadtgestaltung, Gesellschaftsordnung, utopisches Gemeinwesen, Formprinzipien, Geometrisierung, Zentrisierung, Geschlossenheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Thomas Morus' Werk „Utopia“?
Morus begründete 1516 eine neue Gattung. Sein Werk beschreibt eine ideale Gesellschaft auf einer fernen Insel, die als Gegenentwurf zu den realen Missständen seiner Zeit dient, geprägt durch Eigentumslosigkeit und Bildung.
Wie unterscheidet sich Campanellas „Sonnenstaat“ von Morus' „Utopia“?
Während Morus soziale Gerechtigkeit betont, ist Campanellas Sonnenstaat stark von Naturwissenschaften und einer strengen, hierarchischen Ordnung sowie einer geometrischen Stadtstruktur geprägt.
Welche Rolle spielt die Architektur in utopischen Städten?
Die Raumstruktur ist mehr als nur Kulisse; sie veranschaulicht die inhaltlichen Fundamente der Utopie. Geometrie, Zentrisierung und Geschlossenheit spiegeln die Ordnung und Stabilität der idealen Gesellschaft wider.
Was sind die Formprinzipien einer utopischen Idealstadt?
Zentrale Prinzipien sind die Geometrisierung (oft kreisförmig oder quadratisch), die Zentrisierung auf ein wichtiges Gebäude und die räumliche Geschlossenheit nach außen.
Warum nutzen Utopisten oft das Motiv der Insel?
Die Insel ermöglicht eine isolierte, abgeschlossene Entwicklung des idealen Staates, fernab von schädlichen Einflüssen der realen Welt, und unterstreicht den Modellcharakter des Entwurfs.
- Quote paper
- Christine Wendel (Author), 2003, Idealstadt und Stadtutopie in Thomas Morus´ -Utopia- und Thomas Campanellas -Sonnenstaat-, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13493