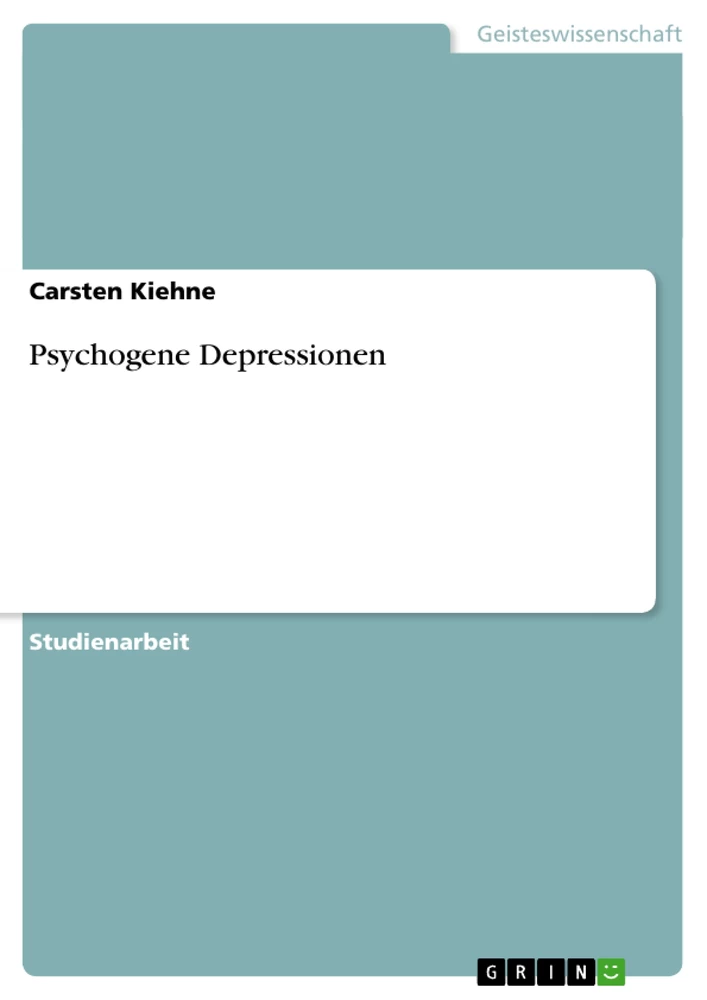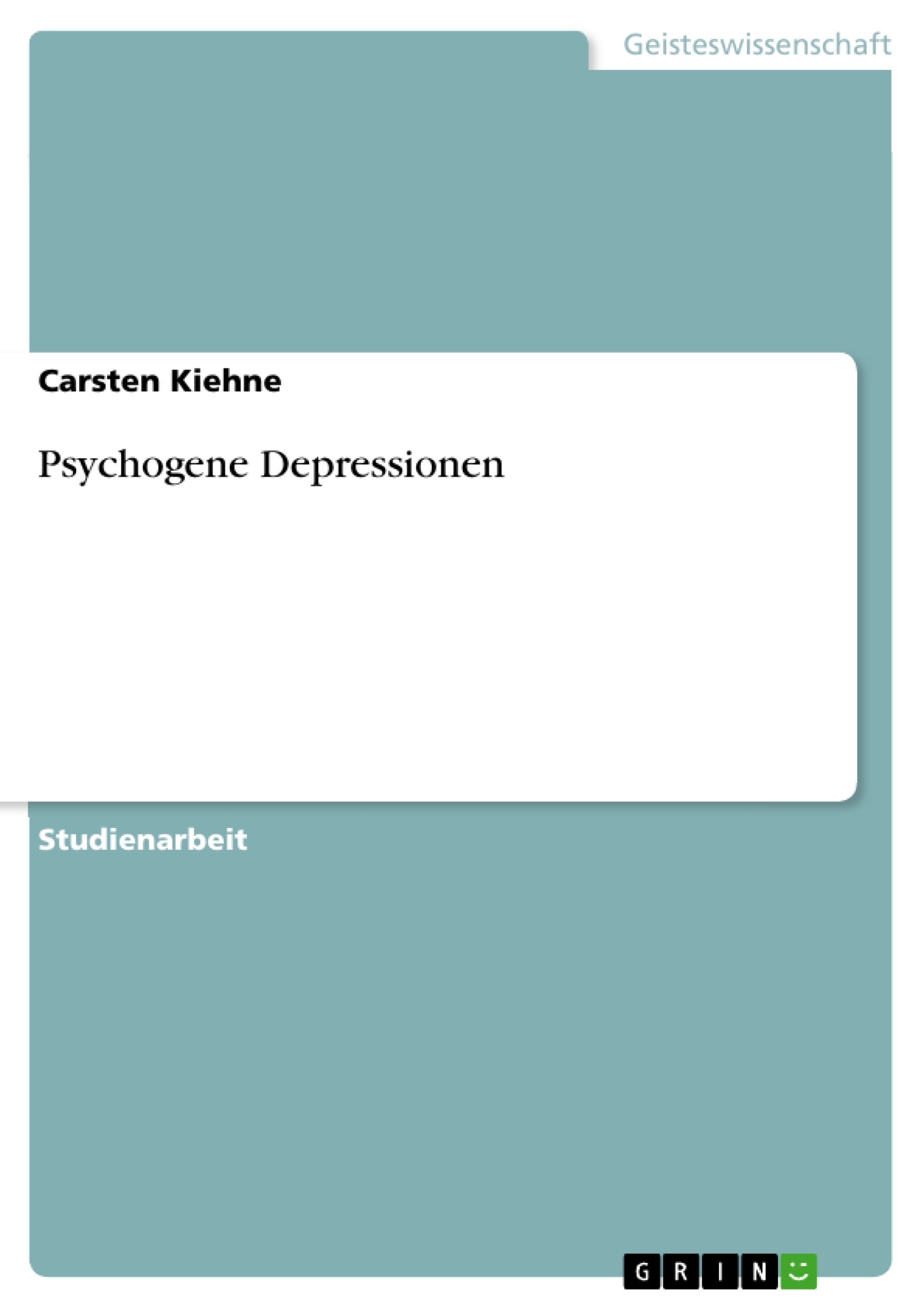Ich habe das Thema der "Psychogenen Depression" ausgewählt, da diese psychische Störung, in der öffentlichen Meinung, den Ruf genießt eine Volkskrankheit zu sein. Mein Interesse weckt jenes aus mehreren Gründen. Zum einen ist eine Krankheit, die sehr verbreitet ist und voraussichtlich an Häufigkeit zunimmt, mit angrenzender Wahrscheinlichkeit auch Thema meines späteren, sozialarbeiterischen Klientels. Und zum anderen, kann es nur von Vorteil sein, Symptome, Verlauf und Therapiemöglichkeiten zu kennen, um etwaige eigene Krankheitszeichen, die in die Richtung depressiver Verstimmungszustände gehen, frühzeitig zu erkennen.
Aus dem Gesamtkomplex der Depression, habe ich überwiegend die psychisch bedingten, depressiven Störungen herausgenommen. Das ermöglicht mir, in diesem sehr umfangreichen Themengebiet nicht nur oberflächliche Erläuterungen und Zusammenfassungen darzustellen, sondern teils einzelne Zusammenhänge tiefgründig zu bearbeiten. Des Weiteren glaube ich, explizit für psychogene Depressionen mehr alternative Handlungsweisen und therapeutisch/ sozialarbeiterisch anwendbare Interventionen hervorheben zu können.
Im ersten Kapitel möchte ich einen Überblick über die differenzierten Depressionsarten geben.
Kapitel Zwei bezieht sich dann speziell auf die psychogenen Depressionen und ihre Unterformen.
Im dritten Abschnitt (Epidemiologie), möchte ich die tatsächlichen Zahlen herausarbeiten und die Fragen beantworten, ob depressive Erkrankungen tatsächlich eine Prävalenz im Sinne einer „Volkskrankheit“ aufweisen und, ob sich ihre Auftrittshäufigkeit noch vermehrt.
Die Vorzeichen einer Depression, die klassische Symptomatik und Anzeichen, die auf einen geplanten Suizid hinweisen, erläutere ich in Kapitel vier.
Der fünfte Teil dieser Arbeit, dient mir dazu, auf psychologische (psychoanalytische, kognitive und humanistische Theorien) und persönlichkeitstheoretische Erklärungsansätze näher einzugehen.
Abschnitt sechs beschreibt die diversen Behandlungsweisen für Depressionen, wobei die Psychotherapie, die Pharmakotherapie, die Soziotherapie und die Physiotherapie nach Wirkungsweise, Indikation und Kontraindikation (Nebenwirkungen) aufgeschlüsselt werden.
Im letzten Kapitel versuche ich Sinn und Möglichkeiten einer salutogenen, anstatt einer pathogenen, Annäherung an die Thematik aufzuzeigen. Hier bediene ich mich der Konzepte der Gesundheitsförderung, der Salutogenese und der Resilienz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abgrenzung
- Verstimmungszustände
- Trauer
- Begriffsbestimmung Depression
- Ätiologische Betrachtungsweise
- Deskriptive Betrachtungsweise
- Psychogene Depressionen
- Epidemiologie
- Symptomatik
- Vorzeichen der Depression
- Klassische Symptomatik
- Wer ist vom Suizid gefährdet?
- Erklärungsansätze
- Psychologische Erklärungsansätze
- Die psychoanalytische Ansicht
- Kognitive Theorien
- Humanistische Theorien
- Persönlichkeitstheoretische Ansätze
- Lebensereignisse als Depressionsauslöser
- Multifaktorieller Ansatz
- Psychologische Erklärungsansätze
- Depressionstherapien
- Psychotherapie
- Klassifikation und Wirksamkeit
- Indikation und Nebenwirkungen
- Pharmakotherapie
- Klassifikation und Wirkungsweise
- Indikation
- Kontraindikation
- Weitere Gefahren
- Nicht-Psychopharmakonische Medikation
- Physiotherapie
- Methodik und Wirksamkeit
- Indikation und Nebenwirkungen
- Soziotherapie
- Ergänzende Therapien
- Psychotherapie
- Gesundheitsförderung
- Begriffsdifferenzierung
- Modell der Salutogenese
- Resilienzfaktoren
- Glaube als Einflussfaktor auf die Heilung
- Selbstwertgefühl als Entscheidungsgröße
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit psychogenen Depressionen, untersucht deren Abgrenzung zu ähnlichen Zuständen und beleuchtet verschiedene Erklärungsansätze sowie Therapiemethoden. Das Ziel ist, ein umfassendes Verständnis dieser Erkrankung zu vermitteln und alternative Handlungsweisen aufzuzeigen.
- Abgrenzung psychogener Depressionen von ähnlichen Zuständen wie Verstimmungen und Trauer
- Epidemiologische Daten und Verbreitung psychogener Depressionen
- Psychologische und persönlichkeitsbezogene Erklärungsansätze für psychogene Depressionen
- Vielfalt an Therapieansätzen (Psychotherapie, Pharmakotherapie, Soziotherapie, Physiotherapie)
- Salutogenetische Ansätze in der Behandlung und Gesundheitsförderung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung beschreibt die Motivation der Verfasserin, sich mit psychogenen Depressionen auseinanderzusetzen, und umreißt den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf psychisch bedingten Depressionen, um eine tiefergehende Analyse zu ermöglichen und alternative Interventionsmöglichkeiten hervorzuheben.
Abgrenzung: Dieses Kapitel differenziert zwischen Depression und ähnlichen Zuständen wie Verstimmungszuständen und Trauer. Es wird deutlich gemacht, dass Verstimmungszustände normale Reaktionen auf alltägliche Belastungen sind, während Trauer ein natürlicher Prozess des Abschiednehmens ist. Der Unterschied wird anhand von Dauer, Intensität und Erleben erläutert, wobei die fließenden Übergänge zwischen Trauer und Depression hervorgehoben werden.
Psychogene Depressionen: (Kapitel fehlt im Auszug, Zusammenfassung nicht möglich)
Epidemiologie: (Kapitel fehlt im Auszug, Zusammenfassung nicht möglich)
Symptomatik: (Kapitel fehlt im Auszug, Zusammenfassung nicht möglich)
Erklärungsansätze: (Kapitel fehlt im Auszug, Zusammenfassung nicht möglich)
Depressionstherapien: (Kapitel fehlt im Auszug, Zusammenfassung nicht möglich)
Gesundheitsförderung: (Kapitel fehlt im Auszug, Zusammenfassung nicht möglich)
Schlüsselwörter
Psychogene Depressionen, Abgrenzung, Trauer, Verstimmungszustände, Epidemiologie, Symptomatik, Psychologische Erklärungsansätze, Depressionstherapien, Psychotherapie, Pharmakotherapie, Soziotherapie, Physiotherapie, Gesundheitsförderung, Salutogenese, Resilienz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Psychogene Depressionen"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit befasst sich umfassend mit psychogenen Depressionen. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Abgrenzung zu ähnlichen Zuständen (Verstimmungen, Trauer), eine Untersuchung verschiedener Erklärungsansätze (psychologisch, persönlichkeitsbezogen), eine Beschreibung verschiedener Therapiemethoden (Psychotherapie, Pharmakotherapie, Soziotherapie, Physiotherapie) und Abschnitte zur Gesundheitsförderung und Salutogenese. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Erkrankung und dem Aufzeigen alternativer Handlungsweisen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Abgrenzung psychogener Depressionen von ähnlichen Zuständen, epidemiologische Daten zur Verbreitung, psychologische und persönlichkeitsbezogene Erklärungsansätze, vielfältige Therapieansätze, sowie salutogenetische Ansätze in der Behandlung und Gesundheitsförderung. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel.
Wie wird die Abgrenzung zu ähnlichen Zuständen vorgenommen?
Das Kapitel "Abgrenzung" differenziert zwischen Depression und ähnlichen Zuständen wie Verstimmungszuständen und Trauer. Es werden Unterschiede in Dauer, Intensität und Erleben erläutert, wobei die fließenden Übergänge zwischen Trauer und Depression hervorgehoben werden. Verstimmungszustände werden als normale Reaktionen auf alltägliche Belastungen beschrieben, während Trauer als natürlicher Prozess des Abschiednehmens dargestellt wird.
Welche Erklärungsansätze für psychogene Depressionen werden vorgestellt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Erklärungsansätze für psychogene Depressionen. Obwohl die Details im Auszug nicht vollständig enthalten sind, wird deutlich, dass sowohl psychologische (psychoanalytische, kognitive, humanistische, persönlichkeitsbezogene Ansätze) als auch biologische und multifaktorielle Ansätze berücksichtigt werden.
Welche Therapiemethoden werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt eine Vielzahl von Therapiemethoden für Depressionen, darunter Psychotherapie (mit Klassifizierung, Wirksamkeit, Indikation und Nebenwirkungen), Pharmakotherapie (einschließlich Klassifizierung, Wirkungsweise, Indikation, Kontraindikation, weiteren Gefahren und nicht-psychopharmakonischer Medikation), Physiotherapie (mit Methodik, Wirksamkeit, Indikation und Nebenwirkungen), Soziotherapie und ergänzende Therapien.
Welche Rolle spielt die Gesundheitsförderung?
Der Abschnitt zur Gesundheitsförderung behandelt die Begriffsdifferenzierung, das Modell der Salutogenese und Resilienzfaktoren (Glaube und Selbstwertgefühl als Einflussfaktoren auf die Heilung). Es wird also nicht nur die Behandlung der Depression, sondern auch die Förderung der psychischen Gesundheit im Allgemeinen betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter zur Beschreibung des Inhalts sind: Psychogene Depressionen, Abgrenzung, Trauer, Verstimmungszustände, Epidemiologie, Symptomatik, Psychologische Erklärungsansätze, Depressionstherapien, Psychotherapie, Pharmakotherapie, Soziotherapie, Physiotherapie, Gesundheitsförderung, Salutogenese, Resilienz.
Welche Kapitel sind im Auszug nicht vollständig enthalten?
Die Kapitel "Psychogene Depressionen", "Epidemiologie", "Symptomatik", "Erklärungsansätze", "Depressionstherapien" und "Gesundheitsförderung" sind im vorliegenden Auszug nicht vollständig enthalten, daher sind detaillierte Zusammenfassungen dieser Kapitel nicht möglich.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge Carsten Kiehne (Autor:in), 2006, Psychogene Depressionen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134502