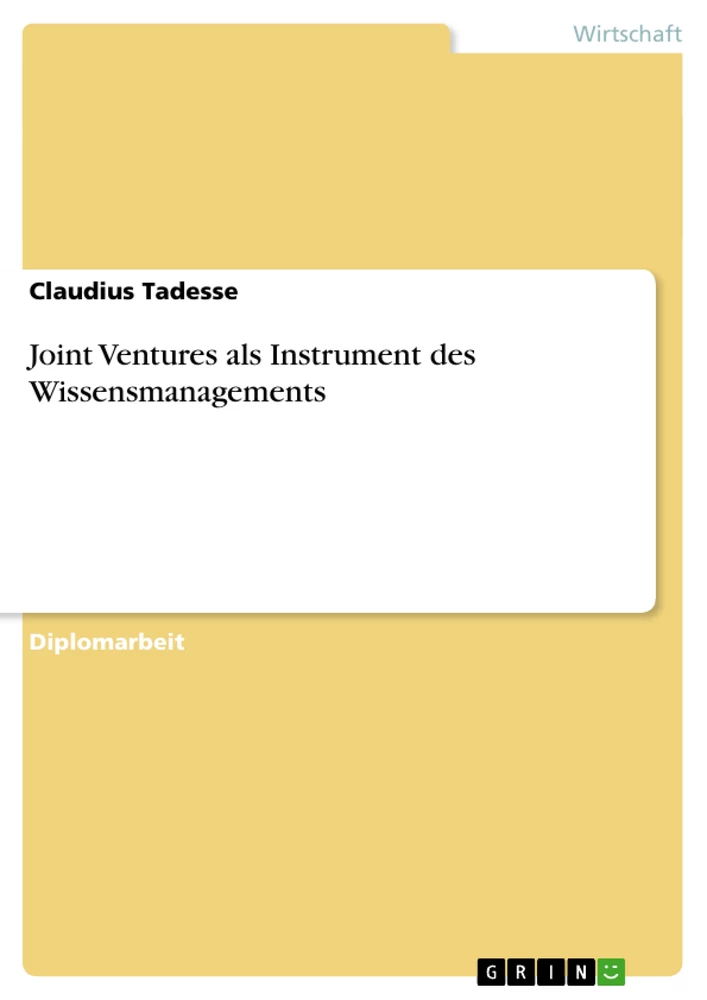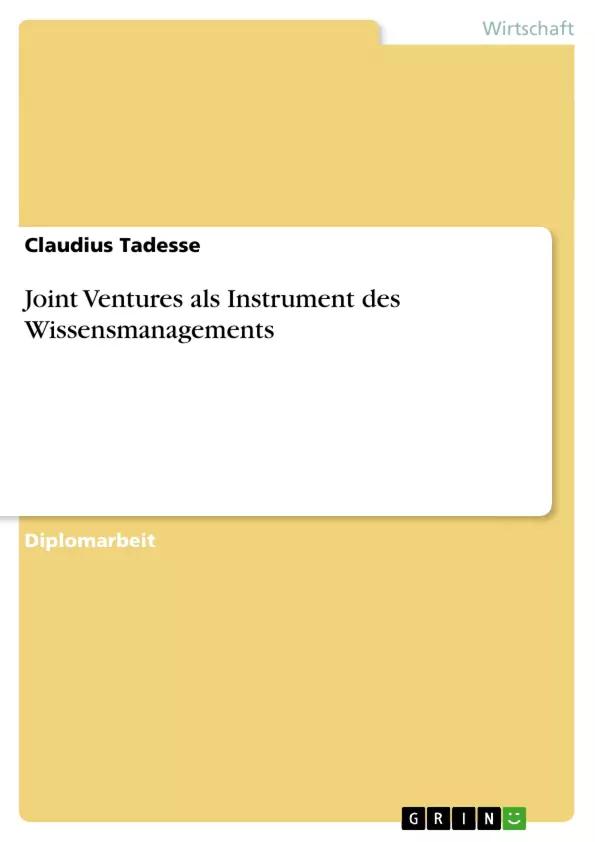In den letzten Jahrzehnten hat die Ressource Wissen zunehmend an Bedeutung gewonnen.
In diesem Zusammenhang wird auch der Übergang von der Industriegesellschaft
zur Wissens- bzw. Informationsgesellschaft postuliert.1 In der postindustriellen Gesellschaft
spielt Wissen im Vergleich zu Arbeit und Kapital eine immer wichtigere Rolle im
Kampf um Wettbewerbsvorteile.2 Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich das weltweit
vorhandene Wissen exponentiell vermehrt, in Folge dessen ist alle fünfeinhalb Jahre
mit einer Verdopplung des weltweit vorhandenen Wissens zu rechnen.3
Wissen kann, wenn es fest in der Organisation verwurzelt ist, zu einer Kernkompetenz
werden, da es aufgrund seiner kausalen Ambiguität als schwer imitierbar gilt. Die fortwährende
Verkürzung von Produktlebenszyklen, bei gleichzeitig zunehmender Aufspaltung
der Gesellschaft in immer heterogenere Splittergruppen, trägt dazu bei das Wissensvorsprünge
zu einem immer wichtigeren Wettbewerbsfaktor werden. Wissen über
Absatzmärkte, einzelne Kundengruppen, Produktionstechnologien, Marketingmaßnahmen
und Forschungs-Know-how kann, wenn es fest in der Organisation verwurzelt ist,
zum Alleinstellungsmerkmal werden. Da die potentiell erwerbbare Menge an Wissen
von einzelnen Unternehmen und erst recht von einzelnen Individuen nicht mehr erfassbar
ist, wird es umso wichtiger, dass Unternehmen für sie relevantes Wissen effektiv
managen.
Gleichzeitig schreitet die Internationalisierung, bzw. Globalisierung der Wirtschaft in
einem hohen Tempo voran. Unternehmen aus Schwellenländern wie Indien oder China
wandeln sich von der „billigen Werkbank“ des „Westens“ zu ernst zu nehmenden Konkurrenten,
da sich die „technologische Lücke“ und somit auch ein Stück weit die Wissenslücke
zwischen den Ländern schließt. Durch die fortwährende Angleichung der
technologischen Produktionsmöglichkeiten bleibt Unternehmen oft nur die Möglichkeit
über die effektive Nutzung von Wissen im nationalen und internationalen Wettbewerb
zu bestehen.
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS:
1 EINLEITUNG
2 WISSEN UND WISSENSMANAGEMENT
2.1 VON ZEICHEN ZUM WISSEN
2.2 VON WISSEN ZUM WISSENSMANAGEMENT
2.3 WISSENSARTEN UND –EIGENSCHAFFTEN
2.3.1 EXPLIZITES UND IMPLIZITES WISSEN
2.3.2 EMBODIED UND DISEMBODIED KNOWLEDGE
2.3.3 EMBEDDED UND MIGRATORY KNOWLEDGE
2.4 WISSEN: INDIVIDUELL VS. KOLLEKTIV (KANN WISSEN KOLLEKTIV SEIN?)
2.5 WISSENSMANAGEMENT ALS PROZESSMODELL
2.6 ZWISCHENFAZIT
3 JOINT VENTURES
3.1 TRANSAKTIONSKOSTENANSATZ
3.2 JOINT VENTURES ALS ORGANISATIONSFORM ZWISCHEN MARKT UND HIERARCHIE
3.3 DAS JOINT VENTURE: DEFINITION UND FORMEN
3.4 ÜBERBLICK ZUR AKTUELLE VERBREITUNG VON JOINT VENTURES
3.5 KONTROLLE: EINFLUSSFAKTOREN, DOMÄNE UND ARTEN
3.6 AUSGEWÄHLTE JOINT VENTURE-KONTROLLMECHANISMEN
3.7 ZWISCHENFAZIT
4 JOINT VENTURES, KONTROLLMECHANISMEN UND WISSENSMANAGEMENT
4.1 LITERATURÜBERBLICK: JOINT VENTURES UND WISSEN
4.2 WISSENSMANAGEMENT IM JOINT VENTURE
4.2.1 WISSENSGENERIERUNG & WISSENSAKQUISITION
4.2.2 WISSENSTRANSFER
4.3 KONTROLLINSTRUMENTE UND IHR EINFLUSS AUF DAS WISSENSMANAGEMENT
4.4 KRITISCHE WÜRDIGUNG
5 SCHLUSSBETRACHTUNG
LITERATURVERZEICHNIS:
VERWENDETE EMPIRISCHE STUDIEN:
Abbildungsverzeichnis:
Abbildung 1: Begriffshierarchie - Zeichen, Daten, Informationen und Wissen
Abbildung 2: Motive und Ziele der Joint Venture Gründung
Abbildung 3: Arten von Unternehemenskooperationen 2003
Abbildung 4: Joint Venture-Gründungen 1990-2000
1 Einleitung
In den letzten Jahrzehnten hat die Ressource Wissen zunehmend an Bedeutung gewon-nen. In diesem Zusammenhang wird auch der Übergang von der Industriegesellschaft zur Wissens- bzw. Informationsgesellschaft postuliert.[1] In der postindustriellen Gesell-schaft spielt Wissen im Vergleich zu Arbeit und Kapital eine immer wichtigere Rolle im Kampf um Wettbewerbsvorteile.[2] Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich das welt-weit vorhandene Wissen exponentiell vermehrt, in Folge dessen ist alle fünfeinhalb Jah-re mit einer Verdopplung des weltweit vorhandenen Wissens zu rechnen.[3]
Wissen kann, wenn es fest in der Organisation verwurzelt ist, zu einer Kernkompetenz werden, da es aufgrund seiner kausalen Ambiguität als schwer imitierbar gilt. Die fort-währende Verkürzung von Produktlebenszyklen, bei gleichzeitig zunehmender Aufspal-tung der Gesellschaft in immer heterogenere Splittergruppen, trägt dazu bei das Wis-sensvorsprünge zu einem immer wichtigeren Wettbewerbsfaktor werden. Wissen über Absatzmärkte, einzelne Kundengruppen, Produktionstechnologien, Marketingmaßnah-men und Forschungs-Know-how kann, wenn es fest in der Organisation verwurzelt ist, zum Alleinstellungsmerkmal werden. Da die potentiell erwerbbare Menge an Wissen von einzelnen Unternehmen und erstrecht von einzelnen Individuen nicht mehr erfass-bar ist, wird es umso wichtiger, dass Unternehmen für sie relevantes Wissen effektiv managen.
Gleichzeitig schreitet die Internationalisierung, bzw. Globalisierung der Wirtschaft in einem hohen Tempo voran. Unternehmen aus Schwellenländern wie Indien oder China wandeln sich von der „billigen Werkbank“ des „Westens“ zu ernst zu nehmenden Kon-kurrenten, da sich die „technologische Lücke“ und somit auch ein Stück weit die Wis-senslücke zwischen den Ländern schließt. Durch die fortwährende Angleichung der technologischen Produktionsmöglichkeiten bleibt Unternehmen oft nur die Möglichkeit über die effektive Nutzung von Wissen im nationalen und internationalen Wettbewerb zu bestehen.
Neben dem Management von bereits in der Organisation vorhandenem Wissen haben Unternehmen dabei die Wahl neues Wissen intern zu generieren, oder es von externen Quellen zu akquirieren. In diesem Zusammenhang spielen kooperative Unternehmens-formen wie Unternehmensnetzwerke, Lizenzabkommen, Strategische Allianzen und Joint Ventures eine zunehmend wichtige Rolle.[4] Die Gründung eines Joint Ventures ist, da sie mit dem Aufbau einer rechtlich eigenständigen Tochterorganisation einhergeht, mit einem mittel- bis langfristigen Kooperationszeitraum verbunden. Aufgrund der zu-mindest mittelfristigen Perspektive scheint das Joint Venture besonders gut als Vehikel für die kooperative Generierung neuen Wissens bzw. die Aneignung von Wissen des Partnerunternehmens geeignet zu sein. Aus diesem Grund ist das Joint Venture als Instrument des Wissensmanagements Forschungsgegenstand dieser Arbeit.
Ziel dieser Arbeit ist es, den organisationalen Wissensmanagementprozess auf den in-terorganisationalen Kontext zu übertragen. In diesem Zusammenhang werden insbeson-dere die im Joint Venture verwendeten Kontrollmechanismen betrachtet. Kontrolle bzw. die zur Erlangung von Kontrolle eingesetzten Kontrollmechanismen werden untersucht, da ihnen die Fähigkeit zugesprochen wird, den organisationalen Wissensfluss zu mana-gen.[5] Die im Joint Venture eingesetzten Kontrollmechanismen beeinflussen die Art und Weise wie Wissen akquiriert, verteilt, interpretiert und zum Erreichen der Organisati-onsziele eingesetzt wird.[6] Im Rahmen dieser Arbeit wird daher die Wirkung der im Joint Venture eingesetzten Kontrollmechanismen auf die Prozesse der Wissensgenerie-rung, Wissensakquisition und den Wissenstransfer betrachtet.
Im ersten Teil der Arbeit (Kapitel 2) werden einige zentrale Begriffe eingeführt. Zu die-sem Zweck wird zunächst Wissen von Informationen, Daten und Zeichen abgegrenzt, um darauf folgend Wissen, Wissensbasis und Wissensmanagement als Management-funktion, definieren zu können. Zudem werden einige in der Wissensmanagement-Literatur häufig genannte Arten von Wissen vorgestellt. Der Abschnitt endet mit einem kurzen Überblick über den Wissensmanagementprozess. Im Mittelpunkt des 3. Kapitels steht das Joint Venture als kooperative Organisationsform. Zunächst erfolgt eine Ein-führung in den Transaktionskostenansatz, der eine transaktionskostentheoretische Erklä-rung für das Zustandekommen von Joint Ventures ermöglicht. Daraufhin wird das Joint Venture als Organisationsform definiert und es folgen aktuelle Zahlen zur Verbreitung von Joint Ventures. Der letzte Teil des Kapitels ist der Joint Venture-Kontrolle als Ma-nagementfunktion gewidmet. Zunächst werden Einflussfaktoren und verschiedene For-men der Kontrolle im Joint Venture-Kontext beschrieben. Daran angeschlossen ist eine ausführliche Darstellung ausgesuchter Joint Venture-Kontrollmechanismen. Ziel des 4. Kapitels ist die Synthese aus den vorangegangenen Teilen der Arbeit. Zunächst erfolgt ein Literaturüberblick, der einen Einblick in verschiedene Forschungsströme und den derzeitigen Stand der Forschung im Bereich Joint Ventures und Wissen bzw. Wissens-management gibt. Daraufhin werden die Wissensmanagementschritte: Wissensgenerie-rung, Wissensakquisition und Wissenstransfer betrachtet. Eine ausführliche Diskussion der im 3. Kapitel vorgestellten Kontrollmechanismen im Zusammenhang mit den ge-nannten Wissensmanagementschritten beendet den Abschnitt. Die Arbeit wird mit ei-nem Fazit und Vorschlägen für zukünftige Forschungstätigkeiten abgeschlossen.
2 Wissen und Wissensmanagement
Im folgenden Kapitel wird der in dieser Arbeit verwendete Wissensbegriff konzeptuali-siert, neben der Definition von „Wissen“ werden weitere für diese Arbeit als zentrale betrachtete Begriffe eingeführt, sowie verschiedenen Arten von Wissen vorgestellt. Dem folgt die Vorstellung von „Wissensmanagement“ als Managementfunktion. Ab-schließend wird der Wissensmanagementprozess dargestellt.
2.1 Von Zeichen zum Wissen
„Wissen“ ist Gegenstand verschiedenster Wissenschaftsdisziplinen, wie beispielsweise der Philosophie, Psychologie oder Soziologie[7]. Da innerhalb dieser Disziplinen ver-schiedene Erkenntnissinteressen verfolgt werden, ist eine einheitliche Definition des Wissensbegriffes über die Disziplingrenze hinweg nicht gegeben.[8] Versuche „Wissen“ zu definieren, gehen bereits auf die griechischen Autoren der Antike zurück, so geht Platon im „Theätet“ bereits der Frage nach dem Wesen des Wissens nach.[9]
Rehäuser/Krcmar nähern sich der Definition von „Wissen“ mittels einer Begriffshierar-chie die zwischen Zeichen, Daten, Informationen und Wissen unterscheidet. Abbildung 1 zeigt den Zusammenhang der verschiedenen Ebenen der Begriffshierarchie als Anrei-cherungsprozess. Auf der untersten Ebene stehen Zeichen, die durch die Verwendung von Syntaxregeln zu Daten werden. Daten können aus einzelnen Zeichen, aber auch aus einer Folge von zusammenhängenden Zeichen bestehen, über deren Verwendungs-zweck keine Aussage besteht. Daten werden im Kontext eines Problemzusammenhangs zu Informationen angereichert. Auf der obersten Stufe der Begriffshierarchie steht Wis-sen, welches entsteht, wenn Individuen Informationen sinnvoll vernetzen.[10]
Romhardt nimmt von der strikten Trennung der einzelnen Ebenen Abstand, stattdessen schlägt er ein Kontinuum von Daten, Informationen und Wissen vor, welches eher dem Entwicklungsprozess von Zeichen zu Daten entsprechen soll.[11]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Begriffshierarchie - Zeichen, Daten, Informationen und Wissen[12]
Tuomi kommt dagegen zu der Schlussfolgerung, dass eine Begriffshierarchie im Sinne von Rehäuser/Krcmar nicht existiert, da Wissen die Grundlage für Informationen und Daten bildet. Die von ihm entwickelte Begriffshierarchie ist demnach genau der Gegen-satz zur Begriffshierarchie von Rehäuser und Krcmar. Wird die Bedeutungsstruktur, die individuellem Wissen zu Grunde liegt, mittels einer kognitiven Leistung in einem lin-guistisch-konzeptuellen Kontext artikuliert, spricht man von Information. Wenn Infor-mationen in atomare Teilchen ohne eigeneständige Bedeutung geteilt werden, liegen Daten vor.[13] Sowohl die Argumentation von Rehäuser/Krcmar als auch die von Tuomi leisten einen Beitrag zur Unterscheidung zwischen Wissen und Informationen, Daten und Zeichen. Einerseits wird Wissen für die Erstellung von Informationen benötigt, andererseits bilden Informationen die Grundlage für neues Wissen.
2.2 Von Wissen zum Wissensmanagement
Nachfolgend werden zwei in der Literatur häufig verwendete Wissensdefinitionen vor-gestellt, bevor über die organisationale Wissensbasis eine Annäherung an das Wissens-management als Managementfunktion erfolgt. Nach Probst et al. ist Wissen stets an Personen gebunden: „Wissen bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkei-ten, die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen. Dies umfasst sowohl theoreti-sche Erkenntnisse als auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen. Wis-sen stützt sich auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen jedoch immer an Personen gebunden. Es wird von Individuen konstruiert und repräsentiert deren Er-wartungen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge.“[14]
Davenport und Prusak entwerfen dagegen eine Definition bei der neben Personen auch andere Medien als Wissensträger fungieren: „Wissen ist eine fliessende Mischung aus strukturierten Erfahrungen, Wertvorstellungen, Kontextinformationen und Fachkenn-tnissen, die in ihrer Gesamtheit einen Strukturrahmen zur Beurteilung und Eingliede-rung neuer Erfahrungen und Informationen bietet. Entstehung und Anwendung von Wissen vollziehen sich in den Köpfen der Wissensträger. In Organisationen ist Wissen häufig nicht nur in Dokumenten oder Speichern enthalten, sondern erfährt auch eine allmähliche Einbettung in organisationale Routinen, Prozesse, Praktiken und Nor-men“.[15]
In der vorliegenden Arbeit soll der Definition von Probst et al. gefolgt werden, da sie besonders die Verankerung von Wissen im Individuum hervorhebt. Zudem kann, wenn der Begriffshierarchie von Rehäuser/Krcmar gefolgt wird, Wissen nicht in Dokumenten oder Speichern enthalten sein, da hier durch das Fehlen von menschlicher Kognition höchstens Informationen vorliegen würden.
Nach Pautzke repräsentiert die organisationale Wissensbasis die Gesamtheit des der Organisation zur Verfügung stehenden Wissens.[16] Probst et al. erweitern diese Definition um die Daten und Informationsbestände, auf die das individuelle und organisationale Wissen aufgebaut ist: „Die organisatorische Wissensbasis setzt sich aus individuellen und kollektiven Wissensbeständen zusammen, auf die eine Organisation zur Lösung ihrer Aufgaben zurückgreifen kann. Sie umfasst darüber hinaus die Daten und Informa-tionsbestände, auf welchen individuelles und organisationales Wissen aufbaut.“[17] Die Wissensbasis ist dabei nicht als statisch zu betrachten, sie unterliegt vielmehr konti-nuierlichen Veränderungsprozessen, die von Probst et al. unter dem Begriff „organisa-tionales Lernen“ zusammengefasst werden.[18] Die Wissensbasis ist eine der entscheiden-den Determinanten des aktuellen und zukünftigen Unternehmenserfolgs. Ein hoher Wissensstand ermöglicht einerseits die effiziente Organisation von Produktion, Absatz, Produktentwicklung sowie das Anbieten von wissensbasierten Zusatzleistungen wie Beratungs- und Serviceangebote. Andererseits lassen sich Wissensvorsprünge durch konkurrierende Unternehmen kurzfristig nicht aufholen, da die Wissensbasis durch kau-sale Ambiguität und fortwährenden Wandel charakterisiert ist. Diese Wissensvorsprün-ge bilden wiederum die Grundlage für den zukünftigen Unternehmenserfolg.[19]
Nachdem zunächst der Wissensbegriff definiert wurde, erfolgt nun eine Annäherung an das Wissensmanagement als Managementfunktion. Ziel des Wissensmanagements ist, den gegenwärtigen und zukünftigen Unternehmenserfolg durch die Bereitstellung von Wissen in ausreichender Qualität und Quantität zu gewährleisten.[20] Teilaufgaben des Wissensmanagement sind demnach der Erwerb und die Entwicklung neuen Wissens, die Förderung der effektiven und effizienten Nutzung des vorhandenen Wissens, sowie die Sicherung relevanten Wissens für die zukünftige Nutzung.[21] Wissensmanagement verkörpert „ein integratives Interventionskonzept, das sich mit den Möglichkeiten zur Gestaltung der organisationalen Wissensbasis befasst.“[22] Reinemann-Rothmeier und Mandl kommen zur folgenden Definition: „Wissensmanagement bezeichnet den be-wussten und systematischen Umgang mit der Ressource Wissen und den zielgerichteten Einsatz von Wissen in Organisationen. Damit umfasst Wissensmanagement die Gesam-theit aller Konzepte, Strategien und Methoden zur Schaffung einer intelligenten und lernenden Organisation. In diesem Sinne bilden Mensch, Organisation und Technik ge-meinsam die drei Standbeine des Wissensmanagements.“[23] Wissensmanagement ist folglich der intendierte Eingriff in die organisationale Wissensbasis, der neben der Ver-waltung des aktuellen Wissens die Neu- und Weiterentwicklung des organisationalen Wissens als Ziel hat.
2.3 Wissensarten und –eigenschafften
An dieser Stelle sollen die für diese Arbeit als wichtig betrachteten Arten bzw. Eigen-schaften von Wissen vorgestellt werden. Es wird dabei bewusst von der in der Literatur häufig verwendeten dichotomischen Betrachtungsweise Abstand genommen, da Wissen meist in Mischformen der nachfolgenden Typologien auftritt und eher selten nur einer einzigen Wissensform zugeschrieben werden kann.[24]
2.3.1 Explizites und Implizites Wissen
Polanyi hat als Erster eine Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Wissen vorgenommen. Mit seinem Zitat: „We can know more than we can tell“,[25] bringt er zum Ausdruck, dass der gesprochene, leicht artikulierbare Teil des Wissens nur einen klei-nen Ausschnitt des gesamten menschlichen Wissens darstellt. Implizites Wissen ist demnach der persönliche, schwer artikulierbare und damit auch schwer transferierbare Teil des Wissens. Es kann in eine technische und kognitive Dimension untergliedert werden. Die technische Dimension umfasst schwer dokumentierbare Fähigkeiten, die unter dem Begriff „Know-how“ zusammengefasst werden. Die kognitive Dimension enthält mentale Modelle, Schemata, Überzeugungen und Wahrnehmungen, die für selbstverständlich gehalten werden. Sie ist Grundlage menschlicher Weltanschauung und Vorstellung über die Zukunft.[26] Explizites oder kodifizierbares Wissen lässt sich dagegen in Worten und Zahlen ausdrücken, kann daher auch leicht geteilt werden.[27] Polanyi sieht keine scharfe Grenzziehung zwischen implizitem und explizitem Wissen, er sieht beide Wissensdimensionen als verbunden an, wobei einzig implizites Wissen alleine existieren kann: „all knowledge is either tacit or rooted in tacit knowledge,“[28] da das Explizite im Impliziten verwurzelt ist.[29]
In einer grundlegenden Kritik an der Unterscheidung zwischen explizitem und implizi-tem Wissen sprechen Schreyögg/Geyger implizitem Wissen die Berechtigung ab, als Wissen bezeichnet zu werden, er schlägt in Anlehnung an Polanyi, der selbst Können und Wissen als Synonyme für implizites bzw. explizites Wissen benutzt,[30] den Begriff Könnerschaft als Alternative vor, da implizites Wissen sich im Handeln manifestiert, vom Handelnden selbst im Wesentlichen aber unverstanden bleibt.[31]
In der Literatur häufig verwendete Begriffspaare wie knowing-how/knowing-about,[32] embodied/disembodied Knowledge, embedded/migratory Knowledge haben eine im Sinn verwandte Bedeutung und können daher nur in Details vom impliziten/expliziten Wissen unterschieden werden. Eine kurze Übersicht ist dennoch angeschlossen.
2.3.2 Embodied und Disembodied Knowledge
In der Literatur wird häufig zwischen embodied und disembodied Knowledge unter-schieden. Ein Teil der Fähigkeiten bzw. des Wissens ist demnach „verkörperlicht“ und kann daher auch nicht einfach über das Senden von Signalen oder Daten zwischen Men-schen übertragen werden.[33] Disembodied Knowledge ist dagegen vom Körper losgelös-tes Wissen, das entsprechend leicht teilbar ist, da es in Form von Sprache und Doku-menten ausgedrückt werden kann. embodied Knowledge entwickelt sich erst im Zeitab-lauf, durch langwierige körperliche Erfahrung und kann somit als eine Art implizites Erfahrungswissen bezeichnet werden, bei dem der Körper zum Wissensträger wird.[34]
2.3.3 Embedded und Migratory Knowledge
Embedded Knowledge ist Wissen, das in hochkomplexen, sozialen Interaktionen und Gruppenbeziehungen eingebettet ist. Dies hat zur Folge, dass eingebettetes Wissen vom Wesen her nicht wandernd ist. embedded Knowledge drückt sich in Form von Kompe-tenzen, Fähigkeiten oder Know-how aus, die der Unternehmung länger erhalten bleiben als nicht eingebettetes und somit leichter wanderndes auch als migratory Knowledge bezeichnetes Wissen.[35]
2.4 Wissen: Individuell vs. Kollektiv (kann Wissen kollektiv sein?)
In der Literatur zum Wissensmanagement ist es gängige Praxis zwischen individuellem und kollektivem Wissen, welches häufig mit organisationalem Wissen gleich gesetzt wird, zu unterscheiden.[36] Individuelles Wissen ist demnach Wissen, das auf einzelne Organisationsmitglieder beschränkt ist, anderen jedoch zugänglich sein kann. Nach Güldenberg muss kollektives Wissen im Gegensatz zu organisationalem Wissen nicht von allen Organisationsmitgliedern geteilt werden. Kollektives Wissen im Verständnis von Güldenberg ist daher das Wissen einer Gruppe von Individuen, das genau wie indi-viduelles Wissen anderen Organisationsmitgliedern zugänglich sein kann.[37]
Wissen und Lernen sind zwei verbundene Konstrukte, die nicht unabhängig voneinan-der betrachtet werden können, da jedes Wissen zugleich Endpunkt und Basis für Lern-prozesse ist. Von zentraler Bedeutung sind dabei Individuen, denn: „All learning takes place inside individual human heads; a organization learns in only two ways: (a) by the learning of its members, or (b) by ingesting new members who have knowledge the organization didn't previously have.”[38] Daher legt Justus die nicht unbegründete Vermu-tung nahe, dass es sich bei Begriffen wie organisationales Lernen, Wissen oder Gedäch-tnis nur um Methapern handelt.[39]
Es bleibt die Frage zu beantworten, ob Wissen überhaupt kollektiv bzw. organisational verankert sein kann. Mit dem Konstrukt des kollektiven/organisationalen Wissens wird dem Kollektiv/der Organisation eine Fähigkeit zugesprochen, die eigentlich nur Indivi-duen besitzen können. Als Beispiel für organisationales Wissen werden häufig Normen, Regeln, Dokumente und Routinen genannt.[40] Fraglich ist jedoch, ob es sich um Wissen im Sinne der in dieser Arbeit verwendeten Definition handelt, da dieses nur Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Problemlösung einsetzen, beinhaltet. Da Organisa-tionen keine kognitive Leistung vollbringen können ist nicht davon auszugehen, dass sie eigenständig Wissen besitzen können. Es soll jedoch nicht abgestritten werden, dass es sich bei Normen und Routinen um Wissen per se handelt. Vielmehr ist davon auszuge-hen, dass die Organisationsmitglieder aufgrund von Sozialisationsprozessen zu teilweise ähnlichen Interpretationen von Normen bzw. Routinen gelangen und diese daher als kollektiv/organisational erscheinen. Wissensträger bleiben jedoch letztlich Individuen, da eine Organisation ohne Mitglieder kein Wissen besitzen kann.
2.5 Wissensmanagement als Prozessmodell
Nachfolgend soll ein kurzer Abriss über verschiedene Wissensmanagementmodelle ge-geben werden. Verschieden Autoren unterscheiden dabei eine unterschiedliche Anzahl von Phasen oder Schritten, die zum Wissensmanagement gezählt werden. In der Summe sind die hier vorgestellten Ansätze jedoch in etwa deckungsgleich. Zur Veranschauli-chung der mit den einzelnen Prozessen verbundenen Handlungen, werden die Bausteine des Wissensmanagement von Probst et al. detaillierter betrachtet.
Nach North besteht Wissensmanagement aus fünf Aufgaben bzw. Zielen. Diese sind: Wissensbeschaffung, Wissensentwicklung, Wissenstransfer, Wissensaneignung und die Wissensweiterentwicklung.[41] Makhija/Turner kommen in Anlehnung an Huber zu einem ähnlichen Ergebnis, unterscheiden aber lediglich die vier Phasen: (1) Wissensschaffung und Wissensakquisition, (2) interner Wissenstransfer zu anderen Individuen oder Orga-nisationsteilen, (3) die Wissensinterpretation in einer mit den Unternehmenszielen in Einklang stehenden Art und (4) die Wissensanwendung.[42]
Probst et al. unterscheiden im Rahmen des Bausteine des Wissensmanagements -Modells acht unterschiedliche Prozesse. Das Setzen von normativen, strategischen und operati-ven Wissenszielen ist der Ausgangspunkt des Wissensmanagements. Im Rahmen des Bausteins Wissensidentifikation wird intern und extern vorhandenes Wissen identifiziert und der Standort festgehalten.[43] Zu diesem Zweck können Wissenskarten, Wissensto-pographien, geographische Informationssysteme und Wissensquellkarten genutzt wer-den.[44]
Der Wissenserwerb hat die externe Beschaffung von Wissen zum Ziel. Wissen kann durch die Rekrutierung von Experten, die Übernahme von Unternehmen, oder der Be-ziehung zu den Stakeholdern des Unternehmens erworben werden.[45]
Die interne Wissensentwicklung ist komplementär zum externen Wissenserwerb. Hier-bei steht die eigenständige Entwicklung intern oder sogar extern noch nicht vorhandener Fähigkeiten, Produkte, Ideen oder Prozesse im Mittelpunkt.[46] Nicht zu vernachlässigen ist, dass Wissen nicht nur in den „klassischen“ Bereichen F&E und Marketing (Markt-forschung), sondern im ganzen Unternehmen entstehen kann.[47]
Aufgabe der Wissens(ver)teilung ist die organisationsinterne Verbreitung des vorhan-denen Wissens. Nach dem ökonomischen Prinzip der Arbeitsteilung muss jedoch nicht jeder alles wissen.[48] Ziel und Zweck des Wissensmanagements ist die produktive Wis-sensnutzung, des in der Organisation vorhandenen Wissens. Zu diesem Zweck müssen sowohl psychologische als auch strukturelle Barrieren überwunden werden. Diese drü-cken sich in der Überschätzung eigener Fähigkeiten, dem festhalten an gewohnten Rou-tinen, so wie in ablehnendem Verhalten gegenüber fremden Wissens aus.[49]
Da gewonnenes Wissen der Organisation nicht zwangsläufig dauerhaft zur Verfügung steht, ist der letzte Baustein die gezielte Wissensbewahrung. Die Wissensbewahrung ist bedeutsam, da Wissen durch die Abwanderung von Mitarbeitern, Outsourcing oder or-ganisationale Reorganisation verloren gehen kann.[50] Selektionsregeln sind dabei wichtig um nicht relevante Daten und Informationen von der Speicherung zu eliminieren.[51]
Wie zu sehen ist, unterscheiden sich die verschiedenen Ansätze durch eine mehr oder weniger feine Unterteilung des Wissensmanagements in Einzelprozessen. Eingriffe können dabei in den einzelnen Teilprozessen erfolgen. Die Möglichkeit von Rückkopp-lungen bei einer Intervention in einen der Teilprozesse, kann dabei jedoch nicht ausge-schlossen werden.[52]
2.6 Zwischenfazit
Im ersten Teil der Arbeit wurde, neben der Definition von zentralen Begriffen wie Wis-sen, Wissensbasis und Wissensmanagement, die wichtige Unterscheidung zwischen Zeichen, Daten, Informationen und Wissen vorgenommen. Es konnte gezeigt werden, dass Individuen die alleinigen Träger von Wissen sind und Organisationen als solche nur Informationen, jedoch kein Wissen besitzen können. Abschließend wurden die mit dem Wissensmanagement verbundenden Prozesse vorgestellt.
Die Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Wissen einerseits und zwi-schen Informationen und Wissen andererseits ist besonders wichtig für das Wissensma-nagement. Informationen sind im Wesentlichen passiv vorliegende, strukturierte Daten- sätze, die durch kognitive Leistung zu Wissen werden können. Die Auswirkung ist be-sonders deutlich, wenn man die unterschiedlichen Kosten der Replikation betrachtet. Bei Informationen sind dies hauptsächlich Kosten die bei der Erstellung einer Kopie entstehen. Dank moderner Informations- und Kommunikationstechnologien tendieren diese gegen Null.[53] Besonders die Teilung von implizitem Wissen ist dagegen um ein vielfaches kostspieliger, da für den Transfer meist langwierige Lernprozesse erforder-lich sind. Selbst wenn Wissen in Form von Rezepten, Bauplänen oder Handbüchern kodifizierbar erscheint, ist stets zu beachten, dass hier nur ein Ausschnitt des Wissens erfasst wird, da implizite Wissensbestandteile verborgen bleiben. Die Implementierung von Wissensmanagement muss daher über technische Lösungen, die lediglich zur Spei-cherung und Teilung von Informationen beitragen, hinausgehen und auch die Mitarbei-ter als Wissensträger mit einbeziehen.
3 Joint Ventures
Im dritten Kapitel erfolgt zunächst eine Einführung in den Transaktionskostenansatz, um anschließende eine transaktionskostentheoretische Erklärung des Joint Ventures als Organisationsform zwischen Markt und Hierarchie zu geben. Es folgt die Definition des Joint Ventures sowie eine Vorstellung verschiedener Typen von Gemeinschaftsunter-nehmen. Daran angeschlossen ist ein Überblick über die gegenwärtige Verbreitung von Joint Ventures. Das Kapitel wird schließlich mit der Vorstellung der gängigsten Steue-rungs- und Kontrollmechanismen beendet.
3.1 Transaktionskostenansatz
Der Transaktionskostenansatz wurde im Wesentlichen von Williamson[54] auf die Vorar-beiten von Coase aufbauend entwickelt.[55] Nach Williamson ist die Transaktion Basis-einheit transaktionskostentheoretischer Analyse.[56] Unter einer Transaktion versteht man einen dem eigentlichen Güteraustausch[57] vorgelagerten Prozess der Klärung und Ver-einbarung des Leistungsaustausches.[58] Der Transaktionskostenansatz kann zur Bestim-mung der effizienten Organisationsgrenze und somit derjenigen Aktivitäten, die inner-halb der Organisation durchgeführt werden sollen, genutzt werden.[59] Unternehmen wäh-len die Organisationsform, bei der sich die geringste Summe aus Transaktions- und Produktionskosten ergibt. Transaktionskosten sind unteranderem Kosten, die bei der Anbahnung, Durchführung, Kontrolle und Anpassung vertraglicher Vereinbarungen entstehen.[60]
Im Rahmen des Transaktionskostenansatzes wird den Akteuren bounded rationality[61] und Opportunismus als Verhaltensannahmen unterstellt.[62] Faktorspezifität, Unsicherheit und Häufigkeit einer Transaktion bestimmen die Höhe der Transaktionskosten und folg-lich auch die dann optimale Organisationsform.[63] Faktorspezifität ist die für die Be- schreibung von Transaktionen wichtigste Dimension.[64] Mit Transaktionen verbundene Faktoren sind umso spezifischer, je weniger alternative Verwendungsmöglichkeiten es für diese gibt. Als Folge droht bei Investitionen in transaktionsspezifische Güter, die Gefahr der einseitigen Abhängigkeit („lock-in“).[65]
Unsicherheit bezieht sich hier auf die zukünftigen Umweltbedingungen, unter denen die vereinbarten Leistungen erbracht bzw. verwendet werden. Innerhalb des Transaktions-kostenansatzes wird zwischen Unsicherheit, die aus dem Verhalten der Akteure (Ver-haltensunsicherheit) entsteht und exogener Unsicherheit als Folge von Veränderung von Umweltzuständen unterschieden.[66]
Schließlich hat auch die Häufigkeit von Transaktionen einen Einfluss auf die Höhe der Transaktionskosten. Williamson argumentiert, dass nicht nur Transaktionskosten, son-dern auch neoklassische Produktionskosten eine Rolle bei der Wahl der geeigneten Transaktionsform spielen. Je häufiger eine vom Wesen her gleiche Transaktion durch-geführt wird, desto eher lassen sich Skalen- und Verbundsvorteile erzielen. Die Häufig-keit von Transaktionen hat daher einen entscheidenden Einfluss auf die Wahl der Orga-nisationsform.[67]
3.2 Joint Ventures als Organisationsform zwischen Markt und Hierarchie
Nach dem der Transaktionskostenansatz in seinen Grundzügen dargestellt wurde, wird nun untersucht, wann das Joint Venture die Organisationsform mit den im Vergleich zu Markt, langfristigem Vertrag und Hierarchie, geringsten Transaktionskosten ist. Im Ge-gensatz zum Markt wird der Leistungsaustausch in einem Joint Venture, innerhalb einer Hierarchie gemanagt. Von der vertikal integrierten Organisation unterscheidet sich das Joint Venture hingegen dadurch, dass zwei Firmen Anspruch auf das Residualeinkom-men und die Kontrollrechte bezüglich des Gemeinschaftsunternehmens erheben.[68] Daher gilt es die Frage zu klären, warum Organisationen bereit sind den Besitz einer Toch-tergesellschaft zu teilen.
Häufig genannte Gründe für die Bildung von Joint Ventures, sind das Erzielen von Economies of Scale, das Vermeiden hoher Investitionskosten, der Zugang zu neuen Märkten oder das Kombinieren von komplementärem Wissen und Technologien.
Hennart sieht diese als notwendige aber keines falls hinreichende Bedingungen für die Gründung von Joint Ventures an.[69] Er macht hohe Transaktionskosten aufgrund von Marktversagen als Ursache für die Bildung von Joint Ventures aus. Märkte sind beson-ders im Falle des Technologie- und Wissenstransfers, bei sehr hohen spezifischen In-vestitionen oder großer Unsicherheit bezüglich der zu erbringenden Leistung ineffi-zient.[70] Ein Grund, der gegen eine vollständige Integration eines Unternehmens spricht, sind hohe Diseconomies of Acquisition, also hohe Kosten, die nach der Internalisierung von Unternehmen, durch die Desinvestition oder dem Management von mit dem Kern-geschäft unverbunden Aktivitäten auftreten.[71]
Joint Ventures sind langfristigen Verträgen überlegen, wenn hohe spezifische Investi-tionen für die Transaktion benötigt werden und gleichzeitig ein hohes Maß an Unsi-cherheit bezüglich der erzielbaren Performance bzw. deren Messung vorliegt.[72] Kogut stellt in diesem Zusammenhang fest: „It is by mutual hostage positions through joint commitment of financial or real assets that superior alignment of incentives is achieved. And the agreement on the division of profits or costs is stabilized.”[73] Durch die mit der Gründung eines Joint Ventures einhergehenden Investitionen, begeben sich die beteilig-ten Unternehmen in eine wechselseitige Abhängigkeit, die die Gefahr von Moral Hazards reduziert. Da die Transaktionen innerhalb einer Hierarchie erfolgen, können zu-dem flexible Kontrollmechanismen eingesetzt werden, die vertraglichen oder marktli-chen Kontrollmechanismen überlegen sind.
Die Teilung von Risiko und Ertrag führt zu einer zumindest teilweisen Zielangleichung, ohne dass die zu erbringenden Leistungen ex ante in allen Details festgelegt werden müssen. Die wichtigste Eigenschaft eines Joint Ventures ist daher die Fähigkeit, Verhal- tensunsicherheit der Partnerunternehmen auch dann zu minimieren, wenn mindestens eines der beiden Unternehmen hohe spezifische Investitionen tätigen muss und eine Internalisierung aus Kostengründen nicht in Frage kommt.[74] Joint Ventures sind dem-nach die geeignete Organisationsform, wenn benötigte spezifische Investitionen sehr hoch sind, nur ein Teil der gesamten zu erbringenden Leistung mit dem Kerngeschäft der Organisation übereinstimmt und hohe Unsicherheit bezüglich der zu erbringenden Leistung herrscht.
3.3 Das Joint Venture: Definition und Formen
Ziel dieses Abschnittes ist es, das Joint Venture als Form zwischenbetrieblicher Koope-ration mehrerer Organisationen darzustellen.[75] Generell wird zwischen Contractual und Equitiy Joint Ventures differenziert. Contractual Joint Venture sind auf Verträgen ba-sierende Joint Venture, ohne eigene Rechtspersönlichkeit und Tochtergesellschaft. Als Beispiele sind Lizensierungsvereinbarungen oder Distributions- und Lieferabkommen zu nennen. Risiko, Kosten und Gewinn werden auf Basis der zu Grunde liegenden Ver-tragsvereinbarungen zwischen den Vertragspartnern aufgeteilt, ohne dass ein Gemein-schaftsunternehmen gegründet wird.[76] In der wissenschaftlichen Diskussion scheint sich allerdings im zunehmenden Maße durchzusetzen, lediglich dann von einem Joint Venture zu sprechen, wenn eine organisatorisch und rechtlich eigenständige Einheit gegründet wird, also ein Equity Joint Venture vorliegt.[77] Nachfolgend werden daher lediglich Equity Joint Ventures betrachtet.
Viele Autoren verweisen auf die Kapitalanteilsverhältnisse als konstituierenden Faktor des Joint Ventures.[78] So fordert Korbin mindestens 20% Eigenkapitalanteil für jede Muttergesellschaft, um noch von einem Joint Venture sprechen zu können.[79] Hüsemann verlangt im Regelfall einen Kapitalanteil von 25%, zumindest aber eine substantielle Minderheitsbeteiligung von 10%.[80] Young und Bradford wollen dagegen kein Kapital- ungleichgewicht jenseits einer Grenze von 60:40 Prozent zulassen.[81]
[...]
[1] Vgl. Drucker (1992), S. 263 ff.; Toffler (1990); David/Foray (2002).
[2] Vgl. North (2005), S. 12.
[3] Vgl. Naisbitt (1982), S. 24.
[4] Vgl. Doz (1992), S. 50 f.; Harbison/Pekar (1998), S. 25.
[5] Vgl. Makhija/Turner (2006), S. 197.
[6] Vgl. Makhija/Turner (2006), S. 197.
[7] Vgl. Al-Laham (2003), S. 23 f.
[8] Vgl. Romhardt (1998), S. 47. Vgl. auch Al-Laham (2003), S. 23 f. für einen Überblick über den Wis-sensbegriff in unterschiedlichen Disziplinen.
[9] Vgl. Platon (1944)
[10] Vgl. Rehäuser/Krcmar (1996), S. 3 ff.; Vgl. auch David/Foray (2002), S. 12 f. für eine Unterscheidung zwischen Informationen und Wissen.
[11] Vgl. Romhardt (1998), S. 64.
[12] Abbildung nach Rehäuser/Krcmar (1996), S. 7.
[13] Vgl. Tuomi (1999), S. 107 ff.
[14] Probst et al. (2006), S. 22.
[15] Davenport/Prusak (1999), S. 32.
[16] Vgl. Pautzke (1989), S. 63.
[17] Probst et al. (2006), S. 22.
[18] Probst et al. (2006), S. 23.
[19] Vgl. Amelingmeyer (2004), S. 18 f.
[20] Vgl. Amelingmeyer (2004), S. 20.
[21] Vgl. Amelingmeyer (2004), S. 31.
[22] Probst et al. (2006), S. 23.
[23] Zitiert nach Meyer (ohne Jahr), S. 1.
[24] Romhardt gibt einen für einen Überblick über häufig dichotomische Wissenssystematisierungen. Vgl. Romhardt (1998), S. 51 f.
[25] Polanyi (1966), S. 4.
[26] Vgl. Nonaka (1994), S. 16; Nonaka/Takeuchi (1995), S. 8.
[27] Vgl. Nonaka (1994), S. 16; Nonaka/Takeuchi (1995), S. 8.
[28] Polanyi (1966), S. 7.
[29] Vgl. Polanyi (1966), S. 7.
[30] Vgl. Polanyi (1966), S. 7.
[31] Vgl. Schreyögg/Geyger (2002), S. 11; Schreyögg/Geyger (2003), S. 14 f.
[32] Vgl. Grant (1996), S. 111.
[33] Vgl. Collins (1993), S. 96 f.
[34] Vgl. Krogh/Venzin (1995), S. 421 f.; Zubhoff (1988), S. 36.
[35] Vgl. Badarocco (1991), S. 80 f.
[36] Vgl. unter anderem. Güldenberg (2001), S. 194 f.; Al-Laham (2003), S. 35.
[37] Vgl. Güldenberg (2001), S. 194 f.
[38] Simon (1991), S. 125.
[39] Vgl. Justus (1999), S. 103.
[40] Vgl March (1991), S. 73.
[41] Vgl. North (2005), S. 3.
[42] Vgl. Makhija/Turner (2006), S. 201; Huber (1991), S. 90.
[43] Vgl. Romhardt (1998), S. 77, Probst et al. (2006), S. 63 ff.
[44] Vgl. Probst et al. (2006), S. 67 ff.
[45] Vgl. Probst et al. (2006), S. 93.
[46] Vgl. Probst et al. (2006), S. 113.
[47] Vgl. Romhardt (1998), S. 77
[48] Vgl. Probst et al. (2006), S. 147.
[49] Vgl. Probst et al. (2006), S. 177.
[50] Vgl. Probst et al. (2006), S. 189 f.
[51] Vgl. Probst et al. (2006), S. 193 f.
[52] Vgl. Probst et al. (2006), S. 28.
[53] Vgl. David/Foray (2002), S. 13.
[54] Vgl. insbesondere Williamson (1981, 1990).
[55] Vgl. „The Nature of the Firm” von Coase (1937).
[56] Vgl. Williamson (1990), S. 20.
[57] Güter können neben materieller auch von immaterieller Gestallt sein.
[58] Vgl. Picot (1982), S. 269; Commons (1931), S. 652.
[59] Vgl. Williamson (1981), S. 549.
[60] Vgl. Albach (1988), S. 1160; Picot (1982), S. 270; Kogut (1988), S. 320.
[61] Bounded rationality unterstellt begrenzt rationales Verhalten der Akteure. Diese handeln intendiert rational unter der Limitation ihrer Erkenntnisfähigkeit. Vgl. Simon (1976), S. xxviii.
[62] Vgl. Williamson (1990), S. 34.
[63] Vgl. Williamson (1990), S. 59.
[64] Vgl. Williamson (1981), S. 34.
[65] Vgl. Williamson (1990), S. 61 f.; Picot (1982), S. 271.
[66] Vgl. Williamson (1990), S. 66; Picot (1982), S. 272.
[67] Vgl. Williamson (1990), S. 69.
[68] Vgl. Kogut (1988), S. 320.
[69] Vgl. Hennart (1988), S. 363.
[70] Vgl. Hennart (1988).
[71] Vgl. Kogut (1988), S. 320, Buckley/Carsson (1988), S. 41. Neben transaktionskostentheoretischen Erklärungen können auch andere Gründe gegen eine vollständige Integration von Unternehmen sprechen. Insbesondere kartellrechtliche Bedenken oder die rechtliche Begrenzung des möglichen Kapitalanteils auf Auslandsmärkten können eine wichtige Rolle bei der Entscheidung zu Gunsten eines Gemeinschaftsun-ternehmens spielen. Vgl. Buckley/Carsson (1988), S. 41.
[72] Vgl. Kogut (1988), S. 320.
[73] Kogut (1988), S. 320.
[74] Vgl. Kogut (1988), S. 321
[75] Aus Vereinfachungsgründen werden nachfolgend nur Joint Ventures mit zwei Mutterunternehmen betrachtet.
[76] Vgl. Kabst (2000), S. 8; Hennart (1988), S. 362.
[77] Vgl. Hennart (1988), S. 361 f.; Eisele (1995), S. 10 ff.
[78] Nachfolgend wird aus Vereinfachungsgründen ein „equity Joint Venture“ unterstellt wenn von einem „Joint Venture“ gesprochen wird.
[79] Vgl. Korbin (1988), S. 130.
[80] Hüsemann (1972), S. 55.
[81] Vgl. Young/Bradford (1977), S. 13.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Joint Ventures wichtig für das Wissensmanagement?
Joint Ventures dienen als Vehikel, um neues Wissen kooperativ zu generieren oder wertvolles Know-how von Partnerunternehmen zu akquirieren.
Was ist der Unterschied zwischen implizitem und explizitem Wissen?
Explizites Wissen ist kodifizierbar (z.B. Dokumente), während implizites Wissen an Personen gebunden und schwer zu übertragen ist.
Wie beeinflussen Kontrollmechanismen den Wissenstransfer?
Kontrollinstrumente steuern den Informationsfluss und entscheiden darüber, wie Wissen im Joint Venture akquiriert und verteilt wird.
Was erklärt der Transaktionskostenansatz bei Joint Ventures?
Er hilft zu verstehen, warum Unternehmen ein Joint Venture als Organisationsform zwischen freiem Markt und fester Hierarchie wählen.
Wie entsteht Wissen aus Daten und Informationen?
Wissen entsteht durch einen Anreicherungsprozess, bei dem Informationen durch Individuen sinnvoll vernetzt und in einen Kontext gesetzt werden.
- Quote paper
- Diplom Kaufmann Claudius Tadesse (Author), 2008, Joint Ventures als Instrument des Wissensmanagements, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134358