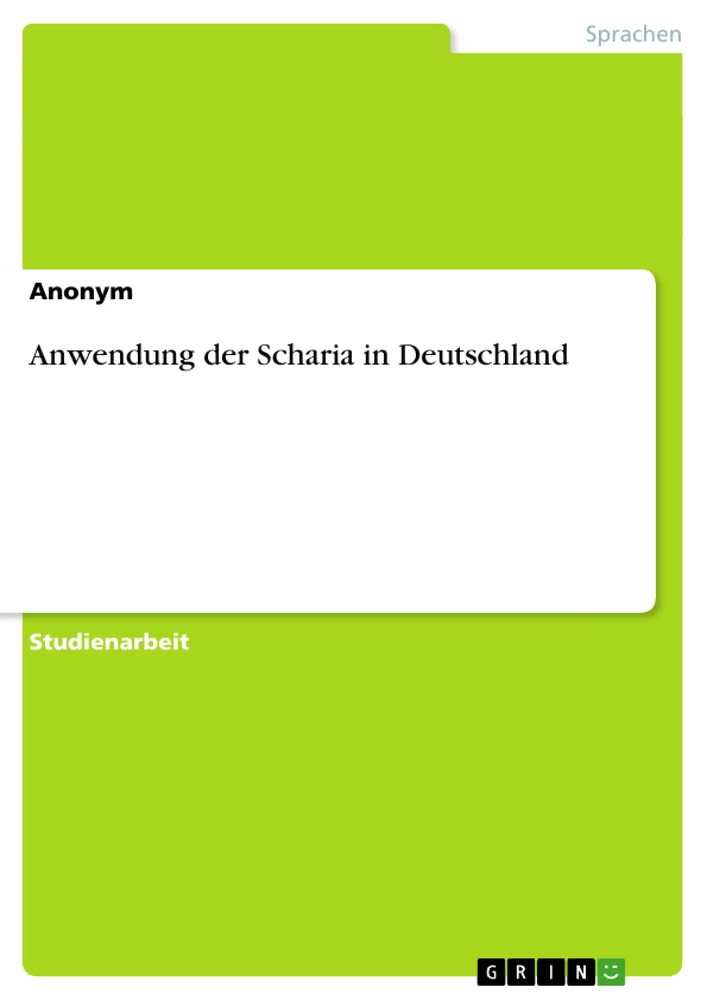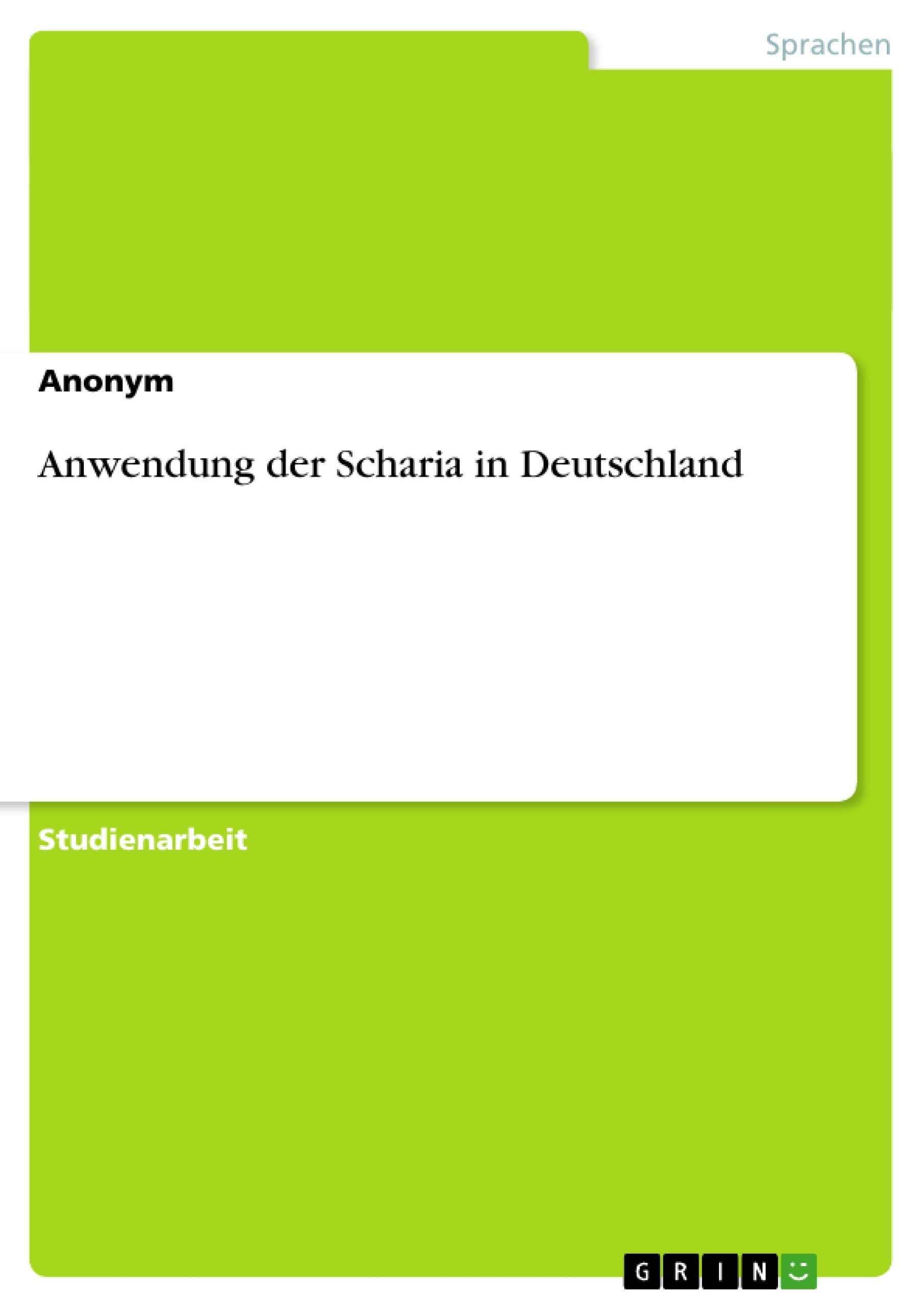Als Thema meiner Arbeit wurde mir vorgegeben mich mit den positiven Seiten der Einführung der Scharia in Deutschland auseinander zu setzten. Da dies selbstverständlich zu keinem Zeitpunkt ein realer Vorgang sein wird, habe ich überlegt, dass es schwer wird, darüber zu schreiben, was daran positiv sein soll, unser Rechtssystem durch ein wesentlich unzulänglicheres zu ersetzen. Ich kam zu dem Schluss, dass die einzige Basis, auf der meiner Meinung nach über eine Berücksichtigung der Scharia in unserem Rechtssystem diskutiert werden kann, die der Integration ist. Grundgedanke hierbei sollte sein, dass man auf diesem Weg den Muslimen vermitteln könnte, dass man ihre spezielle kulturelle und religiöse Andersartigkeit achtet und gewillt ist, sie - soweit sie deutsches Recht oder die Grundrechte des Menschen und der Demokratie allgemein nicht beschneiden - zu berücksichtigen. Dies könnte es den Muslimen erleichtern, sich in unser Rechtsystem und unsere Kultur zu integrieren. Mithilfe dieser Ansicht möchte ich untersuchen, ob es grundsätzlich von Nöten ist, darüber nachzudenken, in wieweit islamisches Recht auch hier Anwendung finden sollte. Ob dies auf kultureller sowie rechtlicher Ebene möglich ist und in wieweit dies ein Vorteil für die Integration der Muslime hier in Deutschland sein könnte. Denn nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, wie England oder Frankreich, steht man vor der Aufgabe, dem immer größer werdenden Anteil der Muslime im Land dahingehend Rechnung zu tragen, dass man sich für die Wahrung ihrer kulturellen und religiösen Eigenheiten einsetzt, anstatt sie zu dämonisieren und aus der Gesellschaft auszuklammern. Denn ein großer Teil der Muslime will freiwillig außerhalb der islamischen Welt leben und sich da auf Dauer einrichten. Sie stehen somit vor der Frage, wie sie sich integrieren und ihren Glauben leben können im Einklang mit dem Grundgesetz und den deutschen Gesetzen. Sie müssen einen Islam ausformen, der keine Ängste mehr bei der deutschen Mehrheitsbevölkerung auslöst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Was ist die Scharia?
- 2.1 Quellen der Scharia
- 2.2 Was schreibt die Scharia vor?
- 3. Gemeinsame Werte finden Scharia in Deutschland oder Integration als Herausforderung?
- 3.1 Ein Land eine Kultur?
- 3.2 Gleiches Recht für alle?
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeit der Berücksichtigung der Scharia im deutschen Rechtssystem im Kontext der Integration von Muslimen. Sie hinterfragt, ob eine solche Berücksichtigung die Integration fördern könnte, ohne dabei deutsches Recht oder Grundrechte zu verletzen. Der Fokus liegt auf der Vereinbarkeit islamischen Rechts mit dem deutschen Rechtsrahmen und den kulturellen Gegebenheiten.
- Integration von Muslimen in Deutschland
- Vereinbarkeit von Scharia und deutschem Recht
- Kulturelle und religiöse Andersartigkeit
- Herausforderungen der Integration
- Möglichkeiten der Berücksichtigung islamischen Rechts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Arbeit untersucht die Frage nach der Berücksichtigung der Scharia im deutschen Rechtssystem, nicht aus der Perspektive einer tatsächlichen Einführung, sondern im Kontext der Integration von Muslimen. Der Fokus liegt darauf, wie eine Berücksichtigung der kulturellen und religiösen Besonderheiten von Muslimen die Integration in die deutsche Gesellschaft erleichtern könnte, ohne dabei die Grundrechte und das deutsche Rechtssystem zu kompromittieren. Die Arbeit stellt die Integration als zentralen Aspekt der Debatte dar und untersucht die kulturellen und rechtlichen Herausforderungen.
2. Was ist die Scharia?: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff "Scharia" und seine vielschichtigen Interpretationen. Es thematisiert die Kritik an der Scharia, die von Grausamkeit und Benachteiligung von Frauen geprägt ist, und stellt gleichzeitig die unterschiedlichen Modelle ihrer Umsetzung in islamisch geprägten Staaten heraus. Das Kapitel betont, dass die Scharia kein einheitliches Gesetzbuch ist, sondern eine Idealvorstellung von göttlichem Gesetz, die in verschiedenen Kontexten unterschiedlich ausgelegt und umgesetzt wird. Beispiele für unterschiedliche Umsetzungen und die Rolle von Muftis und Fatwas werden ebenfalls genannt.
2.1 Quellen der Scharia und Entstehung des islamischen Rechts: Dieses Kapitel beschreibt die Quellen der Scharia: den Koran, die Sunna (Handeln und Reden des Propheten Mohammed), und die normative Auslegung durch frühislamische Juristen und Theologen. Es wird hervorgehoben, dass die Scharia auf einer arabischen Stammesgesellschaft des 7. und 8. Jahrhunderts basiert und somit nicht alle Fragen der heutigen Zeit beantworten kann. Die Rolle von Idschma (Konsens) und Qiyas (Analogieschluss) in der Rechtsfindung wird ebenfalls erklärt. Das Kapitel schliesst mit dem Hinweis auf die Diskrepanz zwischen einigen scharia-basierten Regeln und der modernen Vorstellung von Recht und Gesetz.
3. Gemeinsame Werte finden Scharia in Deutschland oder Integration als Herausforderung?: Das Kapitel widmet sich der Herausforderung der Integration von Muslimen in Deutschland und diskutiert die Frage, inwieweit die Berücksichtigung der Scharia die Integration fördern oder behindern könnte. Es werden die Aspekte "Ein Land, eine Kultur?" und "Gleiches Recht für alle?" im Detail beleuchtet, um die Komplexität der Integration und die potentiellen Konflikte zwischen kulturellen und rechtlichen Werten zu verdeutlichen. Das Kapitel setzt sich kritisch mit den möglichen Spannungsfeldern zwischen Integration und der Wahrung religiöser und kultureller Eigenheiten auseinander.
Schlüsselwörter
Scharia, Integration, Islam, deutsches Recht, Grundrechte, Kultur, Religion, Mufti, Fatwa, Integration von Muslimen, Rechtsvergleichung, kulturelle Andersartigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: "Scharia in Deutschland: Integration als Herausforderung?"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeit der Berücksichtigung der Scharia im deutschen Rechtssystem im Kontext der Integration von Muslimen. Der Fokus liegt auf der Vereinbarkeit islamischen Rechts mit dem deutschen Rechtsrahmen und den kulturellen Gegebenheiten. Es geht nicht um die tatsächliche Einführung der Scharia, sondern um die Frage, wie kulturelle und religiöse Besonderheiten von Muslimen die Integration erleichtern könnten, ohne Grundrechte und deutsches Recht zu beeinträchtigen.
Was wird unter "Scharia" verstanden und welche Quellen hat sie?
Die Arbeit beleuchtet die vielschichtigen Interpretationen des Begriffs "Scharia". Sie betont, dass es sich nicht um ein einheitliches Gesetzbuch handelt, sondern um eine Idealvorstellung göttlichen Gesetzes, die unterschiedlich ausgelegt und umgesetzt wird. Die Quellen der Scharia sind der Koran, die Sunna (Handeln und Reden des Propheten Mohammed), und die Auslegung durch frühislamische Juristen und Theologen. Die Rolle von Idschma (Konsens) und Qiyas (Analogieschluss) in der Rechtsfindung wird ebenfalls erklärt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in diesen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel über den Begriff und die Quellen der Scharia, und ein Kapitel, das sich mit der zentralen Frage der Integration von Muslimen in Deutschland und der potentiellen Rolle der Scharia auseinandersetzt. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen. Die Kapitel befassen sich detailliert mit den Herausforderungen der Integration und den möglichen Spannungsfeldern zwischen Integration und der Wahrung religiöser und kultureller Eigenheiten.
Wie wird die Vereinbarkeit von Scharia und deutschem Recht betrachtet?
Die Arbeit untersucht kritisch die potentiellen Konflikte zwischen dem deutschen Rechtsrahmen und der Scharia. Sie analysiert die Frage, ob und wie eine Berücksichtigung islamischen Rechts die Integration fördern könnte, ohne dabei deutsches Recht oder Grundrechte zu verletzen. Es wird betont, dass die Scharia auf einer arabischen Stammesgesellschaft des 7. und 8. Jahrhunderts basiert und nicht alle Fragen der heutigen Zeit beantworten kann.
Welche Schlüsselthemen werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselthemen sind die Integration von Muslimen in Deutschland, die Vereinbarkeit von Scharia und deutschem Recht, kulturelle und religiöse Andersartigkeit, die Herausforderungen der Integration, sowie Möglichkeiten der Berücksichtigung islamischen Rechts. Die Arbeit thematisiert auch die Kritik an der Scharia und die unterschiedlichen Modelle ihrer Umsetzung in islamisch geprägten Staaten.
Welche Rolle spielen Begriffe wie "Mufti" und "Fatwa"?
Die Arbeit erwähnt Muftis und Fatwas im Kontext der unterschiedlichen Auslegungen und Umsetzungen der Scharia. Diese Begriffe verdeutlichen, dass die Scharia nicht statisch ist, sondern dynamisch interpretiert und angewendet wird, was die Komplexität der Thematik unterstreicht.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet die Herausforderungen und Möglichkeiten im Kontext der Integration von Muslimen in Deutschland unter Berücksichtigung der Scharia. (Der genaue Inhalt des Fazits ist im vorliegenden Auszug nicht vollständig dargestellt.)
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Anwendung der Scharia in Deutschland , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133994