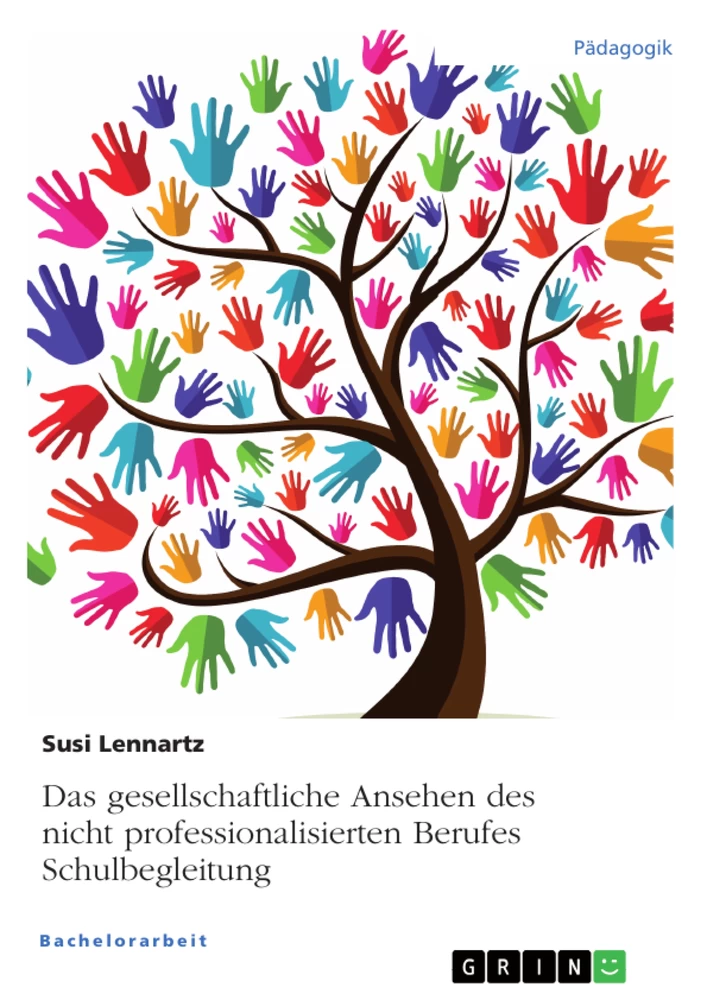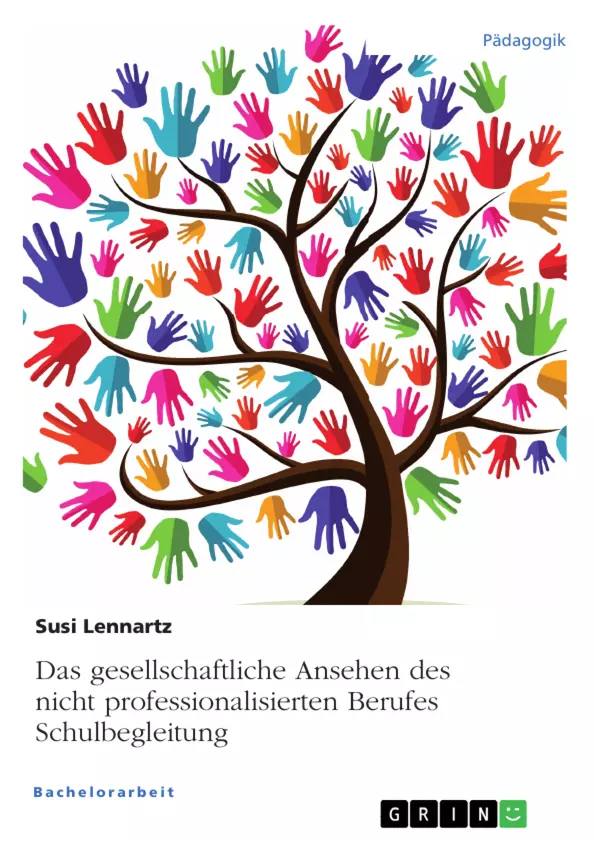Anhand dieser Bachelorarbeit soll die Forschungsfrage beantwortet werden: Wie nehmen schulische Fachkräfte sowie Eltern den sozialen und den beruflichen Status von Schulbegleitungen im Kontext von Leistungsanforderungen und nicht vorhandener beruflicher Professionalisierung wahr? Grundlage für diese Fragestellung ist die steigende Zahl von förderbedürftigen Kindern im allgemeinen Schulsystem, welche zunehmend von Schulassistenzen begleitet werden. Durch eine fehlende Professionalisierung in diesem Bereich sind die Leistungsanforderungen an die Begleitungen nicht definiert. Dies erschwert die Kooperation und führt zu individuellen Anforderungen der Zusammenarbeitenden, die nur selten ausreichend kommuniziert werden.
Diese Form der Zusammenarbeit bestimmt im weiteren Verlauf das Ansehen der Begleitung. Da es über den gesellschaftlichen Status von Schulbegleitungen kaum Studien gibt, wird in dieser Arbeit eine qualitative Studie in Form von drei ExpertInneninterviews durchgeführt. Das Ergebnis zeigt, dass Schulbegleitungen ungeachtet fehlender Fachlichkeit ein hohes Ansehen durch ihre persönlichen Eigenschaften sowie ihren Arbeitseinsatz erlangen können. Die Befragten wünschen sich jedoch Fachlichkeit für diesen Beruf. Zukünftige Studien können Bedarfe für ein Curriculum abfragen, um einen dreijährigen Ausbildungsberuf zu konzipieren.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schulbegleitung - Integrationsassistenz - Schulhelferin
- 2.1 Gemengelage der Begrifflichkeiten
- 2.2 Was ist Schulbegleitung?
- 2.3 Die Qualifizierung für Schulbegleitungen
- 2.4 Empirische Studien zum Thema Fachlichkeit von Schulbegleitungen
- 2.5 Die Entwicklung von schulischer Inklusion
- 3. Spannungsfelder
- 3.1 Spannungsfeld Zusammenarbeit
- 3.2 Rollendiffusion
- 3.3 Professionalisierung als Spannungsfeld
- 3.3.1 Soziologisches Verständnis von Beruf und Profession
- 3.3.2 Sozialer Status - Beruflicher Status
- 4. Wahrnehmung der Handlungsbeteiligten
- 4.1 Die Datenerhebungsmethode
- 4.1.1 Die Auswahl der ExpertInnen
- 4.1.2 Der Leitfaden
- 4.2 Aufbereitung und Auswertung
- 4.3 Die qualitative Inhaltsanalyse und die qualitativen Gütekriterien nach Mayring
- 4.4 Die Forschungsergebnisse
- 4.4.1 Die Leistungsanforderungen
- 4.4.2 Die Professionalisierung
- 4.4.3 Der berufliche Status
- 4.4.4 Der Verdienst
- 4.4.5 Der soziale Status
- 4.1 Die Datenerhebungsmethode
- 5. Interpretation der Ergebnisse
- 5.1 Erkenntnisse aus den Interviews
- 5.2 Auswertung der Ergebnisse
- 5.2.1 Das Anforderungsprofil
- 5.2.2 Die Statusattribution
- 5.3 Erkenntnisse außerhalb der Forschungsfrage
- 5.4 Methodenkritik
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert die Wahrnehmung des sozialen und beruflichen Status von Schulbegleitungen durch schulische Fachkräfte und Eltern im Kontext von Leistungsanforderungen und fehlender Professionalisierung. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die aus der steigenden Zahl von Kindern mit Förderbedarf und der daraus resultierenden Notwendigkeit von Schulbegleitungen entstehen.
- Der gesellschaftliche Status von Schulbegleitungen
- Leistungsanforderungen an Schulbegleitungen
- Die Bedeutung von Professionalisierung im Bereich der Schulbegleitung
- Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Eltern und Schulbegleitungen
- Die Rolle der persönlichen Eigenschaften von Schulbegleitungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Kontext der Arbeit vor. Sie beleuchtet die wachsende Bedeutung von Schulbegleitungen im deutschen Schulsystem und die damit verbundenen Herausforderungen, die aus der fehlenden Professionalisierung resultieren.
- Kapitel 2: Schulbegleitung - Integrationsassistenz - Schulhelferin: Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Bezeichnungen für die Tätigkeit der Schulbegleitung und deren Bedeutung im Kontext der Integration von Kindern mit Förderbedarf. Es analysiert die Qualifizierungslandschaft, die empirischen Studien zum Thema Fachlichkeit und die Entwicklung schulischer Inklusion.
- Kapitel 3: Spannungsfelder: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Spannungsfelder, die im Kontext der Schulbegleitung auftreten, wie z.B. die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Eltern und Schulbegleitungen, die Rollendiffusion der Schulbegleitung und die Bedeutung der Professionalisierung.
- Kapitel 4: Wahrnehmung der Handlungsbeteiligten: Dieses Kapitel beschreibt die Datenerhebungsmethode, die Auswahl der ExpertInnen, den Leitfaden für die Interviews sowie die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. Es präsentiert die Ergebnisse der Interviews, die sich auf die Leistungsanforderungen, die Professionalisierung, den beruflichen Status, den Verdienst und den sozialen Status von Schulbegleitungen beziehen.
- Kapitel 5: Interpretation der Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews interpretiert und verschiedene Erkenntnisse aus den Interviews aufgezeigt. Es beleuchtet das Anforderungsprofil von Schulbegleitungen und die Statusattribution, die durch die Befragten vorgenommen wurde.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Schulbegleitung, Leistungsanforderung, Professionalisierung, Status, Kinder mit Förderbedarf. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Zusammenarbeit und die Bedeutung der Qualifikation im Bereich der Schulbegleitung. Die Ergebnisse der Arbeit können wichtige Hinweise für die Gestaltung zukünftiger Ausbildungsangebote im Bereich der Schulbegleitung liefern.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Forschungsfrage dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht, wie schulische Fachkräfte und Eltern den sozialen und beruflichen Status von Schulbegleitungen wahrnehmen, insbesondere vor dem Hintergrund fehlender beruflicher Professionalisierung.
Warum ist die Professionalisierung der Schulbegleitung ein Problem?
Es gibt kein einheitliches Curriculum oder eine geschützte Ausbildung. Dies führt zu unklaren Leistungsanforderungen, Rollendiffusion und erschwert die Kooperation zwischen Lehrkräften, Eltern und Begleitungen.
Wie wird der soziale Status von Schulbegleitungen wahrgenommen?
Die qualitative Studie zeigt, dass Schulbegleitungen trotz fehlender formaler Fachlichkeit ein hohes Ansehen durch persönliche Eigenschaften und hohen Arbeitseinsatz erlangen können, der berufliche Status jedoch oft als niedrig eingestuft wird.
Welche Rolle spielt die schulische Inklusion für dieses Berufsfeld?
Durch die steigende Zahl von Kindern mit Förderbedarf im allgemeinen Schulsystem wächst der Bedarf an Schulbegleitungen (auch Integrationsassistenz genannt) stetig an, was die Frage nach Qualität und Qualifikation dringlich macht.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Experteninterviews?
Die Befragten wünschen sich mehr Fachlichkeit und klare Strukturen. Der Verdienst und die vertragliche Situation werden oft als unzureichend kritisiert, was den beruflichen Status negativ beeinflusst.
Welche Empfehlungen gibt die Arbeit für die Zukunft?
Es wird angeregt, Bedarfe für ein einheitliches Curriculum zu ermitteln, um langfristig einen dreijährigen Ausbildungsberuf für Schulbegleitungen zu konzipieren.
- Citar trabajo
- Susi Lennartz (Autor), 2022, Das gesellschaftliche Ansehen des nicht professionalisierten Berufes Schulbegleitung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1337218