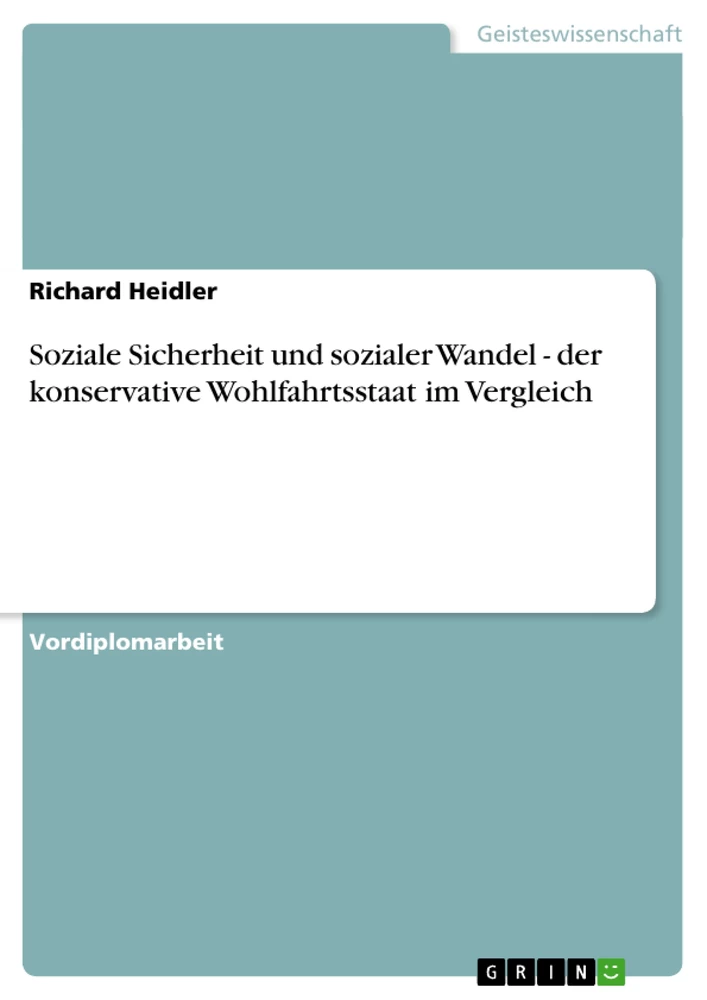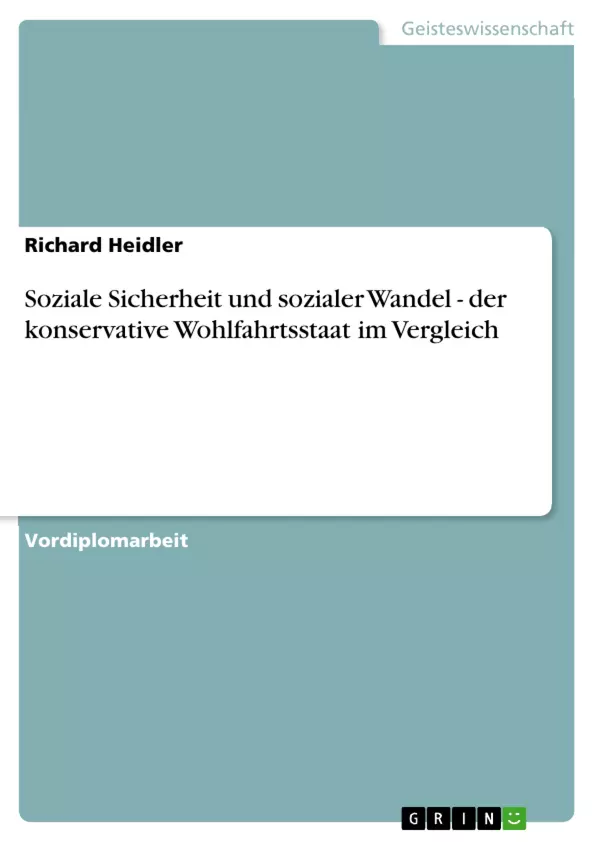„Kanzler sagt dem Wohlfahrtsstaat Ade“ überschreibt der Tagesspiegel seinen Leitartikel zur Regierungserklärung der rot-grünen Koalition, wohl nicht ganz frei von Ironie. Dennoch gibt die Überschrift prägnant die Stoßrichtung des öffentlichen Diskurses um die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme wieder. Unverholen bedienen sich vor allem Neoliberale, Ökonomen und Unternehmerverbände einer Krisenrhetorik und zeichnen die Zukunft des Wohlfahrtstaates in apokalyptischen Farben. Meist folgt dann der empfohlenen Therapie der wohlfahrtsstaatlichen Krise die passende Diagnose. Zunehmend wird dessen Konzept argumentativ ad absurdum geführt, indem ihm unterstellt wird, er beschäftige sich damit die Probleme zu lösen die er selber produziert z.b. die hohe Arbeitslosigkeit. Hinter solchen Kassandrarufen verbirgt sich ein verteilungspolitischer Konflikt um ein langsamer wachsendes Sozialprodukt das von einer geringer werdenden Zahl an Erwerbstätigen produziert wird. Von einer Krise könnte nur gesprochen werden, wenn tatsächlich, wie es die Überschrift im Tagesspiegel suggeriert, das baldige Ende des Wohlfahrtsstaates bevorstehen würde. Dies ist natürlich nicht der Fall, jedoch steht der Sozialstaat vor unabweisbaren Herausforderungen. Meinen Fokus will ich hier vor allem auf drei Sozialstrukturelle Wandlungsprozesse legen die m.E. die größten Implikationen für die zukünftigen Chancen soziale Sicherheit zu erhalten. Zum einen beschreibe ich den Wandel der Familie als einen elementaren Träger sozialer Sicherheit und ihren Abschied von der bürgerlichen Kernfamilie. Der zweite, davon nicht unabhängige Wandlungsprozess ist der demographische Wandel, der aus einem Rückgang der Fertilität und einer Zunahme der Lebenserwartung resultiert. Hier werde ich mich vor allem an den entsprechenden Kapiteln des Buches die politische Ökonomie des Sozialstaates von Heiner Ganßmann halten. Der dritte Strang des sozialstaatlich relevanten strukturellen Wandels, ist der Wandel der Arbeitsmarktstrukturen. Das Stichwort ist hier der Übergang von der industriellen zur post-industriellen Gesellschaft. Hier werde ich mich vor allem auf den Text von Iverson/Wren the trilemma of the service economy beziehen. Die genannten sozialstrukturellen Verschiebung, natürlich in unterschiedlichem Ausmaß, sind in allen hochentwickelten Wohlfahrtstaaten (welche weitgehend deckungsgleich mit den 24 OECD-Ländern sind) zu beobachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Sozialstaat aus soziologischer Perspektive
- Soziale Sicherheit
- Die Träger sozialer Sicherheit
- Sozialstruktureller Wandel
- Familie
- Demographischer Wandel
- Wandel der Arbeitsmarktstrukturen
- Schlussteil
- Schaubild und Tabelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen des konservativen Wohlfahrtsstaates im Kontext von sozialstrukturellen Veränderungen. Ziel ist es, die Auswirkungen des Wandels der Familie, des demographischen Wandels und der Arbeitsmarktstrukturen auf die soziale Sicherheit im deutschen Wohlfahrtsstaat zu analysieren.
- Entwicklung und Bedeutung des Wohlfahrtsstaates
- Soziale Sicherheit als anthropologische Grundkonstante
- Sozialstrukturelle Wandlungsprozesse: Familie, Demographie, Arbeitsmarkt
- Kontrastierung des deutschen Wohlfahrtsstaates mit anderen Modellen (sozialdemokratisch, liberal)
- Herausforderungen und Chancen des konservativen Wohlfahrtsstaates im Wandel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung setzt sich mit dem aktuellen Diskurs über die Zukunft des Wohlfahrtsstaates auseinander und benennt die wichtigsten Herausforderungen, denen sich der deutsche Sozialstaat stellt. Die Arbeit konzentriert sich auf drei zentrale sozialstrukturelle Wandlungsprozesse, die als besonders relevant für die soziale Sicherheit betrachtet werden: Wandel der Familie, demographischer Wandel und Wandel der Arbeitsmarktstrukturen.
Der Sozialstaat aus soziologischer Perspektive
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Sozialstaates als Reaktion auf Urbanisierung, Industrialisierung und Modernisierungsprozesse. Es wird erläutert, wie das kapitalistische Wirtschaftssystem neue Bedürfnisse nach sozialer Sicherheit hervorrief und die traditionellen Schutzmechanismen wie die Familie oder karitative Einrichtungen an ihre Grenzen stieß. Die Entstehung der Sozialgesetzgebung im Deutschen Reich und die Entwicklung des modernen Wohlfahrtsstaates im 20. Jahrhundert werden dargestellt.
Soziale Sicherheit
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der sozialen Sicherheit und seinen verschiedenen Dimensionen: retrospektive Sicherheit, Systemsicherheit und Selbstsicherheit. Der Autor diskutiert, wie das Konzept der sozialen Sicherheit in der modernen Sozialpolitik verwendet wird und warum es nicht nur ein praktisches Handlungsziel, sondern vor allem eine Wertidee darstellt.
Die Träger sozialer Sicherheit
Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Akteuren, die soziale Sicherheit gewährleisten. Neben dem Staat werden auch die Familie und die Zivilgesellschaft als wichtige Träger sozialer Sicherheit betrachtet. Die spezifischen Kombination von Demokratie und Kapitalismus in den meisten OECD-Ländern hat zu drei Sphären der Erzeugung sozialer Sicherheit geführt, die im folgenden Kapitel näher erläutert werden.
Schlüsselwörter
Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat, soziale Sicherheit, sozialstruktureller Wandel, Familie, demographischer Wandel, Arbeitsmarkt, Industrialisierung, Post-Industrialisierung, Globalisierung, konservativer Wohlfahrtsstaat, sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat, liberaler Wohlfahrtsstaat, Gosta Esping-Andersen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die größten Herausforderungen für den konservativen Wohlfahrtsstaat?
Zu den zentralen Herausforderungen gehören der demographische Wandel, der Wandel der Familienstrukturen und die Transformation des Arbeitsmarktes von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft.
Wie beeinflusst der demographische Wandel die soziale Sicherheit?
Sinkende Geburtenraten und eine steigende Lebenserwartung belasten die umlagefinanzierten Sicherungssysteme, da immer weniger Beitragszahler für mehr Leistungsempfänger aufkommen müssen.
Welche Rolle spielt die Familie als Träger sozialer Sicherheit?
Traditionell war die Familie ein Hauptpfeiler der sozialen Absicherung. Der Abschied von der bürgerlichen Kernfamilie hin zu vielfältigen Lebensformen schwächt diese private Absicherungsfunktion.
Was unterscheidet den konservativen Wohlfahrtsstaat von anderen Modellen?
Der konservative Wohlfahrtsstaat (wie in Deutschland) basiert oft auf dem Subsidiaritätsprinzip und der Beitragsfinanzierung, während liberale Modelle auf Eigenverantwortung und sozialdemokratische auf universelle staatliche Leistungen setzen.
Befindet sich der Sozialstaat wirklich in einer „Krise“?
Obwohl oft von einer Krise gesprochen wird, handelt es sich eher um einen notwendigen Anpassungsprozess an veränderte soziale und ökonomische Rahmenbedingungen.
- Arbeit zitieren
- Richard Heidler (Autor:in), 2003, Soziale Sicherheit und sozialer Wandel - der konservative Wohlfahrtsstaat im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13329