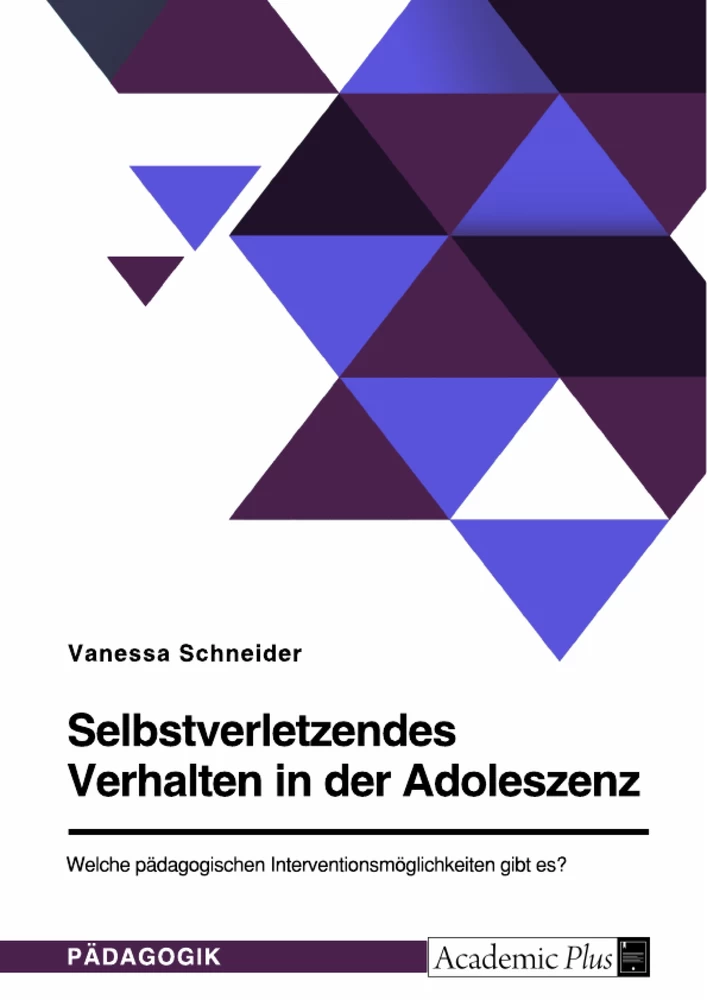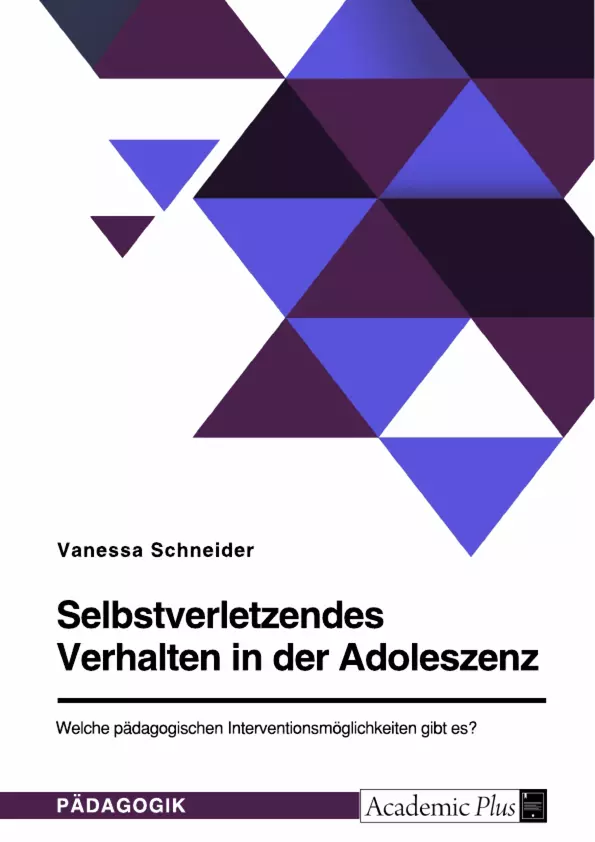Jugendliche zeigen insbesondere in der Zeit der Adoleszenz eine hohe Vulnerabilität für Risikoverhalten. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Fokus auf das selbstverletzende Verhalten als eine Form von Risikoverhalten gelegt. Da selbstverletzendes Verhalten besonders in der Adoleszenz eine hohe Prävalenz zeigt, ist es sehr wahrscheinlich, dass Pädagog*innen im Rahmen ihres Berufes mindestens einmal mit selbstverletzendem Verhalten bei Jugendlichen konfrontiert werden. Damit sie in solchen Situationen nicht überfordert sind und unangemessen reagieren, sind diverse Kenntnisse zu Handlungsanweisungen und Interventionsmöglichkeiten nötig. Solche sollen im Rahmen dieser Arbeit formuliert werden. Dafür wird zunächst eine Definition der Begriffe Jugend, Pubertät und Adoleszenz vorangehen. Die Begriffe werden häufig synonym verwendet, die Differenzierung und Abgrenzung untereinander ist allerdings wichtig, um die Entwicklung von Jugendlichen zu verstehen und die daraus folgenden Ursachen für selbstverletzendes Verhalten in der Adoleszenz nachvollziehen zu können.
Im Anschluss daran werden die biologischen und kognitiven Veränderungen aufgegriffen. Diese erläutern wiederum, wie es zu den Entwicklungsaufgaben kommt, die im darauffolgenden Kapitel erläutert werden. Risikoverhalten in Form von Alkohol- und Drogenmissbrauch, Mutproben, aber eben auch selbstverletzendem Verhalten, können Verhaltensweisen darstellen, die eine Adoleszenzkrise bemerkbar machen. Im Anschluss wird ein Einblick in die Definition des selbstverletzenden Verhaltens gegeben, wobei es keine einheitliche Definition gibt. Demnach werden eine Einteilung und Differenzierung von synonym verwendeten Begriffen wie Automutilation, Autoaggression und selbstverletzendes Verhalten vorgenommen und eine Definition für selbstverletzendes Verhalten erarbeitet, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit verwendet wird. Im achten Kapitel folgt eine Angabe der möglichen Klassifikationen und der Erscheinungsformen von selbstverletzendem Verhalten. Es wird dabei zwischen Häufigkeit, Verletzungsgras, Dauer, Automatisierung und Stereotypisierung differenziert. Auch häufig genutzte Instrumente und betroffene Körperstellen werden aufgegriffen. Die Prävalenz von selbstverletzendem Verhalten wird im neunten Kapitel ausgearbeitet, wobei sich die Angaben dazu je nach Literatur stark voneinander unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition Jugend – Pubertät - Adoleszenz
- Biologische und kognitive Entwicklung
- Biologische Veränderungen
- Kognitive Veränderungen
- Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz
- Adoleszenzkrise
- Risikoverhalten
- Definition Selbstverletzendes Verhalten
- Klassifikation und Erscheinungsformen selbstverletzender Verhaltensweisen
- Prävalenz
- Funktionen von selbstverletzendem Verhalten
- Erklärungsansätze
- Biologische Ansätze
- Lerntheoretischer Ansatz
- Psychoanalytischer Ansatz
- Entwicklungspsychopathologischer Ansatz
- Risikofaktoren
- Biologische Faktoren
- Kognitive Faktoren
- Emotionale Faktoren
- Soziale Faktoren
- Trauma und Missbrauch
- Komorbidität
- Persönlichkeitsstörungen
- Impulskontrollstörungen
- Substanzmissbrauch
- Essstörungen
- Affektive Störungen
- Dissoziative Störungen
- Das integrative Modell
- Prävention
- Pädagogische Intervention
- Grenzen der pädagogischen Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Selbstverletzendes Verhalten in der Adoleszenz und untersucht die pädagogischen Interventionsmöglichkeiten. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Phänomens zu entwickeln und praktische Handlungsmöglichkeiten für die pädagogische Arbeit aufzuzeigen.
- Definition und Erscheinungsformen von selbstverletzendem Verhalten
- Prävalenz und Funktionen des selbstverletzenden Verhaltens
- Erklärungsansätze und Risikofaktoren
- Komorbidität und das integrative Modell
- Prävention und pädagogische Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Selbstverletzendes Verhalten in der Adoleszenz ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Kapitel 2 erläutert die Begriffsdefinitionen von Jugend, Pubertät und Adoleszenz. Kapitel 3 geht auf die biologischen und kognitiven Veränderungen in der Adoleszenz ein. Kapitel 4 behandelt die Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz und Kapitel 5 befasst sich mit der Adoleszenzkrise. Kapitel 6 beleuchtet das Risikoverhalten in der Adoleszenz. Kapitel 7 definiert Selbstverletzendes Verhalten und Kapitel 8 klassifiziert verschiedene Erscheinungsformen. Kapitel 9 geht auf die Prävalenz ein, während Kapitel 10 die Funktionen von selbstverletzendem Verhalten erläutert. Kapitel 11 behandelt verschiedene Erklärungsansätze für selbstverletzendes Verhalten. Kapitel 12 beschäftigt sich mit Risikofaktoren. Kapitel 13 beleuchtet die Komorbidität von selbstverletzendem Verhalten mit anderen psychischen Störungen. Kapitel 14 stellt das integrative Modell vor, das verschiedene Erklärungsansätze vereint. Kapitel 15 befasst sich mit Präventionsmaßnahmen und Kapitel 16 mit pädagogischen Interventionen. Kapitel 17 thematisiert die Grenzen pädagogischer Arbeit.
Schlüsselwörter
Selbstverletzendes Verhalten, Adoleszenz, Jugend, Pubertät, Risikoverhalten, Prävention, Intervention, Pädagogik, Komorbidität, Entwicklungsaufgaben, Erklärungsansätze, Biologische Faktoren, Kognitive Faktoren, Emotionale Faktoren, Soziale Faktoren, Trauma, Missbrauch, Persönlichkeitsstörungen, Impulskontrollstörungen, Substanzmissbrauch, Essstörungen, Affektive Störungen, Dissoziative Störungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist selbstverletzendes Verhalten in der Adoleszenz so häufig?
Die Adoleszenz ist eine Phase hoher Vulnerabilität, in der biologische und kognitive Veränderungen sowie komplexe Entwicklungsaufgaben zu Krisen führen können.
Was ist der Unterschied zwischen Pubertät und Adoleszenz?
Die Pubertät bezeichnet primär die biologische Geschlechtsreifung, während die Adoleszenz den gesamten psychosozialen Übergang vom Kind zum Erwachsenen umfasst.
Welche Funktionen hat selbstverletzendes Verhalten (SVV)?
SVV kann der Affektregulation, der Selbstbestrafung, der Beendigung von Dissoziationen oder als Hilferuf in sozialen Konflikten dienen.
Welche pädagogischen Interventionsmöglichkeiten gibt es?
Wichtig sind Kenntnisse über Handlungsanweisungen, das Erkennen von Risikofaktoren und die Zusammenarbeit mit psychotherapeutischen Einrichtungen.
Welche psychischen Störungen treten oft gemeinsam mit SVV auf?
Häufig besteht eine Komorbidität mit Persönlichkeitsstörungen (z.B. Borderline), Essstörungen, Substanzmissbrauch oder affektiven Störungen.
- Citation du texte
- Vanessa Schneider (Auteur), Selbstverletzendes Verhalten in der Adoleszenz. Welche pädagogischen Interventionsmöglichkeiten gibt es?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1331409