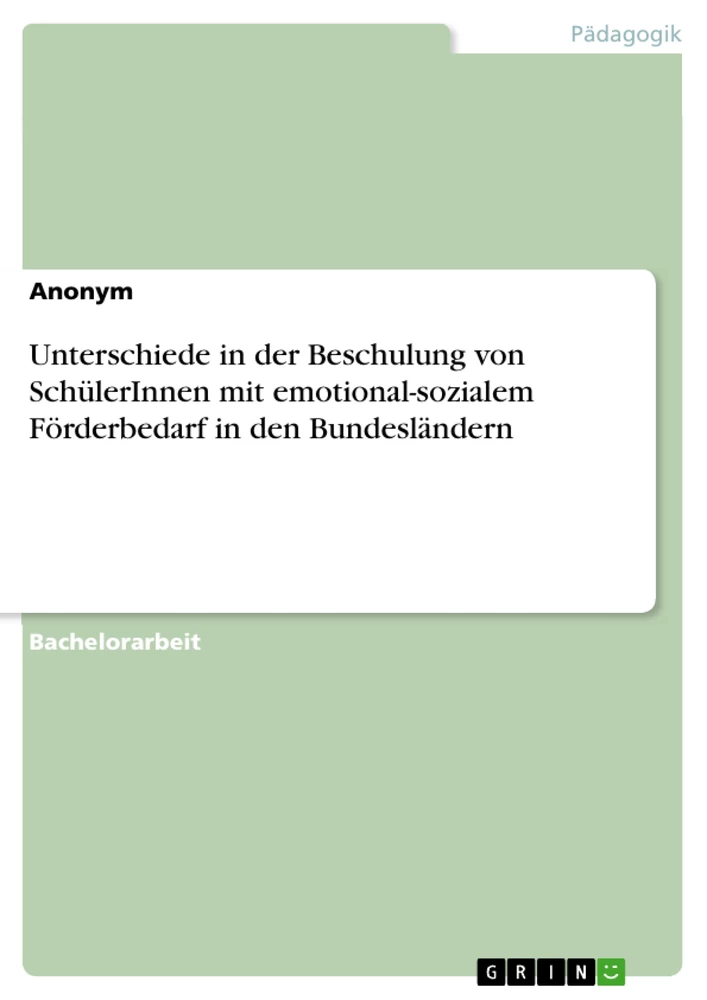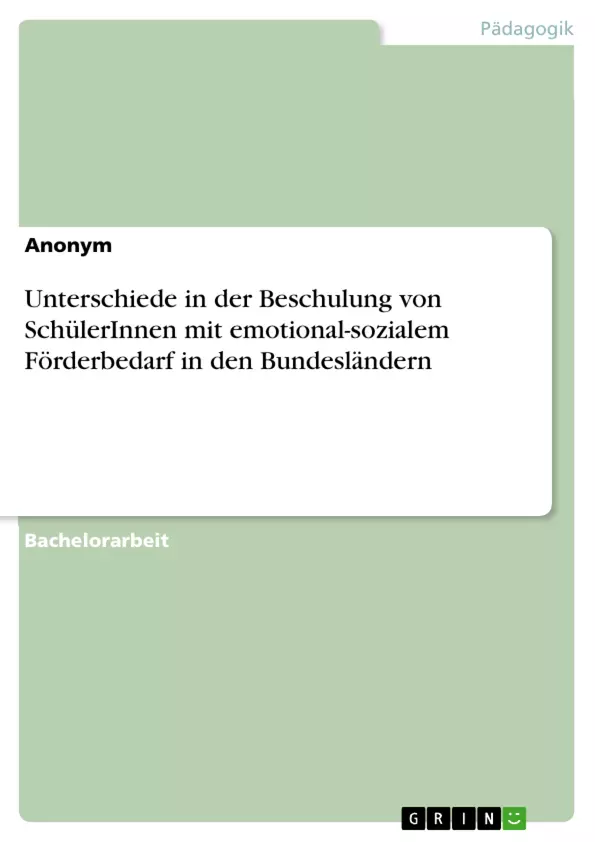Für eine Hinführung zum Thema wird die emotionale und soziale Entwicklung im Kindes- und Jugendalter sowie deren Zusammenhang und die Entstehung von Störungen im emotional-sozialen Entwicklungsverlauf erläutert. Daran anschließend wird der für den schulischen Bereich verwendete Begriff des emotionalen und sozialen Förderbedarfs konkretisiert und damit auf die Beschulung dieses SchülerInnenklientel eingegangen.
Im zweiten Kapitel wird die Geschichte der Beschulung von "schwierigen" Kindern und Jugendlichen rekonstruiert, um ein historiografisches Bewusstsein für die Pädagogik bei Verhaltensstörungen und damit eine Vorstellung des Ursprungs gegenwärtiger Beschulungsmöglichkeiten zu erlangen. Daraus ergibt sich gegebenenfalls die Frage nach dem "Besonderen" in der Beschulung dieser SchülerInnen oder aber, warum für diese ein separierender Förderort als notwendig angesehen wird.
Die geschichtliche Rekonstruktion und heutigen Beschulungsmöglichkeiten führen zu den derzeit bestehenden Unterschieden in der Beschulung dieser SchülerInnen in den sechzehn deutschen Bundesländern. Dabei wird jeweils in einem rechtlichen Teil vorrangig auf die Schulgesetze und sonderpädagogischen Verordnungen sowie Angaben der Ministerien zum Feststellungsverfahren, dem Wahlrecht der Erziehungsberechtigten, der inklusiven oder separierenden Beschulung und auf Besonderheiten eingegangen. In einem weiteren, praktischen Teil, werden dann vergangene und aktuelle Zahlen zu den Beschulungsorten ausgewertet. Anhand dieser Auswertungen und der rechtlichen Gegebenheiten wird versucht, die Gründe für die jeweilige Entwicklung und die derzeitig hohen oder niedrigen Zahlen zu den SchülerInnen mit Förderbedarf in der emotional-sozialen Entwicklung an den allgemeinbildenden oder Förderschulen zu ermitteln. Außerdem wird mithilfe aktueller Vorausberechnungen der Kultusministerkonferenz eine Prognose der weiteren Entwicklungen in den Ländern abgebildet.
Im letzten Kapitel erfolgt eine knappe Zusammenfassung der im vorherigen Kapitel vorgestellten Unterschiede in der Beschulung von SchülerInnen mit emotional-sozialem Förderbedarf in den Bundesländern. Außerdem wird anhand der einzelnen Entwicklungsprognosen der Bundesländer eine voraussichtliche Exklusionsquote für Deutschland vorgestellt und eine abschließende Stellungnahme vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Kinder und Jugendliche mit Störungen in der emotional-sozialen Entwicklung
- 1.1 Emotional-soziale Entwicklung
- 1.2 Emotional-soziale Entwicklungsstörungen
- 1.3 Emotional-sozialer Förderbedarf
- 2. Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit emotional-sozialem Förderbedarf
- 2.1 Geschichtliche Entwicklung
- 2.2 Gegenwärtige Beschulungsmöglichkeiten
- 2.2.1 Inkludierende Beschulung
- 2.2.2 Integrierende Beschulung
- 2.2.3 Separierende Beschulung
- 2.3 Besonderer Bildungs- und Erziehungsauftrag
- 3. Unterschiede in der Beschulung von SchülerInnen mit emotional-sozialem Förderbedarf in den Bundesländern
- 3.1 Baden-Württemberg
- 3.1.1 Rechtliche Lage
- 3.1.2 Praktische Umsetzung
- 3.2 Bayern
- 3.2.1 Rechtliche Lage
- 3.2.2 Praktische Umsetzung
- 3.3 Berlin
- 3.3.1 Rechtliche Lage
- 3.3.2 Praktische Umsetzung
- 3.4 Brandenburg
- 3.4.1 Rechtliche Lage
- 3.4.2 Praktische Umsetzung
- 3.5 Bremen
- 3.5.1 Rechtliche Lage
- 3.5.2 Praktische Umsetzung
- 3.6 Hamburg
- 3.6.1 Rechtliche Lage
- 3.6.2 Praktische Umsetzung
- 3.7 Hessen
- 3.7.1 Rechtliche Lage
- 3.7.2 Praktische Umsetzung
- 3.8 Mecklenburg-Vorpommern
- 3.8.1 Rechtliche Lage
- 3.8.2 Praktische Umsetzung
- 3.9 Niedersachsen
- 3.9.1 Rechtliche Lage
- 3.9.2 Praktische Umsetzung
- 3.10 Nordrhein-Westfalen
- 3.10.1 Rechtliche Lage
- 3.10.2 Praktische Umsetzung
- 3.11 Rheinland-Pfalz
- 3.11.1 Rechtliche Lage
- 3.11.2 Praktische Umsetzung
- 3.12 Saarland
- 3.12.1 Rechtliche Lage
- 3.12.2 Praktische Umsetzung
- 3.13 Sachsen
- 3.13.1 Rechtliche Lage
- 3.13.2 Praktische Umsetzung
- 3.14 Sachsen-Anhalt
- 3.14.1 Rechtliche Lage
- 3.14.2 Praktische Umsetzung
- 3.15 Schleswig-Holstein
- 3.15.1 Rechtliche Lage
- 3.15.2 Praktische Umsetzung
- 3.16 Thüringen
- 3.16.1 Rechtliche Lage
- 3.16.2 Praktische Umsetzung
- Rechtliche Grundlagen der Beschulung von SchülerInnen mit emotional-sozialem Förderbedarf in den Bundesländern
- Praktische Umsetzung der Beschulung in den einzelnen Bundesländern
- Entwicklung der Inklusionsquote in den Bundesländern
- Gründe für die Unterschiede in der Beschulung von SchülerInnen mit emotional-sozialem Förderbedarf
- Herausforderungen und Möglichkeiten der Inklusion von SchülerInnen mit emotional-sozialem Förderbedarf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Unterschiede in der Beschulung von SchülerInnen mit emotional-sozialem Förderbedarf in den deutschen Bundesländern. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen und die praktische Umsetzung der Beschulung in den einzelnen Ländern zu untersuchen und die Entwicklung der Inklusionsquote in den Bundesländern zu prognostizieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der emotional-sozialen Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen ein und erläutert den Begriff des emotional-sozialen Förderbedarfs. Kapitel 1 beschreibt die historische Entwicklung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit emotional-sozialen Entwicklungsstörungen und beleuchtet die Entstehung des Begriffs der "schwierigen" Kinder. Kapitel 2 fokussiert auf die Unterschiede in der Beschulung von SchülerInnen mit emotional-sozialem Förderbedarf in den einzelnen Bundesländern. Hierbei werden sowohl die rechtlichen Grundlagen als auch die praktische Umsetzung der Beschulung anhand von Statistiken und Beispielen aus den einzelnen Ländern dargestellt.
Schlüsselwörter
Emotionale und soziale Entwicklung, Entwicklungsstörungen, emotional-sozialer Förderbedarf, Inklusion, Exklusion, Beschulung, Förderschwerpunkt, Schulgesetze, Verordnungen, Ministerien, Bundesländer, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „emotional-sozialem Förderbedarf“?
Dies betrifft Schüler, deren Erleben und Verhalten so beeinträchtigt ist, dass sie im Unterricht nicht ausreichend gefördert werden können und spezifische pädagogische Unterstützung benötigen.
Wie unterscheidet sich die Beschulung in den verschiedenen Bundesländern?
Die Unterschiede liegen vor allem in den Schulgesetzen, dem Grad der Inklusion an Regelschulen gegenüber der Beschulung in Förderschulen sowie den länderspezifischen Feststellungsverfahren.
Was ist der Unterschied zwischen inklusiver und separierender Beschulung?
Inklusion bedeutet das gemeinsame Lernen aller Kinder an einer Regelschule. Separierung bezeichnet die Unterrichtung in speziellen Förderschulen oder Klassen für Erziehungshilfe.
Welche Rolle spielt das Wahlrecht der Erziehungsberechtigten?
In vielen Bundesländern können Eltern entscheiden, ob ihr Kind eine Förderschule oder eine inklusive Regelschule besucht, wobei die praktischen Möglichkeiten je nach Bundesland variieren.
Wie hoch ist die Inklusionsquote in Deutschland bei diesem Förderschwerpunkt?
Die Quote ist sehr unterschiedlich: Während einige Bundesländer (z.B. Bremen oder Hamburg) stark auf Inklusion setzen, gibt es in anderen Ländern (z.B. Bayern) weiterhin ein starkes Förderschulsystem.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2022, Unterschiede in der Beschulung von SchülerInnen mit emotional-sozialem Förderbedarf in den Bundesländern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1331389