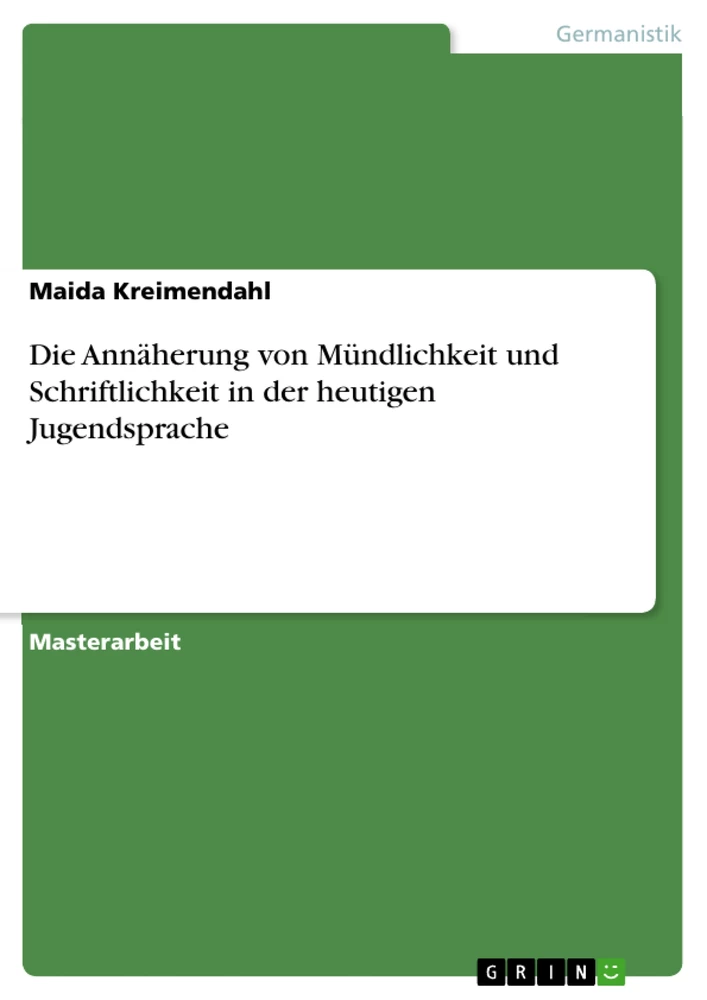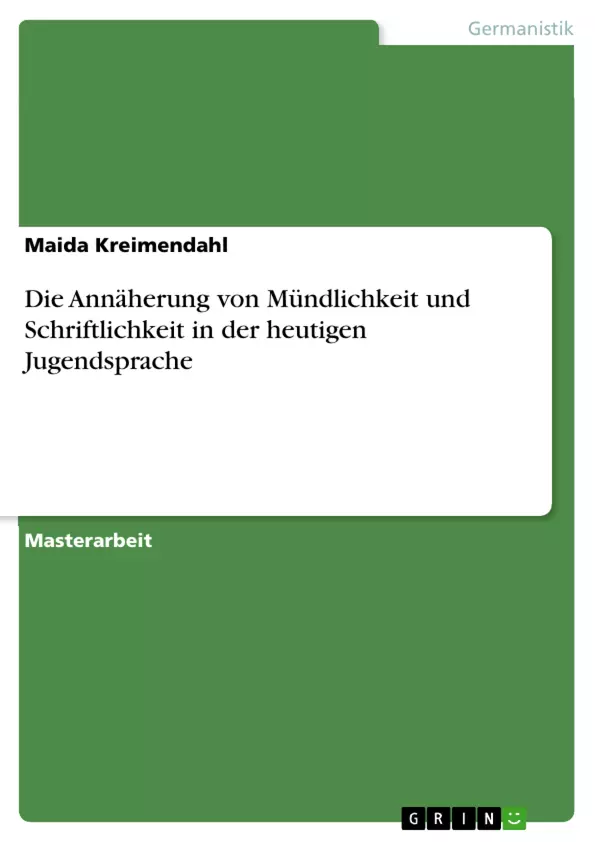Der primäre Impuls zu der vorliegenden Studie geht von den neuen Medien aus. Darunter werden im Folgenden die durch das Internet, genauer dem sogenannten Chat und den social networks generierten Kommunikationsräume und besonders deren sprachliche Realisationsformen verstanden. Schon ein erster flüchtiger Blick zeigt, dass die in diesen beiden Bereichen verwendete Sprache Eigentümlichkeiten aufweist, die mit den herkömmlichen linguistischen Kategorien von Mündlichkeit und Schriftlichkeit nicht problemlos erfasst werden können. In meiner Untersuchung will ich deshalb der Frage nach gehen, ob und inwiefern sich dieser erste Eindruck bestätigen lässt.
Ziel der Arbeit ist es zu klären, inwieweit sich die dort präsentierten sprachlichen Äußerungen mit den herkömmlichen linguistischen Kategorien erfassen lassen oder ob sie auf Grund ihres verschmelzenden Charakters von gesprochener und geschriebener Sprache in neuartigen Formen realisiert werden, die ein modifiziertes begriffliches Instrumentarium zu ihrer sachadäquaten Erfassung verlangen. Zum anderen stellt sich die Frage, ob und in welchem Ausmaß diese zunächst hypothetisch angenommene neue Realisationsform von Sprache die herkömmlichen Bereiche mündlicher und schriftlicher Kommunikation im Zuge vertikalen Sprachkontakts beeinflusst und ob sich eine Interdependenz zwischen allen drei konzeptionellen Ausprägungen entwickelt.
Dazu analysiere ich anhand von empirischen Fallstudien die mediale Realisation von Sprache im SchülerVZ. Das SchülerVZ ist das mitgliederstärkste soziale Netzwerk Jugendlicher im deutschen Sprachraum. Zur Erforschung der Besonderheiten der Kommunikation unter Jugendlichen, soweit sie verschriftlicht ist, empfiehlt sich dieses Medium insbesondere deshalb, weil es durch bestimmte Sicherheitsmaßnahmen dem Zugriff und der Einsichtnahme Erwachsener so gut wie entzogen ist. Außerdem hat dieses Medium gegenüber dem Chat, dessen Kommunikationsstrukturen von der linguistischen und soziolinguistischen Forschung schon häufig zum Gegenstand der Untersuchung gemacht worden ist, den Vorteil, dass die dort anzutreffende Kommunikation in Form von konservierten Beiträgen zur Verfügung steht und sich damit in authentischer und gleichzeitig dauerhaft überprüfbarer Form als Material anbietet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sprachwandel
- 2.1 Sprache als Ergon oder Energeia
- 2.2 e-language und i-language bei Chomsky
- 2.3 Sprachphilosophische Überlegungen
- 2.4 Die Frage nach dem Ursprung der Sprache
- 2.5 Sprachverfall durch Sprachwandel?
- 2.6 Sprachwandelprinzipien
- 2.6.1 Das Prinzip der Ökonomie
- 2.6.2 Sprachwandel durch Sprachkontakt und Analogiebildung
- 2.6.3 Sprachwandel durch Reanalyse und Grammatikalisierung
- 2.7 Gesetzmäßigkeiten von Sprachwandel
- 2.7.1 Das Piotrowski-Gesetz
- 2.8 Zusammenfassung
- 3. Jugendsprache
- 3.1 Spricht die Jugend eine andere Sprache?
- 3.2 Neue Antworten auf alte Fragen
- 3.3 Eine Jugend, eine Sprache?
- 3.3.1 Eine Jugend?
- 3.3.2 Eine Sprache?
- 3.4 Sprache als Träger sozialer Funktionen
- 3.5 Sprache als Instrument sozialen Protests
- 3.6 Jugendsprache - Standardsprache – Erwachsenensprache?
- 3.7 (K)eine Jugend, (k)eine Sprache!
- 4. Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- 4.1 Konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- 4.1.1 Konzeptionelle Mündlichkeit
- 4.1.2 Konzeptionelle Schriftlichkeit
- 4.1.3 Sprachliche Besonderheiten und Kontextgebundenheit
- 4.2 Das,,Nähe-Distanz\"-Modell von Koch/Oesterreicher
- 4.3 Sprachgestaltung in den neuen Medien
- 4.3.1 Konstitutive Merkmale der Kommunikation in den neuen Medien
- 4.3.2 Chat
- 4.3.2.1 Merkmale gesprochener Sprache im Chat
- 4.3.2.2 Chat: verschriftlichte Mündlichkeit oder normfreie Schriftsprache?
- 5. Eine Fallstudie anhand des SchülerVZ
- 5.1 Das Schüler VZ
- 5.2 Beschreibung des Materials
- 5.3 Sprache in ökonomischer, kompensatorischer und kreativer Verwendung
- 5.3.1 Abweichungen auf Grund sprachlicher Ökonomie
- 5.3.2 Kompensation von Prosodie und nonverbaler Kommunikation
- 5.3.2.1 Prosodie in Form von Buchstaben und Interpunktion
- 5.3.2.2 Emoticons
- 5.3.3 Sprache in kreativer Verwendung
- 5.3.3.1 Einfluss der technischen Rahmenbedingungen
- 5.3.3.2 Phonetische Orthographie
- 5.3.3.3 Dialektale Einflüsse
- 5.3.3.4 Phänomene sprachlicher Kreativität
- Sprachwandel und seine Prinzipien, insbesondere das Prinzip der Ökonomie
- Die Entwicklung der Jugendsprache im Kontext neuer Medien
- Das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der digitalen Kommunikation
- Die Rolle von Sprache als Träger sozialer Funktionen und Instrument sozialer Proteste
- Die Analyse von Sprachphänomenen im SchülerVZ, die auf ökonomische, kompensatorische und kreative Verwendung von Sprache hindeuten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit sich die Sprache in neuen Medien wie dem Chat und sozialen Netzwerken von den herkömmlichen Kategorien der Mündlichkeit und Schriftlichkeit abgrenzen lässt. Sie untersucht, ob und in welchem Ausmaß diese Sprache die herkömmlichen Bereiche mündlicher und schriftlicher Kommunikation beeinflusst. Die Untersuchung erfolgt anhand einer empirischen Fallstudie im Schüler VZ.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung und die Zielsetzung der Arbeit vor, die sich mit der Untersuchung der Sprache im Schüler VZ auseinandersetzt. Kapitel 2 beleuchtet den Sprachwandel aus verschiedenen Perspektiven und legt dabei den Fokus auf das Prinzip der Ökonomie. Kapitel 3 untersucht die Jugendsprache und ihre Besonderheiten im Kontext neuer Medien. Kapitel 4 befasst sich mit dem Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit und stellt die konzeptionelle Abgrenzung beider Bereiche sowie die Regulierungsfunktion von Sprache im Kontext von „Nähe und Distanz“ anhand des Koch/Oesterreicher'schen Modells dar. Das fünfte Kapitel analysiert die Sprache im SchülerVZ als Fallstudie und betrachtet das Material unter dem Gesichtspunkt der ökonomischen, kompensatorischen und kreativen Verwendung von Sprache.
Schlüsselwörter
Sprachwandel, Jugendsprache, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, neue Medien, SchülerVZ, Chat, Ökonomie, Kompensation, Kreativität, soziale Funktionen, sozialer Protest.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert das Internet die heutige Jugendsprache?
Durch neue Medien wie Chats und soziale Netzwerke (z. B. SchülerVZ) verschmelzen Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu neuen Realisationsformen, die oft informeller und ökonomischer sind.
Was ist das Prinzip der sprachlichen Ökonomie?
Es beschreibt das Bestreben, mit minimalem Aufwand (z. B. Abkürzungen, Kleinschreibung) maximale Information zu übermitteln, was besonders in der digitalen Kommunikation wichtig ist.
Welche Rolle spielen Emoticons in der digitalen Sprache?
Emoticons dienen der Kompensation von nonverbaler Kommunikation (Mimik, Gestik) und Prosodie, um die emotionale Ebene einer schriftlichen Nachricht zu verdeutlichen.
Was besagt das „Nähe-Distanz“-Modell von Koch/Oesterreicher?
Es unterscheidet zwischen medialer (Form) und konzeptioneller (Stil) Mündlichkeit/Schriftlichkeit. Digitale Texte sind oft medial schriftlich, aber konzeptionell mündlich (Sprache der Nähe).
Führt der Sprachwandel durch neue Medien zu einem Sprachverfall?
Die Arbeit diskutiert diese Frage kritisch und betrachtet die Veränderungen eher als kreative Weiterentwicklung und Anpassung an technische Rahmenbedingungen denn als reinen Verfall.
- Citation du texte
- Maida Kreimendahl (Auteur), 2011, Die Annäherung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der heutigen Jugendsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1331228