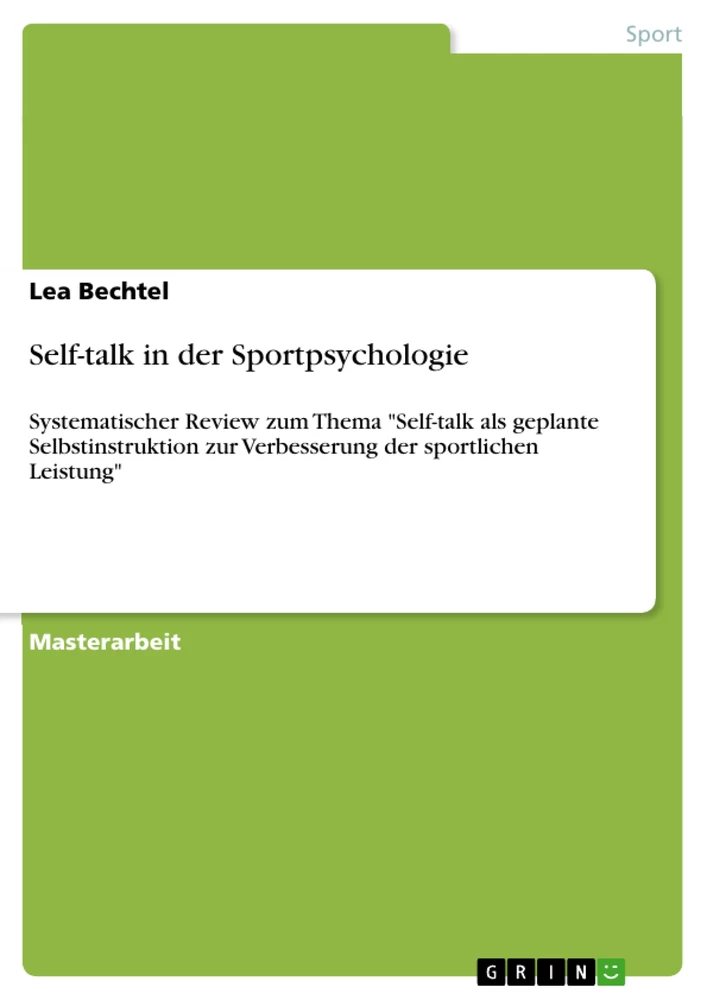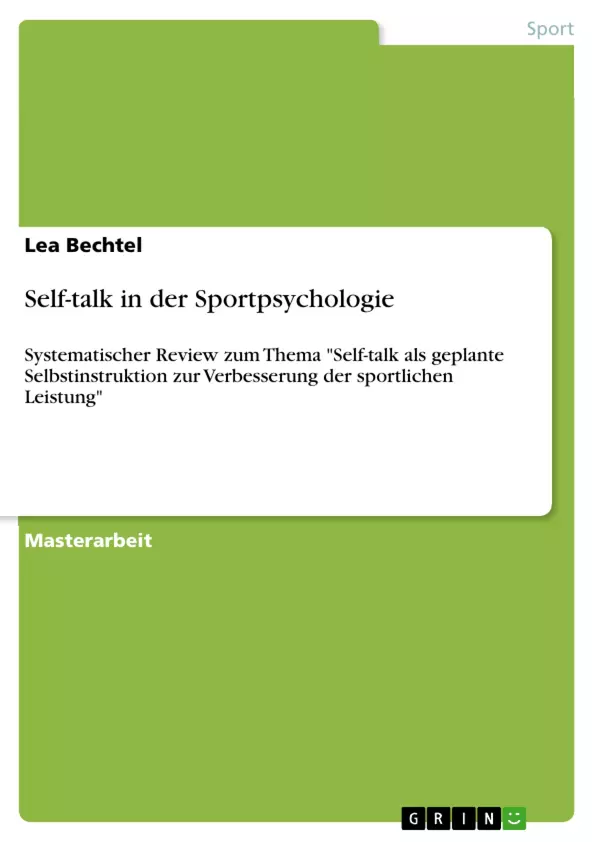Das Ziel dieser Literaturrecherche ist es deutlich zu machen, ob Self-talk in Form einer Selbstinstruktion die sportliche Leistung positiv beeinflussen kann. Es soll der Zusammenhang zwischen verschieden psychologischen Faktoren deutlich gemacht werden und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Des Weiteren wird auch die Auswirkung von äußeren Faktoren auf die sportliche Leistung betrachtet. Die Selbstwirksamkeit wird ebenfalls mit einbezogen und im Zusammenhang zum Self-talk genauer betrachtet.
Die kognitiven Fertigkeiten werden genau definiert und erläutert. Zudem umfasst die Recherche mehrere Themenbereiche, da die Studienlage zu dieser Thematik noch nicht all zu umfangreich ist. Aus diesem Grund wird die Literaturrecherche auf mehrere Bereiche erweitert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Problemstellung
- 2 Zielsetzung
- 3 Gegenwärtiger Kenntnisstand
- 3.1 Mentales Training
- 3.2 Resilienz
- 3.3 Stoizismus
- 3.4 Selbstwirksamkeit
- 3.5 Praxisbeispiele
- 3.6 Selbstgesprächregulation
- 3.6.1.1 Wichtige Strategien in Form von Selbstgesprächen
- 3.7 Der CFQ Fragebogen
- 3.8 Paivio taxonomie
- 4 Methodik
- 4.1 Vorgehensweise der Literaturrecherche
- 4.2 Darstellung der Literaturrecherche
- 4.3 Grafische Darstellung der Literaturrecherche
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Darstellung der empirischen Ergebnisse
- 6 Diskussion
- 6.1 Kritische Bewertung der eigenen Vorgehensweise
- 6.2 Kritische Bewertung der Ergebnisse
- 6.3 Schlussfolgerung im Hinblick auf die Handlungsempfehlung für Self-talk im Sport
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Einfluss von Self-talk als geplante Selbstinstruktion auf die Verbesserung der sportlichen Leistung. Ziel ist es, den aktuellen Kenntnisstand zum Thema Self-talk in der Sportpsychologie systematisch zu erarbeiten und kritisch zu bewerten.
- Der Einfluss von Self-talk auf die sportliche Leistung
- Die Rolle von mentalem Training und Selbstwirksamkeit
- Die Bedeutung von Resilienz und Stoizismus im Kontext von Self-talk
- Methodische Vorgehensweisen bei der Erforschung von Self-talk
- Handlungsempfehlungen für den Einsatz von Self-talk im Sport
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung führt in die Thematik des Konstruktivismus ein und betont den Einfluss subjektiver Wahrnehmung und Gedanken auf unsere Realität. Sie hebt die vorwiegend negative Natur vieler Gedanken hervor und stellt die Frage nach der Möglichkeit, Gedanken zur Verbesserung des Wohlbefindens und der Leistung zu beeinflussen. Beispiele von Extremsportlern wie Ross Edgley und David Goggins unterstreichen das Potential mentaler Stärke und Selbststeuerung.
3 Gegenwärtiger Kenntnisstand: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu mentalem Training, Resilienz, Stoizismus und Selbstwirksamkeit im Sport. Es beleuchtet verschiedene Konzepte und Strategien der Selbstgesprächsregulation und präsentiert Praxisbeispiele erfolgreicher Athleten, die Self-talk effektiv einsetzen. Der CFQ Fragebogen und die Paivio Taxonomie werden als relevante Methoden zur Erfassung und Analyse von Self-talk vorgestellt. Die Bedeutung von Aufmerksamkeits-, Aktivations- und Vorstellungsregulation wird im Kontext des mentalen Trainings diskutiert. Der Einfluss von Motivation und Volition auf die sportliche Leistung wird ebenfalls erläutert.
4 Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die systematische Vorgehensweise der Literaturrecherche, einschließlich der verwendeten Fachdatenbanken, Suchbegriffe, Filterkriterien und die grafische Darstellung der Ergebnisse der Recherche. Es bietet detaillierte Informationen über die Auswahl der relevanten Studien und die angewandte Methodik.
5 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Literaturrecherche, einschließlich der empirischen Befunde zu den verschiedenen Aspekten von Self-talk im Sport. Eine detaillierte Darstellung der empirischen Daten wird bereitgestellt, die die Grundlage für die anschließende Diskussion bilden.
6 Diskussion: Die Diskussion analysiert die Ergebnisse kritisch. Sie bewertet die eigene Vorgehensweise und die gewonnenen Erkenntnisse bezüglich Self-talk Regulation, Selbstwirksamkeit, Motivation und Volition im Kontext der dualen Kodierungstheorie. Resilienz und Stoizismus werden ebenfalls im Hinblick auf ihre Bedeutung für den erfolgreichen Einsatz von Self-talk diskutiert. Zusammenfassend leitet die Diskussion zu Handlungsempfehlungen für den Einsatz von Self-talk im Sport.
Schlüsselwörter
Self-talk, Selbstinstruktion, Sportpsychologie, Mentales Training, Selbstwirksamkeit, Resilienz, Stoizismus, Motivation, Volition, Leistungsverbesserung, Literaturrecherche, Empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Der Einfluss von Self-talk auf die sportliche Leistung
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Einfluss von Self-talk (geplante Selbstinstruktion) auf die Verbesserung der sportlichen Leistung. Sie analysiert den aktuellen Forschungsstand und bewertet diesen kritisch.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss von Self-talk auf die sportliche Leistung, die Rolle von mentalem Training und Selbstwirksamkeit, die Bedeutung von Resilienz und Stoizismus im Kontext von Self-talk, methodische Vorgehensweisen bei der Erforschung von Self-talk und Handlungsempfehlungen für den Einsatz von Self-talk im Sport.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung und Problemstellung, Zielsetzung, Gegenwärtiger Kenntnisstand (mit Unterkapiteln zu mentalem Training, Resilienz, Stoizismus, Selbstwirksamkeit, Praxisbeispielen, Selbstgesprächsregulation, CFQ Fragebogen und Paivio Taxonomie), Methodik (mit Unterkapiteln zur Literaturrecherche und deren Darstellung), Ergebnisse, Diskussion (mit kritischer Bewertung der Vorgehensweise und Ergebnisse sowie Handlungsempfehlungen) und Zusammenfassung.
Welche Methoden wurden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit beschreibt eine systematische Literaturrecherche, einschließlich der verwendeten Datenbanken, Suchbegriffe und Filterkriterien. Die Ergebnisse der Recherche werden grafisch dargestellt. Der CFQ Fragebogen und die Paivio Taxonomie werden als relevante Methoden zur Erfassung und Analyse von Self-talk erwähnt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der Literaturrecherche, einschließlich empirischer Befunde zu verschiedenen Aspekten von Self-talk im Sport. Eine detaillierte Darstellung der empirischen Daten bildet die Grundlage für die anschließende Diskussion.
Wie wird die Diskussion der Ergebnisse aufgebaut?
Die Diskussion analysiert die Ergebnisse kritisch, bewertet die eigene Vorgehensweise und die gewonnenen Erkenntnisse zu Self-talk Regulation, Selbstwirksamkeit, Motivation und Volition im Kontext der dualen Kodierungstheorie. Resilienz und Stoizismus werden ebenfalls im Hinblick auf ihre Bedeutung für den erfolgreichen Einsatz von Self-talk diskutiert. Die Diskussion leitet zu Handlungsempfehlungen für den Einsatz von Self-talk im Sport.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Self-talk, Selbstinstruktion, Sportpsychologie, Mentales Training, Selbstwirksamkeit, Resilienz, Stoizismus, Motivation, Volition, Leistungsverbesserung, Literaturrecherche, Empirische Forschung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, den aktuellen Kenntnisstand zum Thema Self-talk in der Sportpsychologie systematisch zu erarbeiten und kritisch zu bewerten, um den Einfluss von Self-talk auf die sportliche Leistung zu untersuchen.
- Quote paper
- Lea Bechtel (Author), 2022, Self-talk in der Sportpsychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1329048